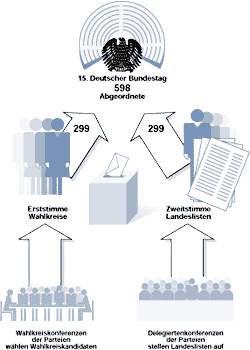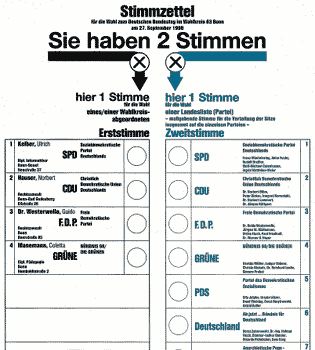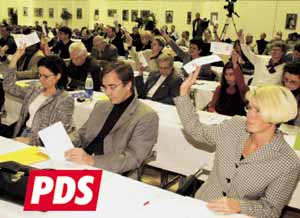Titelthema
DIE PARTEIEN STELLEN IHRE KANDIDATEN AUF
Die Bundestagswahl hat schon begonnen
|
|||||||||
|
Der nächste Bundestag wird am 22. September gewählt. Das hat sich inzwischen herumgesprochen. Was von der Öffentlichkeit jedoch nur sporadisch wahrgenommen wird: Im Grunde hat die Bundestagswahl längst begonnen. Landauf, landab laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, tagen Parteivorstände, beschließen Mitglieder- und Vertreterversammlungen, Kreis- und Landesparteitage, wer ins Rennen gehen und im September auf den Stimmzetteln stehen soll. Wie funktioniert das? Wer entscheidet wann worüber? Hier ein Blick auf die interessanten Details des wichtigsten Vorganges der Demokratie: der Weg aus dem Volk in die Volksvertretung.
Abgeordneter ist Abgeordneter. Alle Mitglieder des Bundestages haben die gleichen Rechte. Alle werden vom Volk gewählt. Aber auf zwei verschiedenen Wegen: 299 auf Grund von so genannten "Kreiswahlvorschlägen", die anderen 299 auf Grund von so genannten "Landeswahlvorschlägen". Die einen stehen links auf den Stimmzetteln zur Wahl, die anderen rechts. Aber wie kommen sie dort drauf?
|
Schauen wir uns zunächst die linke, schwarz gedruckte Hälfte an. Diese ist von Wahlkreis zu Wahlkreis verschieden. Mal gibt es mehr, mal weniger Bewerber - aber immer andere. Wer in den Bundestag möchte, kann sich als Direktkandidat nur in einem einzigen der 299 Wahlkreise, in die die Republik mit jeweils ungefähr einheitlich vielen Wahlberechtigten aufgeteilt wird, bewerben. Dazu reicht es natürlich nicht, einfach nur die Hand zu heben. Man stelle sich vor, wie dann die Stimmzettel aussähen, wenn nur jeder hundertste Wahlberechtigte Lust hätte, selbst zu kandidieren und automatisch aufgestellt würde: Die Liste wäre weit über tausend Namen lang.
Es sollen also vor allem Kandidaten zum Zug kommen, die schon einen gewissen Zuspruch in der Bevölkerung besitzen. Sei es, dass sie sich in einer Partei vorgestellt haben und von den Mitgliedern als ideale Vertretung für den jeweiligen Wahlkreis aus Sicht dieser Partei angesehen werden. Sei es, dass sie eine Liste mit mindestens 200 Wahlberechtigten vorlegen, die mit Name, Anschrift und Unterschrift bezeugen, dass sie hinter der Kandidatur des Bewerbers stehen. Aber auch hier gilt: Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Kandidaten unterstützen.
|
||||||||||
Rote Rosen für Ute Vogt nach der Wahl zur SPD-Spitzenkandidatin in Baden-Württemberg.
Ebenfalls kann jede Partei, ganz gleich wie groß oder klein sie ist, in jedem Wahlkreis nur einen Vorschlag einreichen. Und dieser Vorschlag muss auf genau vorgeschriebene Weise zu Stande gekommen sein. Bundes- oder Landesebenen haben hier nichts zu sagen. Die Entscheidung fällen allein die Mitglieder vor Ort - oder die von ihnen gewählten Delegierten in einer Vertreterversammlung. Vom Prinzip her ähnelt die Nominierung der örtlichen Kandidaten dem System der Vorwahlen bei der US-Präsidentschaftsentscheidung: Mehrere Bewerber, die sich selbst melden oder von Parteifreunden ins Spiel gebracht werden, stellen sich im Vorfeld der parteiinternen Abstimmung der Basis vor, beschreiben ihre politische Einstellung, ihren Werdegang und ihre Pläne. Das kann auf den Termin der Versammlung selbst beschränkt sein. Das kann aber auch mehrere Wochen dauern.
Zeitlich eingegrenzt ist dieses Verfahren nämlich nur durch zwei Daten: Frühestens 32 Monate nach Beginn einer Wahlperiode dürfen die Parteiversammlungen über Vorschläge für die nächsten Wahlen abstimmen (außer natürlich bei vorgezogenen Wahlen). Und rechtzeitig vor der abschließenden Entscheidung durch den Kreiswahlausschuss müssen die Vorschläge offiziell beim örtlich zuständigen Gremium eingereicht sein. Und das befasst sich am 58. Tag vor der Wahl über die endgültige Zulassung der eingegangenen Vorschläge.
Innerhalb dieses Zeitfensters haben die Parteien völlig freie Hand, wann sie die Bewerber sichten und "ihren" Mann oder "ihre" Frau ins örtliche Rennen um die Direktkandidatur im Wahlkreis schicken. Die innerparteiliche Wahl muss geheim erfolgen, und die Übermittlung des Ergebnisses ist ebenfalls an bestimmte Vorgaben gebunden. Der Kreiswahlleiter - in der Regel ein Behördenvertreter - und die von ihm benannten Mitglieder des Kreiswahlausschusses - in der Regel Vertreter der beteiligten Parteien - prüfen die Vorschläge daraufhin, ob sie frist- und formgerecht eingereicht sind, ob die genannten Kandidaten das Votum ihrer Parteien oder als Einzelbewerber genügend Unterschriften haben, ob sie wählbar sind und ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben. Wenn dann alles in Ordnung ist, geht die Meldung weiter an den Landes- und Bundeswahlleiter.
|
Friedrich Merz, Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU im Bundestag, bedankt sich für die Wahl auf den Listenplatz eins der CDU in Nordrhein-Westfalen.
Aber auch in umgekehrter Reihenfolge gibt es Mitteilungen, die auf dem örtlichen Wahlzettel wieder auftauchen. Und damit kommen wir zur rechten Hälfte, der in blauer Schrift gedruckten Seite. Und das ist aus Bundessicht die weitaus interessantere. Denn wer im jeweiligen Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt, mag für den Bürger in seiner Stadt und seinem Kreis von überragendem Interesse sein - auf die neue Parteiengewichtung im nächsten Bundestag hat dies keinen Einfluss. Wie stark eine Fraktion, also der Zusammenschluss von Abgeordneten mit gleicher Parteizugehörigkeit, im Parlament wird, hängt von der Zweitstimme ab, also dem Kreuzchen auf der blauen Hälfte des Stimmzettels.
Alle diese Kreuze werden im jeweiligen Bundesland bei den einzelnen Parteien zusammengezählt, und so wie die Summen der Kreuzchen im prozentualen Verhältnis zueinander stehen, bekommen die Parteien auch mehr oder weniger Sitze im Bundestag. Wohlgemerkt: Auch dieses spielt sich nicht auf der Bundesebene, sondern allein auf der Landesebene ab. Liegen in einem Bundesland 20 Wahlbezirke, geht es um 40 Sitze im Bundestag, sind es 30, geht es um 60. Also immer um das Doppelte der Zahl der Wahlbezirke. Kleine Bundesländer mit wenig Wahlberechtigten sind mit wenig Abgeordneten im Bundestag vertreten, große Bundesländer mit vielen Wahlberechtigten auch mit entsprechend mehr Parlamentariern. Die Vertreter des Volkes kommen also nicht irgendwoher, sondern in der Regel direkt aus den Regionen, in denen sie auch zur Wahl stehen.
Und deshalb kommt es hier auch immer wieder zu Überraschungen. Bundesweite politische Karrieren können abrupt enden, wenn die Parteifreunde vor Ort die Bürgerschaft lieber durch einen anderen in Berlin vertreten sehen wollen. In der Abwägung zählen dann auch schon einmal außenpolitische Verdienste weniger als die Verankerung in der eigenen Region. Ein prominentes Beispiel dafür war Stefan Schwarz, der CDU-Abgeordnete, der sich mit großem Engagement und entsprechendem Medien-Echo für die Menschenrechte auf dem Balkan einsetzte und sogar zum Ehrenbürger von Sarajewo ernannt wurde - an der fest eingeplanten Aufstellung als Kandidat für den nächsten Bundestag 1998 zu Hause aber scheiterte.
|
Die Bundestagsabgeordnete Thea Dückert (rechts), Bundesminister Jürgen Trittin und die Landtagsabgeordnete Silke Stokar belegen die ersten drei Plätze der Landesliste von Bündnis 90/Die Grünen in Niedersachsen.
Mit dem Kreuz auf der rechten Hälfte des Stimmzettels entscheidet sich der Wähler nicht nur für eine Partei und bestimmt deren Stärke im Bundestag mit, er votiert auch für eine Rangfolge von landesweiten Vorschlägen dieser Partei, für eine so genannte Landesliste. Das ist daran zu erkennen, dass auf allen Stimmzetteln in diesem Bundesland wenigstens die Namen derjenigen Kandidaten aufgeführt werden, die auf den ersten fünf Positionen stehen. Wie sie dorthin kommen? Durch Landesparteitage oder Landesdelegiertenkonferenzen, auf denen sich ebenfalls alle Anwärter vorstellen, die gerne über diese Listen für den Bundestag kandidieren möchten. Dabei steht es ihnen vollkommen frei, ob sie zugleich auch direkt in einem Wahlkreis kandidieren oder nicht.
Die Aufstellung der Landeslisten ist stets eine hochspannende Angelegenheit. Zumeist hat sich der jeweilige Parteivorstand schon Wochen zuvor damit beschäftigt und für den eigentlichen Parteitag eine grobe Vorschlagsliste vorbereitet. So kann auf Landesebene mitgestaltet werden, wie der neue Bundestag aussehen soll. Manche Parteien haben zum Beispiel feste Regeln oder Empfehlungen zur Platzierung von Frauen: Bei der einen werden sie im Wechsel mit männlichen Kandidaten aufgestellt, bei der anderen sind mindestens die Plätze 1, 3, 5, 7, 9, 11 und so weiter für sie reserviert, bei der dritten Partei soll unter jeweils drei Plätzen mindestens eine Frau vertreten sein.
Es wird darauf geachtet, dass die einzelnen Regionen eines Bundeslandes angemessen berücksichtigt sind, dass vielleicht auch junge Neubewerber eine Chance bekommen, sowohl Kandidaten aus der Wirtschaft wie aus den Gewerkschaften vertreten sind. Wie sie die Liste letztlich zusammenstellen, bleibt allen Parteien selbst überlassen - vor allem den Delegierten auf den Parteitagen, die Platz für Platz das letzte Wort haben. Auch hier kommt es immer wieder zu spektakulären Entscheidungen. Wie etwa in diesem Jahr in Berlin, als bei Bündnis 90 / Die Grünen drei angesehene und bekannte Kandidaten um den noch als „sicher“ geltenden zweiten Listenplatz wetteiferten. Beobachter hatten mit einer knappen Auseinandersetzung zwischen der prominenten Galionsfigur des linken Flügels, Hans-Christian Ströbele, und der früheren Bundesministerin Andrea Fischer gerechnet - doch das Rennen machte der Mitbegründer des „Neuen Forums“, Werner Schulz. Die Basis hat halt ihre eigene Meinung, und die allein zählt - und führte auch in diesem Fall zu spektakulären Schlagzeilen.
Nach Einhaltung von ähnlichen Formalien und Überprüfungen wie bei der Aufstellung der Direktkandidaten wird also auch durch das Entstehen der Landeslisten in diesen Wochen immer klarer, wer am 22. September denn nun konkret zur Wahl stehen wird. Die Druckaufträge für die Stimmzettel können aber noch lange nicht rausgehen. Denn vorher läuft ein Countdown: 58 Tage vor der Wahl entscheiden die jeweiligen Wahlausschüsse über die eingereichten Vorschläge auf Wahlkreis- und Landesebene. Nach der Bekanntgabe gibt es dann drei Tage lang die Möglichkeit zur Beschwerde, über die spätestens 48 Tage vor der Wahl entschieden werden muss. 34 Tage vor der Wahl muss der Bundeswahlleiter erfahren, ob eingereichte Landeslisten zurückgewiesen wurden. Darüber entscheidet er dann wiederum spätes-tens 30 Tage vor der Wahl. Spätestens 26 Tage vor der Wahl wird dieses Ergebnis dann veröffentlicht.
|
Der FDP-Bundesvorsitzende Guido Westerwelle (rechts) und der Landesvorsitzende Jürgen Möllemann nach ihrer Wahl auf die beiden ersten Plätze der nordrhein-westfälischen Landesliste.
Und dann laufen die Druckmaschinen, stellen über 60 Millionen Stimmzettel her, auf denen Tausende verschiedener Namen stehen. Bei der letzten Wahl vor vier Jahren waren es 5.062. Davon traten 1.056 Bewerber nur in einem Wahlkreis an, 2.359 nur auf einer Landesliste und 1.647 sowohl in einem Wahlkreis als auch auf einer Landesliste.
Das bedeutet aber nicht, dass der eine einfach, der andere doppelt gewählt wird. Betrachten wir doch einmal, wie Kreis- und wie Landeswahlvorschläge wechselseitig zum Zuge kommen. Die Wirkung der Erststimme, also des Kreuzchens auf der linken Hälfte, ist ganz einfach: Wer hier die meisten Stimmen bekommt, ist Abgeordneter. Punkt. Ob er nun unter wenigen Kandidaten über 50 Prozent der Stimmen bekam oder unter vielen Bewerbern vor Ort mit 25 Prozent bereits den höchsten Anteil für sich verbuchen konnte - er ist gewählt. Und dieses Mandat geht auch bei allen nun folgenden Berechnungen nicht mehr verloren.
Wie die Kreuzchen auf der rechten Hälfte wirken, ist schon ein wenig komplizierter - aber in sich durchaus schlüssig. Diese Zweitstimmen bestimmen das Kräfteverhältnis im Parlament. Sie werden in jedem Wahllokal ausgezählt, schnellstens an den Kreiswahlleiter übermittelt, der sie an den Landeswahlleiter weiterleitet und dieser dann das Ergebnis an den Bundeswahlleiter.
|
Parteitag der PDS Mecklenburg-Vorpommern, auf dem auch die Landesliste der Partei bestimmt wurde.
Auf diese Weise wird recht schnell klar, welche Parteien in den Bundestag einziehen dürfen. Das sind alle, die bundesweit mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten oder durch die Erststimmen in wenigstens drei Wahlkreisen ihre Kandidaten direkt durchbringen. Die Stimmen der nun übrig gebliebenen Parteien werden in jedem einzelnen Bundesland ins Verhältnis zueinander gesetzt. Und entsprechend ihrem Anteil in Prozent der Zweitstimmen bekommen die Parteien auch den Anteil an den im jeweiligen Bundesland zu vergebenden Sitzen für den Bundestag. Das geht nach einer vorgeschriebenen Formel, die bis in Zahlenbruchteile hinein die Reihenfolge bei der Vergabe der Sitze berücksichtigt. Die schon per Erststimme gewählten Kandidaten zählen dabei mit; erst wenn deren Zahl erschöpft ist, kommt der nächste auf diese Partei entfallende Sitz von der Landesliste. Eine Ausnahme gilt dann, wenn in einem Bundesland eine Partei mit der Erststimme mehr Kandidaten ins Parlament schickt als ihr nach ihrem Anteil an den Zweitstimmen zustehen. Dann entstehen so genannte "Überhangmandate": Das bedeutet, dass aus diesem Bundesland halt mehr Abgeordnete im Bundestag sitzen als eigentlich vorgesehen waren. So kommt es, dass mancher Bundestag geringfügig größer wird, als zunächst theoretisch vorgesehen war.
Alle nicht direkt gewählten Abgeordneten rücken entsprechend ihrer Platzierung auf der Landesliste in den Bundestag ein. Devise: Es zieht von oben weg. Wer schon ein Direktmandat per Erststimme bekommen hat, wird auf der Liste übersprungen, es geht dann um den Nächstplatzierten. Das sorgt in manchen Wahlnächten für Spannung bis zum frühen Morgen. Wenn es knapp wird, wenn man nicht weiß, ob eine Partei nun garantiert im Bundestag vertreten ist oder nicht, wenn es an wenigen Stimmen hängt, an welchen Bewerber ein Direktmandat geht (bei Stimmengleichheit entscheidet obendrein das Los), hat das Auswirkungen auf andere Parteien, auf viele nachfolgende Bewerber: Dann herrscht mitunter die ganze Nacht hindurch Bewegung - Dynamik, die aus der Wahlkabine kommt.
Gregor Mayntz