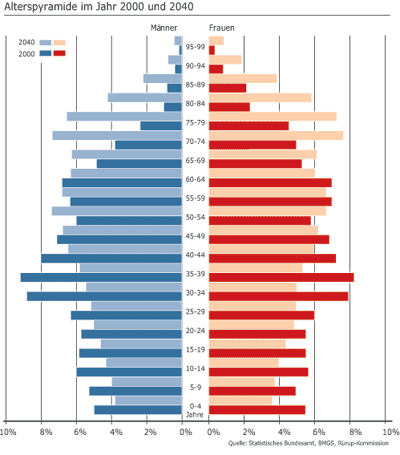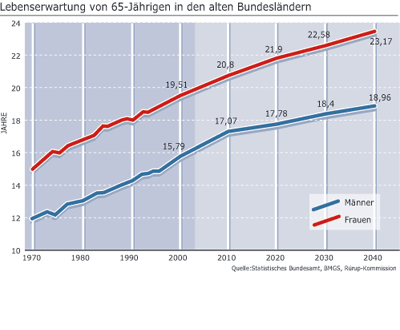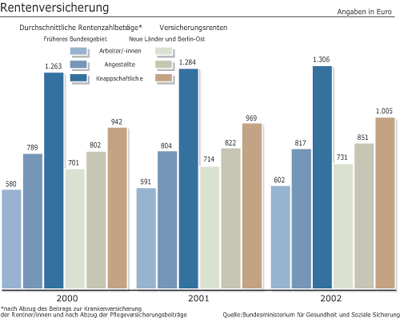Forum: Rentenfinanzen
Massive Eingriffe dringend notwendig
|
Die gesetzliche Rentenversicherung ist einer der Grundpfeiler des deutschen Sozialstaats. Die anhaltende Konjunkturkrise hat erneut deutlich gemacht, dass das System dringend reformiert werden muss. Was in Zeiten des Aufschwungs noch verdeckt war, tritt nun offen zu Tage: Die Rentenversicherung steht vor großen finanziellen Problemen und Herausforderungen. Ohne massive Eingriffe ist die Rente bald nicht mehr bezahlbar. blickpunkt bundestag hat die vier Fraktionen nach ihrem Weg zur Sanierung der Rentenfinanzen gefragt.
Die gesetzliche Rentenversicherung basiert auf dem Umlageverfahren: Die Beiträge der aktiv Beschäftigten werden umgehend den Ruheständlern als Rente ausbezahlt. Rücklagen existieren praktisch nicht. Das Umlageverfahren ist daher auf ein günstiges Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentnern angewiesen. Bei der Einführung 1957 war das noch gewährleistet, denn damals finanzierten fünf Arbeitnehmer einen Rentner. Seitdem hat sich dieses Verhältnis kontinuierlich verschlechtert. Hinzu kommen die Belastungen der Rentenkasse durch versicherungsfremde Leistungen, denen keine Einzahlungen gegenüberstehen. Das gilt zum Beispiel für die Ostrente oder auch für die Anerkennung von Erziehungsjahren.
Maßgeblich verantwortlich für die Probleme sind jedoch die längere Lebenserwartung der Deutschen, die Massenarbeitslosigkeit und die demographische Entwicklung, also der Geburtenrückgang. Die Lebenserwartung stieg seit 1960 um durchschnittlich drei Jahre, bei Frauen sogar um 4,5 Jahre. Bis 2030 kommen noch einmal mindestens drei Jahre hinzu. Was eigentlich eine positive Nachricht ist, wird für die Rentenversicherung zum Problem. Denn der Zeitraum, in der ein Mensch Rente bezieht, wird sich bis 2030 verdoppeln. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Erwerbstätigen, also der Beitragszahler. Heute beträgt der Beitragssatz 19,5 Prozent des Bruttoeinkommens. Den Beitrag teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
|
|||||||||
| Alterspyramide im Jahr 2000 und 2040. |
Allen Parteien im Bundestag ist klar, dass es zu einem deutlichen Anstieg der Beiträge der gesetzlichen Rentenversicherung nicht kommen darf. Bereits 1997 hatte die Bundesregierung unter Helmut Kohl (CDU) daher einen „demographischen Faktor“ eingeführt, der den jährlichen Rentenanstieg, der sich an der Lohnentwicklung orientiert, dämpfen sollte. Damit wollte die Regierung dem veränderten Verhältnis von Beitragszahlern und Rentnern Rechnung tragen. Die Korrektur wurde jedoch von der rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder (SPD) rückgängig gemacht – ein Fehler, wie Schröder inzwischen eingeräumt hat. Unter Federführung des damaligen Arbeitsministers Walter Riester (SPD) wurde dagegen der Aufbau einer staatlich geförderten privaten Altersvorsorge begonnen, bekannt unter dem Namen „Riester-Rente“. Damit wurde erstmals das Prinzip der Finanzierung verlassen, wonach Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Kosten jeweils zur Hälfte tragen.
Das reichte jedoch nicht für eine Stabilisierung der Rentenfinanzen, wie sich nach drei Jahren ohne Wirtschaftswachstum herausstellte. Deshalb setzte die Regierung Ende 2002 eine Kommission unter Führung des Ökonomen Bert Rürup ein, die Vorschläge für eine langfristige Sicherung des Rentensystems ausarbeiten sollte.
Rürup schlägt zum einen die Einführung eines „Nachhaltigkeitsfaktors“ vor, der wie der Demographiefaktor die jährliche Rentenanpassung begrenzt. Zugleich soll das Renteneintrittsalter von jetzt 65 Jahren zwischen 2011 und 2034 schrittweise auf 67 Jahre angehoben werden. Damit wollen die Experten den Beitragssatz bis 2030 unter 22 Prozent halten.
|
|||||||||
| Lebenserwartung von 65-Jährigen in den alten Bundesländern. |
Die CDU hat unter Leitung des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog eine eigene Kommission gebildet. Sie kommt zu ähnlichen Ergebnissen wie die Wissenschaftler um Rürup. Auch die CDU-Experten sehen die Lösung der Probleme in einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Die volle Rente soll es nach Ansicht der Herzog-Kommission ab dem Alter von 63 Jahren geben, aber nur, wenn der Versicherte 45 Jahre lang Beiträge gezahlt hat. Ansonsten gilt die Rente mit 67. Zudem soll der Rentenanstieg ähnlich wie bei Rürup gebremst werden. Darüber hinaus will die Herzog-Kommission Familien fördern, indem die Zahl der angerechneten Erziehungsjahre von drei auf sechs verdoppelt wird. Zur Gegenfinanzierung sollen die Witwenrenten massiv beschnitten werden. Das Konzept ist jedoch nicht nur in der Schwesterpartei CSU auf Kritik gestoßen. Auch in den eigenen Reihen ist es umstritten.
Auf Regierungsseite setzte sich Sozialministerin Ulla Schmidt (SPD) dafür ein, die Rürup-Vorschläge zu übernehmen. Auf einer Rentenklausur des Bundeskabinetts Mitte Oktober wurde jedoch beschlossen, die Frage des höheren Rentenalters vorerst zurückzustellen. Eine Entscheidung soll erst im Jahre 2010 getroffen werden. Zunächst will Rot-Grün dafür sorgen, dass das tatsächliche dem gesetzlichen Renteneintrittsalter angenähert wird. So gehen heute Männer durchschnittlich mit 59,9 Jahren und Frauen mit 60,5 Jahren in Rente. Ursache sind die großzügigen Frühverrentungsregelungen. „Es kann nicht sein, dass die Unternehmen ihre Personalprobleme auf Kosten der Sozialkassen lösen“, mahnt Ministerin Schmidt immer wieder.
|
||||||||||
So schnell wie möglich will die Bundesregierung aber den Nachhaltigkeitsfaktor umsetzen. Nach Berechnungen der Kommission bewirkt er, dass im Jahre 2030 die ausgezahlte Rente um rund 80 Euro im Monat geringer ausfallen wird als ohne Dämpfung. Zusätzlich plant die Bundesregierung Kürzungen für Schüler von weiterführenden Schulen und für Akademiker. So sollen die bisher für die Schul-, Fachhochschul- und Hochschulausbildung angerechneten drei Beitragsjahre zur Gänze entfallen. Für die Betroffenen bedeutet das nach Angaben des Sozialministeriums einen Verlust von weiteren fast 60 Euro im Monat.
|
|||||||||
| Rentenversicherung. |
Die Maßnahmen wirken sich aber nur langfristig aus. Es besteht jedoch rascher Handlungsbedarf, da in der Rentenversicherung bereits jetzt ein Finanzloch von rund acht Milliarden Euro klafft. Würde die Regierung nicht eingreifen, müsste der Beitragssatz 2004 auf 20,3 Prozent steigen. Erklärtes Ziel der rot-grünen Regierung ist es jedoch, die Lohnnebenkosten stabil zu halten. Daher sollen mehrere Notmaßnahmen umgesetzt werden, die weitgehend zu Lasten der jetzigen Rentner gehen. Sie müssen im kommenden Jahr auf eine Erhöhung der Renten verzichten. Zudem wird der Beitrag zur Pflegeversicherung erhöht. Trugen die Rentner bisher die Hälfte des Versicherungsbeitrags von 1,7 Prozent, müssen sie ab 1. April 2004 den gesamten Satz zahlen. Damit wird es im kommenden Jahr zu einer faktischen Rentenkürzung kommen.
Zugleich plant die Regierung, die so genannte Schwankungsreserve der Rentenversicherung zu reduzieren. Derzeit ist vorgeschrieben, dass dieser „Notgroschen“ mindestens die Höhe einer halben Monatsausgabe, also etwa acht Milliarden Euro, haben muss. Künftig wird der Notgroschen auf 0,2 Monatsausgaben gesenkt. Für Neurentner soll schließlich die erste Rente nicht mehr am Monatsanfang, sondern am Monatsende ausgezahlt werden. Auch diese Korrektur entlastet die Rentenversicherung. Unter der Voraussetzung, dass die wirtschaftlichen Annahmen der Bundesregierung für 2004 nicht zu optimistisch sind, kann durch die Notoperation die entstandene Finanzlücke gedeckt und ein stabiler Beitragssatz für das kommende Jahr erreicht werden. Zwar will die CDU/CSU-Fraktion die Einschnitte nicht mittragen. Der von CDU/CSU dominierte Bundesrat hat außer bei der Verschiebung des Auszahlungstermins der Rente aber keine Möglichkeit, die Vorhaben der Regierung zu stoppen.
Timot Szent-Ivanyi
|
||||||||||
Vertrauen
erhalten
Gudrun Schaich-Walch, SPD
gudrun.schaich-walch@bundestag.de
www.gudrun-schaich-walch.de
Die Situation der Rentenversicherung ist ernst. Um ihre Akzeptanz und das Vertrauen der Beitragszahler zu erhalten, müssen jetzt die notwendigen Entscheidungen getroffen werden. Hierbei gilt es, zwei Ebenen zu unterscheiden:
Zum einen ist dies die aktuelle Finanzkrise der Rentenversicherung. Als umlagefinanzierte Sozialversicherung ist sie darauf angewiesen, dass ausreichend viele Beschäftigte einzahlen. Auf Grund der konjunkturellen Situation sind die Einnahmen in diesem Jahr aber nicht wie erwartet um 2,5 Prozent gestiegen, sondern nur um 0,5 Prozent. Da auch die Wachstumsprognosen für das nächste Jahr nach unten korrigiert werden mussten, hätte der Beitragssatz von 19,5 Prozent auf 20,5 Prozent ansteigen müssen. Um ein klares Signal für Wachstum und Beschäftigung zu setzen, werden wir den Beitragssatz stabil halten. Dies geht nur um den Preis von Einschnitten zu Lasten der Rentner. So wird es im nächsten Jahr keine Rentenanpassung geben, und die Rentner werden in Zukunft den vollen Beitrag zur Pflegeversicherung selbst entrichten müssen.
Auf der zweiten Ebene geht es um die langfristige Perspektive, da die steigende Lebenserwartung und das sich verschlechternde Zahlenverhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern die Rentenversicherung vor große Herausforderungen stellen. Der demographische Wandel ist dabei kein Schicksal, denn seine Rahmenbedingungen können heute durch kluge Politik gestaltet werden. So verliert der zukünftige Rückgang an Personen im erwerbsfähigen Alter erkennbar an Schrecken, wenn es gelingt, die Erwerbsbeteiligung der älteren Arbeitnehmer und die Erwerbsquote der Frauen deutlich zu verbessern.
Trotz dieser Maßnahmen wird es notwendig sein, auch die langfristigen Ausgaben der Rentenversicherung zu begrenzen. Hierzu dient zum Beispiel die Berücksichtigung der Relation von Beitragszahlern zu Rentnern in der Anpassungsformel.
|
||||||||||
Neubeginn
erforderlich
Andreas Storm, CDU/CSU
andreas.storm@bundestag.de
www.andreasstorm.de
Die Bundesregierung hat durch ihre verfehlte Wirtschafts- und Finanzpolitik in den vergangenen fünf Jahren die gesetzliche Rentenversicherung in die größte Finanzkrise in der Geschichte der Bundesrepublik geführt. Die vorgesehenen Notoperationen zur Stabilisierung des Rentenbeitrages 2004 belasten einseitig die Rentner und sind für die CDU/CSU nicht akzeptabel.
Erforderlich ist ein grundlegender rentenpolitischer Neubeginn. Maßstab hierfür muss es sein, dass die Beitragsbelastung der jungen Generation für die gesetzliche Rente auch langfristig nicht wesentlich höher ist als derzeit. Dazu müssen die sich aus der viel zu hohen Arbeitslosigkeit und der Verschiebung der Altersstruktur ergebenden Lasten der Rentenfinanzen durch die Einführung eines erweiterten Demographiefaktors oder eines Nachhaltigkeitsfaktors in die Rentenformel gerecht auf Rentner und Beitragszahler aufgeteilt werden.
Daneben ist es ebenso wichtig, dass umgehend der Einstieg in eine funktionierende kapitalgedeckte Alterssicherung gelingt. Nur eine Kombination der im Umlageverfahren finanzierten gesetzlichen Rente mit einer kapitalgedeckten betrieblichen und privaten Altersvorsorge ist in der Lage, den Menschen im Alter eine Lebensstandardsicherung zu gewährleisten. Die viel zu komplizierte Riester-Rente muss durch eine echte Förderrente mit einer wesentlich breiteren Palette attraktiver Altersvorsorgeprodukte abgelöst werden.
Nur durch eine konzeptionell schlüssige Verzahnung der Reform der gesetzlichen Rentenversicherung mit der Nachfolgeregelung für die Riester-Rente und der Neuregelung der Rentenbesteuerung kann das verloren gegangene Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Alterssicherungspolitik zurückgewonnen werden. Die Weichenstellungen hierzu müssen spätestens im nächsten Jahr erfolgen.
|
||||||||||
Beiträge
stabilisieren
Biggi Bender, Bündnis 90/Die Grünen
birgitt.bender@bundestag.de
www.biggi-bender.de
Die Altersvorsorge muss langfristig verlässlich sein und einen fairen Ausgleich zwischen der jungen und der älteren Generation schaffen. Die Rentner haben durch ihre Lebensarbeit einen berechtigten Anspruch auf eine angemessene Altersversorgung erworben und müssen auch in Zukunft an der Entwicklung des Wohlstandes teilhaben. Aber auch die Belastungen durch Beiträge dürfen nicht ständig steigen.
Die Rentenreform 2001 war ein wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigen Finanzierung der Rentenversicherung. Sie war dem Grundsatz verpflichtet, auch die Interessen der Beschäftigten zu wahren. Wir haben den demographischen Faktor durch die Rentenreform 2001 ersetzt: Die finanziellen Probleme der Rentenversicherung wären heute sonst noch größer.
Nach den aktuellen Erkenntnissen über die wirtschaftliche und demographische Entwicklung muss die Bundesregierung neue Maßnahmen ergreifen, um die Beiträge zu stabilisieren. Ein Nachhaltigkeitsfaktor wird dafür sorgen, dass das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern in Zukunft berücksichtigt wird. Auch heute gilt: Der Nachhaltigkeitsfaktor kann die Rentenversicherung besser schützen als der demographische Faktor, da er neben der Entwicklung der Lebenserwartung auch die Entwicklung der Geburtenrate, der Zuwanderung und des Erwerbsverhaltens berücksichtigt.
Kurzfristig müssen wir das faktische Renteneintrittsalter anheben. Dies kann die Rentenversicherung aber nicht dauerhaft entlasten. Die Diskussion um die Anhebung des gesetzlichen Rentenalters sollte deshalb in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Die Koalition wird zudem die ergänzende Vorsorge weiter stärken. Wir werden die Riester-Rente einfacher und flexibler gestalten. Arbeitnehmer sollen zudem das Recht erhalten, beim alten Arbeitgeber erworbenes Kapital in die Einrichtung der betrieblichen Altersvorsorge des neuen Arbeitgebers mitzunehmen.
|
||||||||||
Vertrauen
zurückgewinnen
Heinrich Leonhard Kolb, FDP
heinrich.kolb@bundestag.de
www.heinrich-kolb.de
Zunächst muss die Politik ehrlich sagen, wohin die Reise gehen soll. Nur so wird verloren gegangenes Vertrauen zurückgewonnen. Durch kurzfristig wirksame Maßnahmen müssen wir die akuten Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung lösen. Dazu muss nach Auffassung der FDP die Frühverrentung beendet werden. Wir fordern daher die unverzügliche Beendigung der Frühverrentung sowie des Altersteilzeitgesetzes – unter Wahrung des Bestandschutzes. Auch die Verbesserung der Arbeitsmarktchancen älterer Arbeitnehmer muss auf die Agenda. So sollten beispielsweise die Senioritätsprivilegien überprüft werden.
Langfristig brauchen wir den Systemwechsel, um den Herausforderungen der demographischen Entwicklung wirksam zu begegnen. Im Mittelpunkt dieses Systemwechsels muss der Ausbau der privaten, kapitalgedeckten Vorsorge stehen, die nach einer Übergangsphase zusammen mit der betrieblichen Altersvorsorge etwa die Hälfte der Alterssicherung tragen soll. Durch massive Steuersenkungen erhalten die Bürger die finanziellen Freiräume zur Vorsorge. Flankierend werden private und betriebliche Altersvorsorge im Rahmen eines individuellen Altersvorsorgekontos verknüpft.
Schließlich müssen eine bessere Nutzung der Lebensarbeitszeit und eine Erhöhung der Frauenerwerbsquote angestrebt werden. Statt der Rente mit 67 soll durch eine kürzere und effizientere Ausbildung ein früherer Einstieg ins Berufsleben möglich werden. Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird die Frauenerwerbsquote steigern. Priorität wird dabei die Möglichkeit bedarfsgerechter Kinderbetreuung ab Geburt haben.
Die dauerhafte Sicherung für ältere Menschen werden wir jedoch am ehesten durch eine Politik erreichen, die nachhaltiges Wirtschaftswachstum sichert; denn ohne dieses ist dauerhaft kein soziales Sicherungssystem möglich.