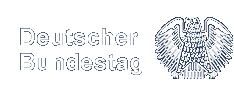DEUTSCHER BUNDESTAG
Ausschuss für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft
14. Wahlperiode
22 38-24 50
Wortprotokoll
der
81. Sitzung
des Ausschusses für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft
(10. Ausschuss)
Öffentliche Anhörung
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung
Drucksache 14/7252
-Entwurf eines Gesetzes zur Modulation
von Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (Modulationsgesetz)-
am Montag, 10. Dezember 2001, 11.00 Uhr
(Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.900)
Vorsitz: Peter Harry Carstensen (Nordstrand), MdB
SEITE:
Einziger Punkt der Tagesordnung 8 - 130
-Entwurf eines Gesetzes zur Modulation von
Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen
Agrarpolitik (Modulationsgesetz)-
Drucksache 14/7252
Anlage 1 Naturschutzbund Deutschland e. V., Dr. Volkhard
Wille
Anlage 2 Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft,
Prof. Werner Kleinhanß
Anlage 3 Ministerium f. Ernährung u. ländl. Raum
Baden Württemberg,
MDg Joachim Hauck
Anlage 4 Ralf Hägele, Vorstandsvorsitzender
Agrarunternehmen Barnstädt e. G.
Anlage 5 Deutscher Bauernverband
Anlage 6 Ministerium f.Umwelt u.Naturschutz, Landwirtschaft
u. Verbraucherschutz Sts Dr. Thomas Griese
Anlage 7 Botschaft des Vereinigten Königreichs GB u.
Nordirland,
Landwirtschaftsattaché Gerrit Steel
Anlage 8 European Federation of trade unions of food,
agriculture and tourism
(EFFAT) Secr. Agri Arnd Spahn
ZUR TAGESORDNUNG
Der Vorsitzende: Ich eröffne die 81. Sitzung
des Ausschusses für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft zur öffentlichen Anhörung zu dem
Gesetzentwurf der Bundesregierung -Entwurf eines Gesetzes zur
Modulation zu Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen
Agrarpolitik- (Drucksache 14/7252).
Ich begrüße ganz herzlich den PSt Dr. Thalheim, die
Mitglieder unseres Ausschusses sowie weitere interessierte
Gäste, insbesondere aber die Herren Sachverständige in
unserer Mitte und zwar,
Von den Verbänden:
- Stellv. Generalsekretär Adalbert Kienle und Referent Udo
Hemmerling,
Deutscher Bauernverband (DBV);
- Dr. Volkhard Wille,
Naturschutzbund, Deutschland e. V. (NABU),
- Secr. Agri. Arnd Spahn,
European Federation of Food, Agriculture and Tourism (EFFAT)
Als Einzelsachverständige:
- Direktor und Prof. Werner Kleinhanß,
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL)
- Landwirtschaftsattaché Gerrit Steel,
Botschaft des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
Nordirland
- MDg Manfred Buchta,
Abteilungsleiter Grundsatz im Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes
Rheinland-Pfalz
- Ralf Hägele,
Vorstandsvorsitzender des Agrarunternehmens Barnstädt e.
G.
- St Dr. Thomas Griese,
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz aus Nordrhein-Westfalen
- Stellv. Abteilungsleiter Dr. Breitbarth
- und Prof. Breitschuh,
Präsident der Thüringer Landesanstalt für
Landwirtschaft, Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz
und Umwelt des Freistaates Thüringen
- MDg Joachim Hauck,
Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum aus
Baden-Württemberg.
Ich möchte mich für die kurzfristige Terminanberaumung
entschuldigen. Ich hätte Ihnen etwas mehr Zeit gegönnt
und wäre auch froh gewesen, wenn diejenigen aus dem Ausschuss,
die diesen Termin beantragt haben, heute hier anwesend
wären.
Die Modulation ist ein sehr wichtiges Thema.
Ich möchte nunmehr die Sachverständigen bitten, mit einem
kurzen Statement zu beginnen, um im Anschluss daran in die Frage-
und Antwortrunden einzutreten.
Adalbert Kienle (DBV): Ich habe trotz der
Pisa-Studie meine Lateinlektion gelernt. Zwei Dinge sind mir
besonders gut in Erinnerung: ?Et respice fine? (Bedenke das Ende)?
und ?Quod errat demonstrandum? (was zu beweisen war).? Mit diesen
beiden lateinischen Sprüchen möchte ich behaupten, dass
die Modulation ein Instrument ist, das nicht friedensfähig
ist. Es wird mit sehr viel Begeisterung über die Modulation
gesprochen. Wenn es aber um die Umsetzung geht, wird es sehr
schwierig. Es fehlt eine tiefgreifende Analyse, was in der Zukunft
geschieht und wie die Betriebe und die landwirtschaftlichen
Räume und Regionen bei uns und in Europa aussehen
werden.
Ich habe kürzlich als Mitglied des Wirtschafts- und
Sozialausschusses an einer Anhörung des Europäischen
Parlaments teilgenommen. Aus einer Studie des Parlamentes habe ich
entnommen, wie die Positionen in Europa in den verschiedenen
Mitgliedstaaten aussehen. Nach wie vor besteht überwiegend
Ablehnung. Die meisten Länder sagen, dass es neue
Wettbewerbsverzerrungen geben wird. Es wird zu Einkommensverlusten
unserer Bauern kommen. In der neuen TOP-Agrarausgabe findet man
eine repräsentative Umfrage unter deutschen Landwirten. Die
Berufsunlust und die Investitionsverweigerungen der Bauern sind
begründet in der Auflagenflut und der viel zu großen
Bürokratie. Die Modulation beinhaltet sehr viel
Bürokratie, Streit und ungewisse Konsequenzen.
Länder wie Baden-Württemberg und Bayern, die in den
letzten Jahren sehr viele Umweltmaßnahmen vorangetrieben
haben, werden mit der Modulation regelrecht abgestraft. Der DBV
sieht in der Modulation kein agrarpolitisches Heilmittel. Nach
ausführlicher Diskussion haben wir eine grundsätzliche
Ablehnung der Modulation beschlossen. Wir verweisen auf die dichte
Zahl der Fachgesetze, auf die Agrarumweltmaßnahmen und auf
die Gemeinschaftsaufgabe, die in hohem Maße dem
ländlichen Raum zugute kommt.
Wenn die Politik die Modulation durchsetzt, dann ist unsere
Forderung, die sog. Kleinbeihilfen für Saatgut,
Stärkekartoffeln, Tabak und Hopfen herauszunehmen. Angesichts
der dramatischen Lage bei spezialisierten Rindererzeugern sollten
Tierprämien ausgeklammert werden. Wir fordern eine
Freibetragsregelung ohne jeglichen bürokratischen Mehraufwand
für die Landwirte. Wir setzen uns für eine erzeugernahe
Wiederverwendung in den Regionen ein.
Dr. Volkhard Wille, (NABU): (Anlage 1)
Arnd Spahn, (EFFAT): Ich verstehe die Position des
DBV nicht und vertrete eine andere Meinung. Wir wollen eine
Erhöhung der Agrartöpfe. Wir sehen darin einen neuen
Ansatzpunkt und fördern ihn. Es ist sinnvoll, in einer
Situation, die geprägt ist von Unsicherheit, neue Wege zu
gehen. Die Modulation stößt in den Ländern, in
denen sie angewendet wird, auf immer breitere Zustimmung, z. B. in
Frankreich. Der hier anwesende französische
Agrarattachè könnte vielleicht über die
Modulation, die in seinem Land bereits angewendet wird, berichten.
Frankreich verfügt über erste Erfahrungen.
Auch in den anderen Mitgliedstaaten trifft dieses Modell der
Modulation auf immer mehr Zustimmung. Die Modulation ist ein
kohärentes, fachübergreifendes Mittel zur Reform der
Agrarpolitik und zur Entwicklung einer neuen Lebensmittelpolitik in
Europa. Man sollte sich die Frage stellen, ob man sich diesem
Modell in Europa zuwenden sollte, um herauszufinden, ob man neue
Wege beschreiten kann.
Über den Erfolg der Modulation kann heute gewiss keiner
sichere Prognosen wagen. Aber die vorgetragenen Widerstände
spiegeln nicht die Meinung der Betriebe wider.
Wir befürworten eine frühzeitige und umfassende
Einführung des Instrumentes der Modulation. Die Modulation ist
ein notwendiges Instrument, um neue Wege zu beschreiten.
Wir fordern für die Einführung der obligatorischen
Modulation die Aufnahme der Punkte 8 und 9 aus der Verordnung 1257
in die Verordnung 1259, wenn man die Modulation zu einem
schlagkräftigen Instrument der Entwicklung des ländlichen
Raumes gestalten will.
Prof. Werner Kleinhanß, (FAL): Die
Modulation ist ein Instrument zur Umlenkung von Finanzmitteln von
der Ersten in die Zweite Säule. Diesem ist grundsätzlich
zuzustimmen. Allerdings lässt die Modulation den
Mitgliedsländern sehr viele Gestaltungsspielräume, sowohl
in der Frage, ob sie die Modulation umsetzen, als auch in der
Gestaltung der Maßnahmen.
Die Wirkung der Modulation hängt u. a. von der Art und von dem
Umfang der Prämienkürzungen ab. Je nach Ausgestaltung der
Kürzungen sind entsprechende Einkommens- und
Verteilungseffekte zu erwarten. Bei länderspezifischer
Einführung von Kürzungen bis zu 20 % kann es zu
Wettbewerbsverzerrungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten
kommen.
Ich habe mich seit dem letzten Jahr mit der Modulation durch eine
vergleichende Analyse des französischen Systems und der
möglichen Anwendung in Deutschland zusammen mit
französischen Kollegen befasst. Die Ergebnisse unserer
Modellrechnungen auf Basis des nationalen Betriebsnetzes sind zum
Teil in die Beantwortung der Fragen mit eingegangen. Sie zeigen die
vielfältigen Wirkungen andeutungsweise auf.
Der Grad der Betroffenheit und die Höhe der Verteilung von
Prämienkürzungen hängt in Deutschland sehr stark von
dem Freibetrag ab. Es gibt unterschiedliche Positionen in den neuen
und alten Bundesländern. Aus ökonomischer Sicht sehe ich
die Verwendung im Bundesland etwas kritisch, weil sie nicht die
optimale Lösung in Bezug auf regionalpolitische
Umweltmaßnahmen ist. Eine Zunahme der Regelungsdichte durch
Länderprogramme ist zu erwarten.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist zu bemängeln, dass die
Modulation keine große Lenkungswirkung hat. Es wird einfach
nur gekürzt und dies führt zu Einkommenseinbußen.
Die Lenkungswirkung erfolgt mehr auf der Verwendungsseite. Aus
betriebswirtschaftlicher Sicht wäre zu wünschen, dass man
das Instrument so ausgestaltet, dass es klare Signale hinsichtlich
betrieblicher Anpassung gibt.
Aus deutscher Sicht muss man die Nettozahlerposition beachten. Die
Modulation ist ein Instrument für die Nettoempfänger.
Für die Nettozahler in Deutschland wären allgemeine
Prämienkürzungen, die Freiraum für nationale Mittel
schafften und für agrar- und umweltpolitische Maßnahmen
eingesetzt werden könnten, günstiger.
Gerrit Steel: Ich bin Ihnen, Herr Vorsitzender,
dankbar, vor Ihrem Ausschuss sprechen zu können. Während
meiner Zeit als Erster Sekretär an der britischen Botschaft in
Deutschland hatte ich immer wieder Grund, Ihnen dankbar zu sein
für vieles, was ich über Aspekte der deutschen
Landwirtschaft und Agrarpolitik gelernt habe. Ich hoffe, dass ich
mich ein wenig revanchieren kann, indem ich dem Ausschuss Fragen
zur Modulation in Großbritannien beantworte.
Sie haben von mir einige Antworten auf die Fragen in Ihrem
Fragenkatalog bekommen. Ich bitte um Rücksicht, dass ich keine
Antworten zum Thema Modulation in Deutschland gegeben habe. Als
Gast in Deutschland habe ich in dieser Beziehung nichts zu
sagen.
In der Agrarpolitik wird Großbritannien manchmal als Land
hingestellt, das die menschliche Dimension nicht zu würdigen
weiß. Wir gelten als Volk, das sagt: ?Es geht nur um die
Wirtschaft. Und wenn wir ein paar schöne Landschaften oder ein
paar herkömmliche Arbeitsplätze verlieren, ist uns das
ziemlich egal. Wenn wir die Lebensmittel und die Natur nicht so wie
früher genießen können, ist das nicht weiter
schlimm, solange die Wirtschaft boomt.?
Diese Charakterisierung war nie zutreffend, und ich glaube, die
jüngste Umstrukturierung in unseren Ministerien nach den
letzten Wahlen unterstreicht, wie anders unsere Beweggründe in
Wirklichkeit sind. Das alte Ministerium für Landwirtschaft,
Fischerei und Ernährung existiert nicht mehr. Stattdessen
haben wir jetzt ein Ministerium für Umwelt, Ernährung und
ländliche Angelegenheiten, das Departement for environment,
fruit and rural affairs (DEFRA).
Wer die Zukunftsvision der Ministerin Margaret Beckett liest (unter
www.defra.gov.uk), wird bemerken, dass es sich um eine
Vision handelt, in der von ländlichen Gemeinschaften die Rede
ist, die ökonomisch und ökologisch lebensfähig sind
und die nicht auf produktionsabhängige Subventionen angewiesen
sind, um unbedenkliche, nahrhafte Lebensmittel zu produzieren. Der
letzte Satz dieser Vision lautet: ?Die Förderung der
nachhaltigen Entwicklung - ökologisch, ökonomisch und
sozial - ist eine Voraussetzung, um diese Vision zu
realisieren.?
Das Motto ?Nachhaltigkeit? ist sicherlich auch eine der Grundlagen
der sog. ?PolicyCommission?, die die Strategie für die
Landwirtschaft bis Anfang nächsten Jahres einer detaillierten
Prüfung unterziehen soll. Zur selben Zeit ist es völlig
klar, dass eine weitere Reform der Gemeinsamen Agrarapolitik (GAP)
für Großbritannien ein bedeutendes Ziel bleibt, auch aus
rein volkswirtschaftlichen Gründen. Die GAP oder das alte
Instrumentarium der GAP wird ihrer Aufgabe nicht gerecht, auch aus
volkswirtschaftlichen Gründen, aber nicht nur deshalb. Die GAP
als altes Modell ist nicht nachhaltig. Die Landwirtschaft muss der
Nachhaltigkeitsagenda Rechnung tragen, indem sie den Wohlstand an
Verantwortlichkeiten im Bereich Umwelt, Tierschutz usw.
knüpft.
Vor diesem Hintergrund ist die Modulation eine politische
Priorität des DEFRA und der britischen Regierung. Wir
betrachten sie als Paradebeispiel für unser Engagement
für eine Reform der GAP im Sinne einer nachhaltigen
Landwirtschaft, und zwar durch Umschichtung der Finanzmittel aus
der Ersten in die Zweite Säule. Von der Möglichkeit,
bestimmte Betriebsklassen zu bevorzugen durch Freibeträge oder
gestaffelte Reduktionen, wird in Großbritannien nicht
Gebrauch gemacht. Wenn die GAP unerwünschte Wirkungen hat, in
denen nicht nachhaltige Betriebs- und Produktionsformen
gefördert werden, dann finden wir es besser, diese Aspekte der
GAP zu korrigieren, als zusätzliche Komplikationen und
Diskriminierungen einzuführen.
Aber warum verzichten wir auf die Chance, eine
sozio-ökonomische Komponente einzuführen? Es liegt nicht
daran, dass wir keine sozio-ökonomischen Ziele haben, sondern
wir sehen Vorteile in einem einfachen System. Ein solches System
ist leicht zu verstehen für die Landwirte, aber auch für
die Verwaltung. Die Zusammenführung aller Daten für die
Prämienzahlungen je Betrieb ist bei diesem System nicht
nötig. Niemand kann sagen, er sei diskriminiert worden. Man
kann Modulation nicht vermeiden, indem man seinen Betrieb
umstrukturiert. Die Landwirte fordern Vereinfachungen.
Wir halten die Modulation für wichtig und gut, aber nur
begrenzt einsetzbar als Instrument zur Umschichtung von Zahlungen.
Auf lange Sicht ist die Modulation keine Lösung des
Grundproblems der Gemeinsamen Agrarpolitik. Wir denken, wir
brauchen die zeitliche Degressivität, um den GAP-Haushalt
insgesamt zu verringern und zusätzliche Mittel für die
Zweite Säule freizusetzen.
MDg Manfred Buchta: Rheinland-Pfalz hat in der
Kürze der Zeit keine schriftliche Stellungnahme abgeben
können. Deshalb will ich unsere Grundpositionen jetzt kurz
darlegen.
Das Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium in Mainz ist
skeptisch bis ablehnend gegenüber der Modulation. Wir haben
dafür verschiedene Gründe.
Bei der Frage der Modulation müssen auch Gesichtspunkte des
Vertrauens in die Agrarpolitik berücksichtigt werden. Anfang
der 90er Jahre sind den Landwirten Flächen- und
Tierprämien für nicht erzielbare Markterlöse gegeben
worden. Bei unveränderten Markterlösen muss die Frage
erlaubt sein, wie man dann den Landwirten das Geld wegnimmt.
Wir sehen auch das Problem der Zeitschiene. Wir halten es für
falsch, kurz vor der Zwischenbilanz der EU eine Modulation
einzuführen. Es wird zeitlich so ablaufen, dass zwar die
Modulationsgelder vor der Zwischenbilanz eingezogen werden, aber
die ersten Gelder erst nach der Zwischenbilanz ausgegeben werden
können, also zu einem Zeitpunkt, in dem bereits auf EU-Ebene
wahrscheinlich über eine völlig andere und neue
Modulation diskutiert wird.
Die Administration der Modulation und das Vertrauen in die
Agrarpolitik sind unsere Gründe, warum wir skeptisch bis
ablehnend waren. Wir haben dann aber in dem
A-Länder-Kompromiss mitgestimmt, weil in allen Diskussionen
auf Bund-Länder-Ebene immer das Damoklesschwert, des nicht
zustimmungspflichtigen Bundesgesetzes diskutiert wurde. Unseres
Erachtens war es sinnvoller, mitzudiskutieren, als immer nur
dagegen zu sein. Wir haben dann einen Freibetrag gefordert, der
höher ist als der, der jetzt diskutiert wird. Wir halten es
immer noch für richtig, eine Modulation mit Freibetrag
einzuführen. In den Diskussionen und in den
Verordnungsvorschlägen zu den Freibeträgen ist sehr viel
komplizierter geworden. Ich möchte mich ausdrücklich dem
Bauernverband anschließen, der ebenfalls herausgestellt hat,
dass man die kleinen Beihilfen herausnehmen sollte. Rheinland-Pfalz
hatte in diesem Zusammenhang einen Antrag eingebracht, den
Freibetrag pro Zahlstelle zu gewähren.
Wir haben bei der Modulation auch das Problem, dass die
Länder, die schon viel für ihre Umwelt und für
umweltschonende Bewirtschaftungsweisen getan haben, jetzt sozusagen
abgestraft werden, weil z. B. jenseits der Programme, die in
Rheinland-Pfalz laufen, kaum noch Umweltprogramme denkbar sind. Wir
haben ein Förderungsprogramm ?Umweltschonende Landwirtschaft?,
in dem jährlich 50 Mio. DM in Rheinland-Pfalz umgesetzt
werden. Das ist für ein bescheidenes Land wie Rheinland-Pfalz
eine große Menge. Die Landwirte können zwischen 30
Programmvarianten wählen. Modulationsgelder werden aber nur
für neue Maßnahmen und auch nur für neue
Begünstigte eingesetzt. Das macht große Probleme.
Wir sind an sich gegen Modulation, haben uns dann aber
entschlossen, bei einem Freibetrag mitzumachen. Wir halten eine
Freibetragsregelung, die einigermaßen administrierbar ist,
für machbar. Wir würden es begrüßen, wenn der
Freibetrag erhöht würde. Wir hatten derzeit 20.000 Euro
pro Betrieb und Jahr gefordert.
Ralf Hägele: (Anlage 2)
MDg Joachim Hauck: Grundsätzlich
befürworten wir die Modulation, aber nicht zum vorgesehenen
Zeitpunkt, also nicht vor dem mid-term review und nicht in der
vorgesehenen Form. Modulation sollten wir als das betrachten, was
es ist. Modulation ist ein Instrument, mit dem wir nur sehr
begrenzt Mittel von der Ersten in die Zweite Säule umschichten
können. Dies hängt u. a. damit zusammen, dass wir bereits
heute in Deutschland große Probleme haben mit der
Kofinanzierung der EU-Mittel. Im Jahre 2000 haben die
Bundesländer 50 Mio. DM in der Zweiten Säule nicht
ausgeschöpft. Im Jahre 2001 wird es eine ähnliche
Größenordnung sein. Die Situation wäre noch
schlechter, wenn nicht einige Bundesländer ihr Soll
übererfüllt hätten. Für unsere
Nettozahlerposition bedeutet dies, dass mit der Modulation das
Risiko besteht, dass sie noch weiter verschlechtert wird. Es ist
nicht davon auszugehen, dass die Bundesländer, die bisher
nicht fähig oder nicht bereit zur Kofinanzierung von
EU-Mitteln waren, diese Haltung im Rahmen der Modulation
verstärken werden. Insofern ist die Modulation finanzpolitisch
eher nachteilig für die Bundesrepublik Deutschland.
Da das Volumen, was umgeschichtet werden kann, nur sehr begrenzt
ist, wird die Modulation auch keine Auswirkungen auf das Thema
Osterweiterung und auf die WTO haben.
Im Sommer 1999 haben die Agrarminister des Bundes und der
Länder mit überwiegender Mehrheit beschlossen, in
Deutschland keine Modulation einzuführen und den Landwirten
bis 2006 wenigstens Planungssicherheit zu geben. Darauf haben die
Landwirte auch einen gewissen Anspruch. Denn die Agenda 2000 hat
maßgebliche Veränderungen im System der
Agrarfinanzierung gebracht, indem nämlich die
Preisrückgänge nicht mehr vollständig ausgeglichen
worden sind.
Wenn wir die Modulation 2003 einführen und die evtl.
obligatorische Modulation 2004 oder 2005 kommen wird, schaffen wir
ein Kürzungssystem für ein Jahr und schließen
gleichzeitig mit den Landwirten fünfjährige Verträge
ab, obwohl wir wissen, dass die EU gerade bei der Frage der
Vertragsbindung bisher eigentlich keinerlei Abstriche gemacht und
sehr rigoros die Dinge durchgezogen hat. Wir haben also zwei
völlig unterschiedliche Laufzeiten bei der Mittelkürzung,
nämlich ein Jahr für die vertragliche Bindung und
fünf Jahre für die Landwirte und die Verwaltung. Insofern
ist das Problem Modulation auch ein großes Problem für
die Landwirte und die Verwaltung. Wir wissen nicht, welche
Möglichkeiten sich u. U. eröffnen, wenn es zu einer
obligatorischen Modulation kommt. Dies können nicht die
Möglichkeiten bleiben, die in Artikel 4 der Verordnung 1259
niedergelegt sind. Man braucht mehr, um nennenswert Mittel
umschichten zu können.
Die Einkommenssituation der Länder wird durch die Modulation
nicht verbessert. Dies gilt sowohl für die alten als auch noch
stärker für die neuen Bundesländer, weil dort der
Kofinanzierungssatz niedriger ist. Dort, wo die Ausweiszulage
bereits ausgeschöpft ist, wird eine Umsetzung nur im Bereich
der Agrarumwelt möglich sein. Das heißt, die Landwirte
werden rund 60 % der Einkommenswirkung der verkürzten Mittel
verlieren. Hinzu kommt der Vertrauensverlust und die
Wettbewerbsverzerrung. Auch wird sich dies auf die
Arbeitsplatzsituation im ganzen ländlichen Raum
auswirken.
Durch die Modulation wird der Umweltschutz nur marginal
gestärkt. Baden-Württemberg wendet rund 250 Mio. Euro pro
Jahr für Agrarumwelt und benachteiligte Gebiete auf. Bei
Kürzung und Kofinanzierung würden 4 Mio. Euro rauskommen,
also rund 1,6 % dieser Summe. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass
man die Kofinanzierungsmittel auch direkt einsetzen könnte,
verbleiben 0,8 % der ohnehin jährlich aufgewendeten Mittel.
Für diese 0,8 % müsste man ein aufwendiges
Verwaltungsverfahren einführen. Bundesweit sind es rund 80
Mio. Euro, die zusammenkommen, einschließlich der
Kofinanzierungsmittel. Allein im Einführungsjahr müsste
man mit einem Aufwand von rund 1 Mio. Euro an Verwaltungskosten
für Programmierung, Antragstellung usw. rechnen.
Nach dem Agrarbericht 2001 zahlen die Bundesländer für
umweltgerechte Agrarerzeugung Prämien von 2 DM bis zu 143 DM,
bzw. korrigiert 179 DM pro Hektar. Baden-Württemberg wird 2001
250 DM pro Hektar ausgeben. Laut Mitteilung des BMVEL haben die
Bundesländer im Förderzeitraum 1993 bis 1999
Agrarumweltmaßnahmen gemäß der Verordnung 2078/92
mit insgesamt 5,16 Mrd. DM gefördert. Mit der Modulation
werden wir dies nicht angleichen. Der Unterschied wird eher
verstärkt als zurückgenommen werden.
Der Zeitplan würde bedeuten, dass man spätestens im
Februar 2002 die entsprechenden Regelungen getroffen haben
müsste.
Als Fazit möchte ich sagen, dass wir über ein sehr teures
Spielzeug mit nachteiligen finanzpolitischen Auswirkungen reden,
mit einer Tendenz, die Nettozahlerposition zu verschlechtern.
Außerdem würden nachteilige agrarpolitische Auswirkungen
entstehen, wenn wir das Thema Vertrauensverlust und
Planungssicherheit heranziehen. Man würde marginale
Umwelteffekte erzielen mit einem riesigen Verwaltungsaufwand. Das
mid-term review sollte abgewartet werden. Kräfte müssen
gebündelt werden, ein vernünftiger Vorschlag muss
erarbeitet werden, und dann muss dieser Vorschlag in der EU
konsensfähig gemacht werden.
St Dr. Thomas Giese: Unser Thema ist die
Umschichtung von der Ersten in die Zweite Säule der
Agrarpolitik. Die Frage, ob es sinnvoll ist, von der Ersten in die
Zweite Säule umzuschichten, bejahen wir ganz klar. Die Erste
und Zweite Säule haben bisher immer noch ein Ungleichgewicht.
Langfristig wird es für Zahlungen aus der ersten Säule
keine gesellschaftliche Akzeptanz geben. Die Gesellschaft wird
nicht akzeptieren, sowohl die Produktion als auch die Entsorgung zu
bezahlen, wenn Produkte auf dem Markt nicht absetzbar sind. Es geht
darum, langfrisitig zu einer neuen Akzeptanz zu kommen. Die Zweite
Säule, in der es darum geht, ökologische Leistungen der
Landwirtschaft zu vergüten, muss gestärkt werden.
Modulation ist eine Notwendigkeit, die sich sowohl aus der
EU-Osterweiterung ergibt, aber auch aus dem
WTO-Verhandlungsprozess. Modulation gibt die Möglichkeit,
Zahlungen von der blue-box in die green-box zu verlagern. Die
Osterweiterung spricht ebenfalls für diesen Weg, weil ein
anderes System auf Dauer auch gar nicht finanzierbar
wäre.
Bei der Verabschiedung der Agenda 2000 ist auch vom Deutschen
Bauernverband gesagt worden, dass das System in
uneingeschränkter Fortführung der Ersten Säule nicht
finanzierbar ist. Deswegen kann man an dieser Stelle jetzt nicht
von Vertrauensverlust sprechen, wenn genau das eintritt, was man
erwartet und auch öffentlich gemacht hat.
Die Modulation ist eine Maßnahme des Umstiegs, weitere
Maßnahmen sind notwendig. Das Argument der
Wettbewerbsverzerrung trägt hier nicht. Die agrarpolitisch
wichtigsten Länder der Europäischen Union haben die
Modulation bereits eingeführt.
Intensive Debatten gibt es über die Frage des Zeitpunktes. Ich
halte den jetzigen Beginn für richtig. Es muss im deutschen
Interesse liegen, dass wir den Prozess der Modulation, der ohnehin
kommen wird, aktiv gestalten, jetzt erste Erfahrungen mit dieser
Modulation sammeln, jetzt in die Arbeiten eintreten und sie
voranbringen. Ansonsten gerät Deutschland in die Situation,
dass es das befolgen muss, was sich andere ausgedacht haben, und
dass es keine aktive und steuernde Rolle in diesem Prozess
einnehmen wird. Ich würde den beiden lateinischen
Aussprüchen, die vorhin angeführt worden sind, einen
Spruch entgegenhalten, nämlich: ?Carpe diem (nutze den Tag)?.
Wir müssen jetzt die Zeit nutzen, aktiv zu steuern und aktiv
unsere Erfahrungen mit diesem Instrument in einem sehr vorsichtigen
und maßvollen Umfang zu machen.
Der Verwaltungsaufwand wird erheblich übertrieben dargestellt
bzw. maßlos überschätzt. Von der Aufkommensseite
her ist es eine einfache Umprogrammierung, die alle
Länderverwaltungen in den unterschiedlichsten Bereichen immer
wieder vornehmen müssen. Immer, wenn neue Grenzbeträge
festgelegt werden, muss umprogrammiert werden. Dies ist schnell
geschehen und gilt auch für den Freibetrag, den wir für
dringend und sinnvoll halten. Der Freibetrag von 10.000 Euro ist
eine einfache Programmierung. Auf der Verwendungsseite geht es
darum, Verwendungsbausteine zu finden, die entsprechend auch
einfach umzusetzen sind. Auf der Einkommensseite sollten auch alle
Sonderkulturen einbezogen werden, denn es wäre gerade im
deutschen Interesse sehr schlecht, einzelne Kulturen auszunehmen,
die vielleicht in Deutschland mengenmäßig keine Rolle
spielten, aber in anderen europäischen Ländern. Man muss
an die Auswirkungen denken, die das haben würde.
Sonderkulturen wie Hopfen oder Tabak würden dann europaweit
ausgenommen werden. Gerade im Hinblick auf die Nettoposition kann
dahingehend kein deutsches Interesse bestehen.
In Nordrhein-Westfalen würden wir ca. 4 Mio. DM
Modulationsmittel erhalten, die dann mit weiteren 4 Mio. DM
kofinanziert würden. Diese 4 Mio. Kofinanzierungsmittel
wären über die Gemeinschaftsaufgabe in Höhe von 2,4
Mio. DM durch den Bund und in Höhe von 1,6 Mio. durch das Land
NRW zu tragen. Dies wäre für Nordrhein-Westfalen ohne
weiteres zu realisieren. Nordrhein-Westfalen konnte
Gemeinschaftsaufgabemittel, die in anderen Bundesländern nicht
abgeflossen sind, zusätzlich zu dem normalen
Länderplafonds übernehmen und kofinanzieren. Unser
Finanzminister hört es gerne, wenn sie ihm sagen können,
dass wir aus einer Mark, die wir im Landeshaushalt einsetzen, vier
weitere hinzugewinnen und damit 5 DM für Landwirtschaft und
ländlichen Raum einsetzen können.
Die Frage ist, ob diese Modulation gerade in Ländern, in denen
die Agrarumweltmaßnahmen einen erheblichen Stellenwert
einnehmen und ausgebaut werden, sinnvoll ist. Nordrhein-Westfalen
gehört zu diesen Ländern. Nordrhein-Westfalen hat die
Fläche, die mit Agrarumwelt- und
Vertragsnaturschutzmaßnahmen belegt ist von 1995 bis 2001,
von 40.000 Hektar auf 200.000 Hektar, d. h. verfünffachen
können. Ca. 10 % der landwirtschaftlichen Nutzflächen
werden durch Agrarumweltmaßnahmen bzw.
Vertragsnaturschutzmaßnahmen belegt. Gleichwohl macht die
Modulation Sinn, weil es möglich ist, neue Begünstigte
mit Modulationsmitteln zu versorgen. Es gibt auch sehr viele neue
und vielversprechende Förderbausteine, die den Weg nach vorne
weisen. Als Baustein möchte ich hier die
Grünlandextensivierung auf Einzelflächen nennen, die man
bisher nicht hatte, die aber dringend nötig ist. Gerade
für Rindviehhalter wäre dies eine besondere Hilfe.
Im Gesetzgebungsverfahren besteht eine Zustimmungspflicht des
Bundesrates, soweit das Verwaltungsverfahren geregelt wird. Soweit
dies nicht vorgesehen wäre, wäre auch keine
Zustimmungspflichtigkeit gegeben, unabhängig davon, ob ein
Freibetrag eingeführt wird oder nicht. Die Länder
möchten auch bei der Verwendung der Gelder beteiligt werden.
Deshalb begrüßen wir es, dass der Bund einen Vorschlag
zur Verteilung der Gemeinschaftsaufgabe machen will. Es wäre
auch die Möglichkeit denkbar, dass der Bund die Verwendung der
Mittel alleine vornimmt. Wir begrüßen deshalb, dass es
über die Gemeinschaftsaufgabe gehen soll. Dies sichert den
Ländern die entsprechenden Mitwirkungsmöglichkeiten, vor
allem, dass die Programmbausteine verwaltungspraktisch aufgestellt
werden können und sich der Kontrollaufwand dabei in Grenzen
hält. Dabei stehen die Länder dann natürlich in der
Verantwortung, einen entsprechenden Kofinanzierungsbeitrag leisten
zu müssen.
Die Beschlüsse von PLANAK in der letzten Woche sind ein
großer Fortschritt. PLANAK hat neun weitere Programmbausteine
entwickelt und dazu Eckpunkte beschlossen, die jetzt in
Fördergrundsätze detailliert werden sollen. Allein diese
neuen Programmbausteine belegen, dass es über die bisherigen
Agrarumweltmaßnahmen hinaus eine Vielzahl sinnvoller
Möglichkeiten gibt, dieses Geld einzusetzen.
Die Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Einkommen sind sehr
geringfügig. Nach vorsichtigen Rechnungen hat die
Einführung der Modulation auf Grund ihres zu Beginns nur
bescheidenen Umfangs nur eine Einkommensauswirkung in der
Größenordnung von 0,5 %. Dies ist also ein fast nicht
mehr messbarer Bereich. Wenn man auf der anderen Seite
berücksichtigt, dass dieses Geld vermehrt durch die
Kofinanzierung in die Landwirtschaft und in die
landwirtschaftlichen Räume zurückfließt, dann ist
dies am Ende nicht ein Verlust für das landwirtschaftliche
Einkommen, sondern ein Gewinn. Deshalb begrüßt
Nordrhein-Westfalen diesen Gesetzesentwurf ausdrücklich.
Dr. Breitbarth, (Anlage 3)
Abg. Matthias Weisheit: Ich möchte eine
Anmerkung zur Eile machen. So eilig und kurzfristig ist diese
Diskussion nicht, denn sie wird bereits seit einem Jahr
geführt. Inkrafttreten soll das Gesetz erst 2003. Es liegt
also noch ein Jahr dazwischen.
Diejenigen, die sich gegen die Modulation ausgesprochen haben,
reden immer nur von Agrarumweltmaßnahmen. Neben diesen
Maßnahmen gibt es aber auch noch andere Maßnahmen. Es
geht z. B. um Möglichkeiten zur verbesserten Tierhaltung oder
auch zur Vermarktung. Man sollte sich also nicht nur auf
Agrarumweltmaßnahmen beschränken. Ich denke hier
besonders an die Kritik der Kommission, die besagt hat, dass
Deutschland neben Agrarumweltmaßnahmen andere
Möglichkeiten versäumt hat. Dieser Kritik könnte man
entgegensteuern, wenn man willens dazu wäre.
Natürlich haben wir einen großen Verwaltungsaufwand. Am
Anfang der Diskussion hatten wir einen Vorschlag, der in die
Richtung der Position des Deutschen Bauernverbandes geht. Wir
wollten die Kleinerzeugerbeihilfen und auch die Tierprämien
herausnehmen, allerdings ohne Freibetrag. Die meisten betroffenen
Betriebe mit Tierprämien befinden sich in den
Veredelungsbereichen in den alten Bundesländern. Wenn diese
herausgenommen werden, bräuchte man keinen Freibetrag mehr.
Das wäre natürlich eine Erleichterung für den
Verwaltungsaufwand. Ich möchte gern wissen, ob es dann
wirklich noch einen Freibetrag geben muss, wenn man eine solche
Regelung macht. Außerdem möchte ich gern wissen, welche
Möglichkeiten es gibt, das Geld außerhalb von
Agrarumweltmaßnahmen zu verwenden. Diese Fragen würde
ich gern vom Deutschen Bauernverband und von Herrn Kleinhanß
beantwortet haben.
Abg. Kersten Naumann: Das Spektrum der Meinungen
ist wirklich sehr vielfältig, vor allem die unterschiedlichen
Positionen der Länder haben mich nachdenklich gemacht.
Ich möchte auch noch etwas zur Eile sagen. Abg. Weisheit hat
dargestellt, dass man schon seit einem Jahr diskutiere und dass das
Gesetz 2003 in Kraft treten solle. Ich meine aber, dass man an dem
konkreten Gesetzentwurf noch nicht sehr lange diskutiert. Ich halte
alles doch für sehr übereilt. Dies haben wir aber bereits
im Ausschuss diskutiert und moniert.
Ich habe jetzt eine Frage an die Vertreter von
Baden-Württemberg und Thüringen. Herr Griese von
Nordrhein-Westfalen hat die Modulation vorbehaltlos für gut
befunden. Er hat auch die Kofinanzierungsmittel aufgezeigt. Ich
denke, dass dies ein großes Problem für viele
Länder ist. Ich würde gern wissen, wie es in
Baden-Württemberg und Thüringen mit der Kofinanzierung
aussieht und ob sie so gut wie in Nordrhein-Westfalen machbar ist.
Davon hängt die Umsetzung ab.
Abg. Ulrike Höfken: Ich kann die Position der
Bundesländer, die sich gegen die Modulation aussprechen, nicht
verstehen. Mir ist nicht begreiflich, wie man Möglichkeiten
nicht wahrnehmen kann, zusätzliche Mittel zur
Unterstützung der landwirtschaftlichen Betriebe zu erreichen.
Ich sehe auch eine Verweigerung gegenüber der Notwendigkeit,
sich bestimmten Problemen der Agrarfördermaßnahmen
insgesamt zu stellen. Es ist auch eine Verweigerung da, sich den
auf EU-Ebene ergebenden Anforderungen zu stellen. Dies macht mich
betroffen, wenn ich bedenke, dass dies alles zu Lasten der
landwirtschaftlichen Betriebe geht.
Die Länder betreffend bin ich hilflos. Die Modulation ist Teil
der Agenda 2000 und als solche schon immer in der Diskussion
gewesen. Sie ist nicht wahrgenommen worden, weil die Chancen darin
nicht erkannt worden sind. Sie muss jetzt unter veränderten
Bedingungen konkreter diskutiert werden. Dies wird auf die
Länder zukommen, gerade im Hinblick auf die Länder, die
der EU im Jahre 2004 beitreten wollen. Mir ist unklar, wie wir
beantworten wollen, wie dieser Beitritt letztendlich finanziert
wird. Man kann nicht sagen, dass es EU-Rückzahlungen aus der
Agrarmarktordnung gibt, mit denen man dies tun könnte. Dies
stimmt so nicht.
Gerade wenn man vermeiden möchte, dass es in der Entwicklung
der ländlichen Räume zu Verwerfungen kommt, muss man sich
der Herausforderung, wie die vergrößerte EU im Hinblick
auf die Aufgaben im Agrarbereich finanzierbar ist, stellen. Es gibt
nur die Lösung, dass man anerkennt, dass es kaum mit einem
Zwei-Klassen-System innerhalb der EU funktionieren wird. Dieser
Auffassung sind auch die meisten anderen Länder. Wir
müssen überlegen, wie unser zukünftiges System
aussehen soll. Das System muss gleichermaßen den alten wie
den neuen Mitgliedsländern eine Chance bieten. Sehr
frühzeitig ist klar gewesen, dass die Zweite Säule das
Element sein wird, welches in Zukunft eine Verstärkung
erhält. Darauf müssen sich die Betriebe und auch die
Verwaltungen vorbereiten. Modulation ist ein Mittel, welches diese
Vorbereitungen ein großes Stück weit leisten kann. Ich
halte es für fahrlässig, die Entscheidungen in der EU
abzuwarten. Dies ist kein guter Weg. Alle Betriebe erwarten eine
Hinführung, also eine Möglichkeit sich auszurichten. In
dem Maße, wie sich Deutschland an dieser zu erwartenden
Umstrukturierung beteiligt, kann es natürlich auch seine
eigenen Strukturen darauf vorbereiten und sich die Mitsprache
innerhalb der EU sichern. Wenn eine bestimmte Kategorie von
Maßnahmen von den Mitgliedsländern, wie Deutschland,
Frankreich, Großbritannien und Portugal wahrgenommen wird,
ist zu erwarten, dass diese Ausrichtungen in den entsprechenden
Ländern auch Teil dieser Diskussion um die obligatorische
Einführung der Modulation werden.
Es spricht auch nichts dagegen, heute schon mit einzubeziehen, dass
die Möglichkeiten an Modulationsmaßnahmen, die die EU
bietet, für die Verwendungsseite mit in die Anforderungen
aufgenommen werden und man eine solche Kategorie in Absprache mit
der Kommission selbst schafft.
Ich bedauere, dass wir in Deutschland nicht frühzeitig auf die
Möglichkeiten der Modulation Zugriff genommen haben und nicht
im Jahre 2001 mit der Modulation begonnen wurde. Für jede
Mark, die aus den Direktzahlungen herausgegeben wird, gibt es zwei
Mark zurück. Insofern hat man die Landwirtschaft
sträflicherweise um eine große Summe von Förder-
und Neuausrichtungsmöglichkeiten gebracht.
Die Anforderungen an die Länder zur Kofinanzierung sind
relativ gering. Ich weiß um die Finanzschwierigkeiten, die
einige Länder haben. Aber dies kann angesichts der Probleme,
die in manchen Ländern im ländlichen Raum vorhanden sind,
nicht der Maßstab sein, gerade auch angesichts der geringen
Summe, um die es sich im Moment handelt.
Es gibt eine neue Untersuchung für Brandenburg, in der man
sich um die Zukunft der ländlichen Räume Sorgen macht. Es
wird dort sehr klar gesagt, dass es angesichts der demographischen
Entwicklungen, der Abwanderung und der abnehmenden Perspektiven in
den ländlichen Räumen zu enormen Problemen im Land
Brandenburg und im ländlichen Raum kommt. Das gleiche gilt
für Mecklenburg, aber auch für viele andere Regionen in
den alten Bundesländern. Wer die Entwicklungen in den
ländlichen Regionen vernachlässigt, wird sehr bald zu
Ergebnissen kommen, wie sie jetzt bereits in Frankreich vorliegen
oder bei uns in den neuen Bundesländern absehbar sind. Es wird
zu einer Übervölkerung der Städte kommen, mit
entsprechenden Problemen und einer mangelhaften
mittelständischen Ausprägung. Länder wie
Baden-Württemberg und Bayern bieten eine sehr viel stabilere
Ausgangssituation. Man muss die Möglichkeiten, die sich heute
ergeben, für die ländlichen Räume entsprechend
nutzen.
Meine Fragen richten sich an Thomas Griese. Wie beurteilen Sie die
Möglichkeiten bei der Verwendungsseite, die rinder- und
tierhaltenden Betriebe stärker im Auge zu halten? Im Bereich
der Ackerkulturen gibt es eine Überkompensation und im Bereich
der Tier haltenden Betriebe eine zunehmende Verschlechterung der
Situation. Sollte man nicht im Rahmen der Modulation die
Möglichkeit nutzen, gerade diese Betriebe stärker zu
fokussieren und eine Ausrichtung auf der Verwendungsseite in dieser
Hinsicht stärker zu akzentuieren?
Neben den Agrarumweltmaßnahmen muss es genauso unsere Aufgabe
sein, in dem Bereich Arbeitsplätze etwas zu ändern. Ich
frage Herrn Spahn, welche Möglichkeiten es im bestehenden
Modell gibt, hier stärker Akzente zu setzen.
Abg. Albert Deß: Ich bin entschiedener
Gegner des jetzigen Ausgleichszahlungssystems. Dieses System ist
ein agrarpolitischer Irrweg. Ich bin schon verwundert, dass die
Bundesregierung, nachdem das Handelsrabattgesetz abgeschafft worden
ist, jetzt das 2-%-Rabattgesetz in der Landwirtschaft
einführt. Mit Sicherheit ist der Verwaltungsaufwand dort
wesentlich höher als die Wertigkeit. In Nordrhein-Westfalen
wird man bei einer Fläche von 1,5 Mio. ha 8 Mio. DM mehr
haben. Dies sind dann 5,33 DM p/ha. Wenn man 5 DM p/ha mehr zur
Verfügung hat, ist dies kein großer Schritt. Dem
Agrarbericht der Bundesregierung entnehme ich, dass
Nordrhein-Westfalen für umweltgerechte Agrarerzeugung 9 DM
p/ha ausgibt, während Bayern 143 DM p/ha,
Baden-Württemberg 130 DM p/ha, Thüringen 104 DM p/ha und
Sachsen 94 DM p/ha ausgeben. Ich bin verwundert, dass in
rot-grün regierten Bundesländern die Modulation gefordert
wird, obwohl doch vorher die bereits vorhandenen Chancen nicht
genutzt wurden. Ich verstehe nicht, dass der Finanzminister von
Nordrhein-Westfalen das Geld in Brüssel nicht beantragt hat.
Bayern, Thüringen und Sachsen und Baden-Württemberg haben
Kofinanzierungsmittel in Brüssel beantragt und erhalten. In
Bayern hat man ein Problem mit dem Modulationsgesetz. Wenn man,
anstatt am 15. Juni am 15. August den Mähtermin macht, dann
ist kein Heu mehr vorhanden. Es kann dann höchstens noch als
Brennmaterial verwendet werden.
Wir haben nicht das Problem, dass die Städte
übervölkert werden, sondern das Problem, dass die
Dörfer übervölkert werden. Die
Großstädter wollen alle draußen auf dem Land
wohnen. Damit werden die Bauern in gewissen Bereichen schikaniert,
denn den Güllegeruch wollen die Großstädter dann
doch nicht ertragen.
Obwohl ich das jetzige Ausgleichszahlungssystem für einen
agrarpolitischen Irrweg halte, bin ich dafür, dass man bis
2006 wenig verändert, weil die Bauern eine gewisse
Planungssicherheit benötigen. Wir sollten uns im Rahmen der
Modulationsdiskussion darüber unterhalten, was nach dem Jahre
2006 notwendig ist. Es kann doch nicht sein, dass mit Geldern der
Steuerzahler die Technik und nicht der Mensch gefördert wird.
Ich möchte den agrarpolitischen Irrsinn an einem Beispiel
aufzeigen. Bei einem 1.000-Hektar-Betrieb, in dem nur Getreide
angebaut wird, werden 720 DM pro Hektar Ausgleichszahlungen
gezahlt. Dies sind insgesamt 720.000 DM. 1.000 Hektar kann ich mit
moderner Technik mit vier Arbeitsstunden pro Hektar bewirtschaften.
Dies sind 4.000 Arbeitsstunden. Pro Arbeitsstunde werden hier 180
DM staatliche Fördergelder bezahlt, damit 7.000 t Getreide
erzeugt wird, welches man dann am Weltmarkt billig verkaufen
muss.
Wenn BMW, Audi und VW für jedes Auto 5.000 DM Steuermittel
benötigen würden, dann würde die Autoproduktion sehr
schnell eingestellt werden.
Ich möchte noch ein anderes Beispiel anführen: Man nehme
einen 100-Hektar-Betrieb mit 60 Kühen, der 50 Hektar
Grünland hat und auf 50 Hektar Getreide und Zimmermais anbaut.
Dies sind ebenfalls mindestens 4.000 Arbeitsstunden im Jahr. Es
sind also auch zwei Arbeitskräfte nötig und man
erhält 36.000 DM Ausgleichszahlungen, also 18.000 DM pro
Arbeitskraft.
Dieser agrarpolitische Irrsinn wird nicht mit der Modulation
beendet. Wenn die Modulation richtig eingesetzt werden würde,
hätte sie Sinn. Im Bereich Umweltargrarmaßnahmen gibt es
Länder, die diesen Bereich vollständig abdecken. Es
müsste eine massive Entlastung bei den Sozialkosten in der
Landwirtschaft eingeführt werden, dann wären auch mehr
junge Leute bereit, auf dem Bauernhof zu bleiben. Außerdem
müsste für Bewirtschaftungserschwernisse etwas gezahlt
werden.
Ich bin u. a. auch dafür, dass man mit den Geldern, die in
Brüssel gewährt werden, Marktentlastung betreibt, also
dass man im Bereich nachwachsende Rohstoffe und nachwachsende
Energien wesentlich mehr Gelder einsetzt. Als Landwirt wäre es
mir lieber, wenn ich für mein Getreideprodukt nur 10 DM mehr
bekommen würde und über den Produktionskosten liegen
würde, als unter den Produktionskosten zu produzieren und dann
von Brüssel Ausgleichszahlungen zu erhalten. Dies ist nicht
mein Berufsbild vom Landwirt. Deshalb sind auch viele junge Bauern
nicht mehr bereit, Landwirt zu werden.
Abg. Marita Sehn: Der Gesetzentwurf, so wie er
nächste Woche beschlossen werden soll, scheint noch nicht reif
zu sein.
Meine Frage geht an die Bundesländer, die in der Vergangenheit
fleißig mit ihren Agrarumweltprogrammen waren. Gibt es
Überlegungen, wie man evtl. trotzdem noch etwas machen
könnte und wenn ja, wie sehen diese aus?
Es wurde hier viel von Bürokratie und Verwaltungskosten
gesprochen. Was glauben Sie, was einem Landwirt übrig bleibt,
wenn er einen Euro durch die Modulation erhält?
Es ist gesagt worden, dass man die Modulation, wenn man keine
Einigung finden sollte, evtl. ohne die Bundesländer machen
werde. Glauben Sie, dass man sich im Vermittlungsausschuss oder im
Bundesrat einigen wird?
Der Vorsitzende: Herr Prof. Kleinhanß, Sie
haben gesagt, dass die Mittel von der Ersten für die Zweite
Säule umgeschichtet werden. Diesem ist grundsätzlich
zuzustimmen. Muss man aber dem zustimmen, dass das Geld für
die Zweite Säule aus der Ersten Säule kommt? Spielt
Wettbewerbsfähigkeit in der Landwirtschaft überhaupt noch
eine Rolle? Was ist zu tun, damit die landwirtschaftlichen Betriebe
wieder wettbewerbsfähig werden?
Meine nächste Frage geht an den Bauernverband
Baden-Württemberg und an Herrn Kleinhanß. Ich glaube,
dass übereinstimmend die Meinung bestand, dass es richtig sei,
die Zweite Säule zu stärken. Dies ist gar keine Frage.
Aber es stellt sich die Frage, ob gleichzeitig dabei die Erste
Säule geschwächt werden muss. Das Geld könnte auch
von außen kommen. Denn wenn man für die Zweite
Säule Mittel aus der Ersten Säule nimmt, dann heißt
das doch, dass man die Landwirtschaft mit der Landwirtschaft
finanziert. Dann stellt sich auch die Frage, ob es dieselben
Betriebe sind, die dann dieses Geld bekommen. Wenn dies nicht
geschieht, ist das Argument, dass das Geld in der Landwirtschaft
bleibt, für denjenigen, bei dem abgezogen wird und der nichts
dazubekommt, zynisch.
Wie sehen Sie die Modulation, wenn Sie die momentane Situation in
der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes betrachten? Wie stellen sich Länder, die
jetzt schon Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe nicht abrufen, eine
entstehende Wettbewerbsfähigkeit vor, die dann entstehen
würde?
Meine letzte Frage geht an Herrn Griese. Wenn ich es richtig
verstanden habe, soll die Modulation nicht nur dazu dienen,
Umweltmaßnahmen zu finanzieren, sondern sie soll im
Wesentlichen dazu dienen, das gesetzte Ziel 20 % ökologischer
Landbau zu finanzieren. Der ökologische Landbau wird also aus
der Gemeinschaftsaufgabe finanziert. Wenn ich ihn aus der
Gemeinschaftsaufgabe finanziere, dann wären die 2 %, die man
jedes Jahr umstellen müsste, um im Jahre 2010 auf 20 % zu
kommen, mit 10 Mio. Euro jedes Jahr zusätzlich zu finanzieren.
Meinen Sie, dass die Modulationsmittel, die sowieso nur bis 2006
gesichert sind, für diese Finanzierung reichen? Was bleibt
dann noch übrig, was aus der Gemeinschaftsaufgabe finanziert
werden kann?
Dr. Breitbarth: Definitiv habe ich die Frage nach
den Aussichten der Kofinanzierung verstanden. Hier ist
festzustellen, dass Thüringen im Vergleich zu
Nordrhein-Westfalen weniger Direktzahlungen erhält, aber mehr
Kofinanzierungsmittel aufbringen muss. Ich kann keinen
Haushaltsentscheidungen vorgreifen. Ich meine aber, dass definitiv
die Möglichkeit verfolgt wird, die Kofinanzierung zusammen mit
der Gemeinschaftsaufgabe zu realisieren.
Zu der Frage, welche Verwendungen der Modulationsmittel über
die Agrarumweltmaßnahmen hinaus möglich sind, muss
zunächst ganz klar das Korsett der Verordnungen genannt
werden. Da können wir mit Markt- und Marketingmaßnahmen
nichts ausrichten. Aus unserer Sicht ist an dem Gesetzentwurf
nachteilig, dass wir in der Ausgleichszulage keine
Modulationsmittel einsetzen wollen und sollen. In Richtung von
Rechtstexten wäre es ganz dringend notwendig, die
Verwendungsmöglichkeiten zu öffnen, damit echte
Einkommensveränderungen geleistet werden können. Das
Stichwort nachwachsende Rohstoffe und Marketing ist gefallen.
Bezüglich der Auslegung der bestehenden Texte innerhalb der
Agrarumweltmaßnahmen wäre es auch ein Anliegen,
Agrarumweltmaßnahmen nicht zu eng an den Verzicht auf
Betriebsmitteleinsatz zu binden. Die Überlegungen, das
Umweltmanagement als eine Umweltagrarmaßnahme anzuerkennen,
wäre eine wesentliche Chance, Ackerbaubetriebe besser zu
erreichen. Dies lässt die Verordnung zwar zu, aber die
Kommission legt sie eng aus.
St Dr. Thomas Griese: Abg. Deß hat den
Irrsinn der Ausgleichszahlungen angeführt. Die
Fehlsteuerungen, die hierbei auftreten, muss man in der Tat sehr
kritisch sehen. Eine Kürzung um 2 % kommt dem aber entgegen.
Wenn man das Beispiel von den 5 DM mehr pro Hektar heranzieht,
zeigt das doch, dass man eine sehr marginale Entwicklung hat und
sehr langsam eine andere Richtung einschlägt. Dies ist ein
ganz bescheidener Einstieg, aber immerhin werden die 4 oder 5 DM
dann verdoppelt.
Zur Frage, ob nicht schon genügend Agrarumweltmaßnahmen
vorhanden sind und ob daneben überhaupt noch Platz für
die Modulation ist, möchte ich zunächst aus
nordrhein-westfälischer Sicht sagen, dass Nordrhein-Westfalen
dort einen Nachholbedarf hatte. Wir haben aber diesen Nachholbedarf
inzwischen aufgeholt. Im Rahmen unseres Programms ländlicher
Raum planen wir, die Zahl der Agrarumweltfläche von 200.000
Hektar auf etwa 350.000 Hektar bis 2006 fast zu verdoppeln. Dies
ist genug Beleg dafür, dass wir hier die Möglichkeiten
inzwischen voll ausschöpfen. Wir haben erstmals auch
Möglichkeiten genutzt, die andere Bundesländer noch nicht
genutzt haben, z. B. mit Hilfe der EU-Kofinanzierung einen
Ausgleich für Vogelschutzgebietsflächen für die
Landwirtschaft zu leisten. Über die bestehenden
Umweltagrarmaßnahmen hinaus gibt es viele weitere
Anwendungsbereiche. Ich würde gern einige deutlich machen und
damit auch verdeutlichen, dass ich einen Schwerpunkt auch in
Zukunft gerade bei den Viehhaltern und bei den viehhaltenden
Betrieben sehe.
Von den neuen Modulationsbausteinen, die in der letzten Woche im
PLANAK beschlossen worden sind, sind mir drei besonders wichtig.
Zum einen die einzelflächenbezogene
Grünlandextensivierung. Dies ist besonders für Betriebe
wichtig, die als Agrarumweltmaßnahme nicht gleich den
gesamten Betrieb extensivieren wollen, sondern erst mit
Teilflächen Erfahrungen sammeln wollen. Dieser
Programmbaustein ist also sinnvoll, insbesondere für die
rinderhaltenden Betriebe in den Mittelgebirgsregionen, die unter
besonderen Einkommensschwierigkeiten leiden. Der zweite
Modulationsbaustein soll die Exaktausbringung von flüssigem
Wirtschaftsdünger werden. Auch dies ist eine sehr wichtige
Sache vor dem Hintergrund, Gewässerbelastung und
Geruchsemissionen und damit auch Konflikte im ländlichen Raum
zu vermeiden. Dies ist eine Maßnahme, die bisher in keinem
anderen Bundesland angeboten wird. Ein dritter Baustein sollen
umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren sein. Dies kommt gerade
rinderhaltenden Betrieben zugute. Gerade Kürzungen, die durch
die Tierprämien anfallen, wird man durch diesen Sektor
zurückgeben.
Darüber hinaus kann man noch an weitere Maßnahmen
denken. Hierbei sind auch die Länder aufgefordert,
entsprechende Phantasie zu entfalten.
Sie hatten auch gefragt, ob es im Vermittlungsausschuss eine
Einigung geben wird. Dies ist schwer zu prognostizieren. Ich hoffe,
dass es eine Einigung geben wird, weil es aus meiner Sicht wichtig
ist, dass die Länder beteiligt sind. Der Weg, die Zustimmung
der Länder zu suchen und die Länder mitreden zu lassen,
ist ein guter.
Herr Carstensen hatte auch gefragt, ob gewährleistet ist, dass
die Modulationsmittel genau in die Betriebe
zurückfließen, die die Kürzungen hinnehmen
müssen. Dies wird natürlich nicht in dem Sinne
möglich sein, dass der Betrieb genau das Geld wiederbekommt,
was er bei der Kürzung hat abgeben müssen. Wir werden
aber anstreben, eine solche Vielzahl von Modulationsbausteinen zu
haben, dass jedenfalls jeder Betrieb, sei es ein Vieh haltender
Betrieb, sei es ein Ackerbaubetrieb, in der Lage ist, solche
Programmbausteine in Anspruch zu nehmen. Es muss also eine
große Anzahl von Möglichkeiten angeboten werden. Ich
werte es also als positives Zeichen, dass in der letzten Woche neun
verschiedene Möglichkeiten beschlossen worden sind.
Ich plädiere leidenschaftlich dafür, jetzt mit der
Modulation zu beginnen, weil es auch gegenüber der EU darum
gehen wird, das Verständnis über das, was wir unter
Agrarumweltmaßnahmen verstehen, zu erweitern. Indem wir z. B.
auch Maßnahmen vorsehen, die Bezug zur Tierhaltung haben,
können wir bei der EU dafür die Wege öffnen, dass es
auf Dauer zu einer Entwicklung kommt, bei der auch solche
Maßnahmen selbstverständlich anerkannt sind. Wenn
Deutschland sich jetzt abwartend verhält und nicht durch
eigene Phantasie Programmbausteine vorlegt, dann wird die
Gestaltung entsprechender Programme von anderen erfolgen. Die
Spezifika Deutschlands könnten in diesem Prozess nicht
eingebracht werden.
Der Vorsitzende: Ich möchte noch einmal eine
Verständnisfrage stellen. Wie werden Sie damit umgehen, wenn
Sie mehr Anträge bekommen als Modulationsmittel vorhanden
sind? So üppig sind die Modulationsmittel auch nicht
vorhanden.
St Dr. Thomas Griese: Gerade, weil wir nicht alles
voraussehen können, ist es wichtig, jetzt Erfahrungen zu
sammeln, um dann sehr viel sorgfältiger auf die weitere
Ausgestaltung Einfluss zu nehmen. Aus genau dem angesprochenen
Punkt ist es sinnvoll, das Ganze in das System der
Gemeinschaftsaufgabe einzubauen, weil wir in diesem System die
gegenseitige Deckungsfähigkeit haben. Wir sind da nicht
festgelegt, dass wir einen Modulationsbaustein nur aus
Modulationsmitteln finanzieren, sondern wir könnten auch durch
die gegenseitige Deckungsfähigkeit, je nachdem, in welchem
Antragsjahr welche Anträge gestellt sind, auch die Mittel der
Gemeinschaftsaufgabe einsetzen.
Zur Frage, ob die Modulation in erster Linie der Förderung des
ökologischen Landbaues dient, möchte ich sagen, dass dies
aus meiner Sicht nicht der Fall ist. Die Förderung des
ökologischen Landbaus ist schon sehr gut in der
Gemeinschaftsaufgabe abgesichert. Der PLANAK hat dazu schon im
letzten Juni gute Beschlüsse gefasst, in denen die Umstellung
auf Ökolandbau, die Beibehaltung und auch die
Vermarktungsförderung festgelegt worden sind. Es ist deshalb
nicht notwendig, in der Verwendung der Modulationsgelder auch noch
einen Baustein für Öko-Landbau vorzusehen. Deshalb ist es
konsequenterweise auch so, dass unter den neun Punkten, die ich
vorhin vorgetragen habe, kein spezifischer Öko-Landbaupunkt
ist. Es wäre auch nicht gut, über das Niveau, was wir
über die Gemeinschaftsaufgabe erreicht haben, noch weiter
hinauszugehen, denn jetzt besteht ein ausgewogenes Verhältnis
von Mehraufwendungen beim Öko-Landbau zur Förderung. Man
muss sehen, dass dies nicht ins Ungleichgewicht gerät. Die
jetzigen Förderansätze, die wir in der
Gemeinschaftsaufgabe haben, sind deswegen ausreichend und
gut.
Zur Frage, ob es möglich ist, die Zweite Säule zu
stärken, ohne die Erste Säule zu belasten, kann man nur
sagen, dass dies natürlich denkbar ist. Nur muss man sehen,
dass die Mittel insgesamt nicht vermehrbar sind. Es gibt die
Agrarleitlinie der EU. Angesichts der bestehenden Mittelknappheit
kommt man nicht an der Einsicht vorbei, dass das eine nicht ohne
den Zufluss aus dem anderen funktioniert. Es kommt natürlich
aber durch die staatliche Kofinanzierung auch wieder in den einen
Topf zurück. Die Verschiebung von der Ersten in die Zweite
Säule ist damit richtig, denn es erfolgt eine Aufstockung
durch die staatlichen Kofinanzierungsmittel. Am Ende ist es per
Saldo ein Gewinn für die Landwirtschaft und den
ländlichen Raum.
MDg Joachim Hauck: Die Zweite Säule kann man
z. B. dadurch stärken, dass die Bundesrepublik ihre zur
Verfügung stehenden Mittel vollständig ausnützt. Im
letzten Jahr waren es 50 Mio. DM, die von den Bundesländern in
Brüssel nicht abgerufen worden sind.
Die Zweite Säule kann innerhalb der Agrarleitlinie auch
dadurch gestärkt werden, dass zurückfließende
Mittel in die Landwirtschaft hineinkommen, also in die Zweite
Säule. Mit der Modulation gelingt eindeutig nicht, dass wir
unsere seit Jahren bewährte integrierte Politik für den
ländlichen Raum, nämlich zum einen und für die
Landwirtschaft etwas zu tun, und zum anderen die Arbeitsplätze
im ländlichen Raum zu stärken, weil die
Verwendungsmöglichkeiten sehr stark eingeengt sind,
fortführen. Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung 1259 lässt
keine Investitionen zu, außer in Verbindung mit Artikel 24
der Verordnung 1257, der besagt, dass Kosten nicht produktiver
Investitionen, die zur Einhaltung von Verpflichtungen erforderlich
sind, nicht in die Prämie eingerechnet werden können.
Dies ist die einzige Stelle in dem gesamten Paket, an der
Investitionen zulässig sind, welche in die Prämien
eingerechnet werden.
Im Übrigen gehen beispielsweise die Aussagen von Fischler und
das tatsächliche Verhalten seiner Mitarbeiter bei der
Genehmigung der Maßnahmen in den Entwicklungsplänen weit
auseinander. Wir hatten versucht, das Entwicklungsprogramm
ländlicher Raum kofinanzieren zu lassen. Flapsig gesagt
können wir den Frisör im ländlichen Raum nur
unterstützen, wenn er den Bauern die Haare schneidet, denn den
Artikel 33 hat man sehr eng ausgelegt. Es hätte uns sehr viel
gebracht, wenn man die 120 Mio. DM vom Entwicklungsprogramm
ländlicher Raum auch noch in die Kofinanzierung gebracht
hätte. Aber dies war nicht möglich. Das heißt,
Brüssel ist sehr streng bei der Zweiten Säule, was die
Verwendungsmöglichkeiten anbetrifft, noch viel enger als die
politischen Äußerungen, die nach außen treten.
Insoweit ist der Spielraum sehr eng und damit auch der Spielraum
für die Modulationsmittel.
Für ein Land, welches schon relativ viele
Umweltmaßnahmen ergriffen hat, gibt es nicht die
Möglichkeit von Ausgleichszahlungen. Denn die vom Bund
vorgeschlagenen Maßnahmen, die man zum ökologischen
Landbau leisten sollte, werden bereits gefördert. Weiterhin
scheidet z. B. das Thema Gülleausbringung aus, weil dies
bereits gefördert wird. Wir sehen aber sehr wohl
Möglichkeiten, die Mittel zu verwenden, die im Rahmen der
Modulation anfallen würden. Dies sind auch keine großen
Beträge. Wir würden sie z. B. im Bereich artgerechte
Tierhaltung einsetzen, wenn die EU genehmigt, dass der
ökologische Landbau aus der Modulation mit einem gewissen
Umweltzuschlag gefördert wird und dann auch den Umstieg
möglich macht.
Wir haben bereits 5 % Ökobetriebe. Es kann nicht sein, dass
die, die seit Jahren schon ökologischen Landbau betreiben,
jetzt schlechter gefördert werden als die Neueinsteiger. Diese
Fragen sind alle noch offen und auch noch nicht mit der Kommission
geklärt. Es ist auch noch nicht mit der Kommission
geklärt, ob artgerechte Tierhaltung als Umweltmaßnahme
gefördert werden kann. Gerade für die Legehennen halten
wir es für wichtig, dass man hier etwas tut. Wir wären
aber möglicherweise auch ohne Modulation in diesen Bereich
eingestiegen. Die ersten Diskussionspapiere dazu liegen auch schon
vor.
Zur Frage Grünlandextensivierung kann ich sagen, dass wir eine
flächendeckende Grünlandprämie haben. Von 62.000
Betrieben sind 53.000 Betriebe vertraglich in
Agrarumweltmaßnahmen gebunden. Dies macht die Dimension
deutlich, über die wir diskutieren. Die Mittel wären aber
in dem Bereich unterzubringen. Da die EU maximal 20 % Anreizwirkung
unterstellt und der Rest durch höhere Leistungen oder durch
Verzicht auf Ertrag gebracht werden muss, verbleiben am Schluss von
2 Euro, wenn man einen Euro abzieht, nur 40 Cent einkommenswirksam.
Dies ist die Rechnung, wenn sie nicht größere
Mitnahmeeffekte unterstellen. Insoweit stimmt die Rechnung nicht,
dass das Einkommen der Landwirte durch die Verdoppelung steigen
würde.
Die Verwaltungskosten sind von den Ländern selber zu tragen.
Deswegen entstehen neben der Kofinanzierung auch Verwaltungskosten.
Aber selbstverständlich wird man diese 1,5 Mrd. kofinanzieren.
Wir haben dem Bund vorgeschlagen, dass er, wenn er für die
Agrarumwelt etwas tun will, die Mittel, die er zusätzlich in
der GA hat, insgesamt für Agrarumweltmaßnahmen zur
Verfügung stellt.
Nach Artikel 104 a Absatz 3 GG ist eine Modulation ohne die
Bundesländer möglich. Der Bund trägt dann aber die
Verwaltungskosten und auch das Anlastungsrisiko.
Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass der Zeitpunkt nicht richtig
ist. Man sollte sich überlegen, ob man nicht zu anderen
Maßnahmen kommt. Die Erste Säule ist in der Diskussion
und wird in der Diskussion bleiben, insbesondere, wenn wir zu
derart hohen Zahlungen, wie sie Abg. Deß dargestellt hat,
Stellung nehmen müssen. Deshalb sieht die Modulation diese
Degression vor. Es ist eine Degression bezogen auf drei Parameter.
Man muss sicherlich in dieser Richtung etwas tun. Auf der anderen
Seite wird es immer schwerer - wohlwissend, dass dies ein Ausgleich
für reduzierte Preise ist - die Dinge nach außen
verständlich zu machen. Über 97 % der Bevölkerung
haben nichts mit der Landwirtschaft zu tun. Folglich braucht man
andere Instrumente. Nur können diese Instrumente nicht darin
bestehen, dass wir umschichten und dazu noch weiter bezahlen, dass
wir umschichten in sehr teure Verwaltungsverfahren und dass wir
umschichten in der Art und Weise, dass bei den Landwirten nichts
ankommt. Insoweit müssen es bei der Umschichtung
Maßnahmen sein, die auch bei den Landwirten einkommenswirksam
sind.
Wir haben es in Baden-Württemberg verstanden, in den
vergangenen 50 Jahren einen Strukturwandel von 3 bis 4 % pro Jahr
sozial abzufedern durch eine Politik für die Landwirte und den
ländlichen Raum. Diesen Prozess wollen wir schlichtweg nicht
überhitzen. Er wird weiterlaufen und wir werden weiterhin
einen Strukturwandel von 3 bis 4 % pro Jahr haben, aber er muss
sozial abgefedert vonstatten gehen. Wir dürfen keine
Maßnahmen durchführen, die dieses Gleichgewicht
zerstören.
Man sollte sich lieber überlegen, was man ab 2006 macht. Wenn
wir im Februar 2002 nicht in den Begleitausschuss für die
Änderung der Maßnahmen in den Entwicklungsplänen
und des Rahmenplanes in Brüssel kommen, werden wir 2003 die
Mittelverwendung nicht in Angriff nehmen können. Wir haben in
Brüssel nur einmal pro Jahr die Möglichkeit, die
Maßnahme- und Entwicklungspläne zu ändern. Sie
sollen im März 2002 vorliegen, damit wir dann im Jahre 2003
beginnen können. Aber wie Sie gerade gehört haben, haben
wir erst Eckpunkte beschlossen und noch keine verbindlichen
Regelungen. Der Rahmenplan muss aber stehen und verabschiedet sein.
Alle 16 Maßnahmen und Entwicklungspläne müssen
geändert sein. Man darf nicht das Jahr 2003 als Termin sehen,
sondern man muss den Februar 2002 sehen, damit man 2003 etwas
anbieten kann.
Ralf Hägele: Wir befürworten alle
Ansätze zur Unterstützung der Tierhaltungsbetriebe. Bei
der Kofinanzierung habe ich die Befürchtung, dass der Abstand
zwischen den etwas reicheren und den etwas ärmeren
Bundesländern nicht ausgeglichen und sogar größer
wird.
MDg Manfred Buchta: Wenn das Modulationsgesetz ein
nicht zustimmungspflichtiges Gesetz werden sollte, wird es
sicherlich ein Gesetz ohne Freibetrag werden und ein Gesetz, das
den Ländern nicht mehr garantiert, dass das
Modulationsaufkommen auch im Land eingesetzt wird. Wenn der Bund
alleine ein Gesetz verabschiedet, muss er 75,1 % der Kosten
übernehmen. Deshalb wird sich am Geld entscheiden, ob eine
Mehrheit der Länder dies mitträgt oder nicht. Für
Länder, die finanzschwach sind, stellt sich die Frage, ob man
40 % oder nur 24,9 % oder weniger aufbringt.
Ich möchte noch etwas zur Bürokratie sage. Ich war einige
Jahre Zahlstellenleiter. Es ist nicht so, wie es Herr St Griese
dargestellt hat. Die Inanspruchnahme des Freibetrages muss in jedem
Bescheid nachvollzogen werden. Es muss in jedem Bescheid
entschieden werden, wieviel des Freibetrages in Anspruch genommen
wird, und zwar bei jeder Prämie, egal ob Flächen- oder
Tierprämie. Ich muss auch kontomäßig in der
Zahlstelle nachvollziehen, wo der Freibetrag geblieben ist. Ich
muss für jeden Betrieb - in Rheinland-Pfalz sind dies 20.000
bis 30.000 - Freibetragskonten einrichten, um zu belegen, wie der
Freibetrag in Anspruch genommen wurde. Dies ist ein enormer
Verwaltungsaufwand. Diesen zu leisten ist keine Frage der heutigen
Technik. Aber es ist ein enormer Aufwand, der dahintersteckt.
In Rheinland-Pfalz bleibt die Wettbewerbsfähigkeit das Ziel
Nr. 1. Wir richten unsere Maßnahmen so aus, dass
zunächst einmal alles, was der Wettbewerbsfähigkeit
dient, vorrangig weiterbetrieben wird. Da wir bereits ein gutes
Umweltprogramm haben, müssen wir uns neue Programme
überlegen. Rheinland-Pfalz moduliert nach den jetzigen
ausgehandelten Bedingungen 1,3 Mio. DM im Jahr von insgesamt 215
Mio. DM Flächen- und Tierprämien, die in das Land
fließen. In dieser Relation wird deutlich, dass man das ganze
nicht überbewerten soll.
Der Vorsitzende: Dies liegt wahrscheinlich an den
Freibeträgen, die sie haben werden.
MRg Manfred Buchta: Wir haben kleinstrukturierte
Betriebe und 80 % der Betriebe liegen mit ihren Prämien unter
den 10.000 Euro. Also sind lediglich 20 % der Betriebe
betroffen.
Der Vorsitzende: Dann modulieren Sie nur 0,5
%.
MDg Manfred Buchta: Das ist richtig.
Gerrit Steel: Bei dem mid-term review werden viele
Optionen untersucht. Wir legen sehr viel Wert darauf, mit
Modulationspartnern Fragen, wie man z. B. das Modulationsgeld am
besten anwendet, zu besprechen. Wir würden es natürlich
begrüßen, wenn Deutschland als Modulationspartner dabei
wäre.
Werner Kleinhanß: Zur Frage der
Mittelverwendung möchte ich mich zunächst selbst
korrigieren. Ich habe in der Tat Frage drei anders beantwortet als
sich die Ist-Situation darstellt. Bezüglich der
Maßnahmen hinsichtlich Vorruhestand, Ausgleichszulage,
Aufforstung und Agrarumweltmaßnahmen möchte ich den
ersten drei keine so hohe Priorität wie den
Agrarumweltmaßnahmen zuordnen. Herr Griese hat zu Recht
darauf hingewiesen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt,
tierbezogene Agrarumweltmaßnahmen auszuweiten. Faktum ist,
dass die Agrarumweltprogramme überwiegend flächenbezogen
sind. In Brüssel ist in dieser Richtung vieles verhandelbar,
zumindest im Rahmen des mid-term review. Im Bereich tierbezogene
Maßnahmen müssten langfristige und tragfähige
Konzepte erstellt werden. Ich habe mich von dem französischen
Vorgehen leiten lassen, die die Mittel in größere,
umfassendere Programme einbringen und die spezielle Programme
für Rinder und für Milchvieh haltende Betriebe haben.
Dies ist in Deutschland im Rahmen der GAK auch möglich. Die
Programme müssten dann entsprechend weiter gefasst und in
Brüssel umgesetzt werden.
Ich halte nichts von der Herausnahme bestimmter Produktbereiche von
den Prämienkürzungen. Wenn man kürzt, dann muss man
alle Bereiche kürzen. Man kann nicht wegen der wirtschaftlich
ungünstigen Situation für Rinderhalter, insbesondere auf
Grund der BSE-Krise, diesen Bereich ausnehmen. Das hat
Wettbewerbsverzerrungen zwischen Rinderhaltern und anderen zur
Folge.
Die Erste Säule ist so, wie sie bisher besteht, nicht mehr
tragfähig. Die alte Agrarpolitik muss im Hinblick auf
gesellschaftliche Leistungen funktionell stärker ausgestaltet
werden. Dazu gehören die Landwirtschaft im ländlichen
Raum, aber auch die Wettbewerbsfähigkeit.
Wenn man die Modulation national umsetzt, wird man nicht sofort
eine bessere Wettbewerbsfähigkeit haben. Stärkere
Umweltorientierung z. B. wird längerfristig zur Stärkung
der Wettbewerbsposition beitragen, aber kurzfristig wird die
Modulation nicht zur Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Im
agrarpolitischen Kontext spielt die Wettbewerbsfähigkeit eine
ganz entscheidende Funktion. Sie darf nicht vernachlässigt
werden, zumal wir immer mehr versuchen, unsere Märkte in die
Weltmärkte zu integrieren. Dazu sind wir von der WTO her auch
verpflichtet. Ich teile die Meinung der Thüringer Kollegen
nicht, dass Getreide auf dem großen Weltmarkt entsorgt werden
muss. Getreide ist gerade der Bereich, der auf dem Weltmarkt die
beste Wettbewerbsfähigkeit neben den Schweinen hat.
Bezüglich der Verteilungseffekte sind die
Marktfruchtbaubetriebe nach unseren Berechnungen stärker
betroffen. Diese bekommen die meisten Direktzahlungen. Futterbau-
und Veredelungsbetriebe sind weniger betroffen, da sie keine
Direktzahlungen erhalten. Die Erfahrungen zeigen, dass
Verteilungseffekte entstehen.
Adalbert Kienle: Der lateinische Spruch ?carpe
diem? (nutze den Tag), den Herr St Griese angeführt hat, ist
ganz anders zu verstehen. ?Carpe diem? heißt nämlich:
?genieße den Tag?.
Abg. Weisheit hat die Frage gestellt, ob man auf den Freibetrag von
10.000 Euro nicht verzichten kann. Denken Sie aber bitte in
Deutschland an die große Zahl der Kleinstbetriebe und der
Nebenerwerbsbetriebe. Überlegen Sie, ob Sie das
Vorhaben,
diese Kleinbetriebe in die Modulation einzubeziehen, in Ihrer
Partei durchsetzen können. Der DBV befürwortet
ausdrücklich einen Freibetrag. Ich glaube nicht, Herr
Weisheit, dass Sie die Modulation mit den Maßnahmen richtig
verstanden haben. Zum Beispiel ist das Vermarkten, was Sie
angesprochen haben, definitiv nicht vorgesehen für die
Verwendung von Modulationsmitteln. Das Anlastungsthema ist
letztlich für die Länder ein großes Problem.
Auch Frau Höfken hat mich indirekt öfter angesprochen.
Ich meine, dass wir uns keine Verweigerung vorhalten lassen
müssen. Ich erinnere an das Beispiel, was Herr Hauck
vorgerechnet hat. Beim Landwirt wird definitiv das Geld genommen,
aber nur ein Teil kommt wieder zurück. Dies ist die einzig
richtige Rechnung. Deswegen sind wir auch so skeptisch, dies alles
durchzuführen, bevor man überhaupt in Europa
ausführlich darüber diskutiert hat. Auch Kommissar
Fischler sagt über die Modulation, dass man darüber noch
einmal richtig nachdenken muss. Es gibt einfach so viele
Schwachstellen, an denen es nicht funktioniert. Bevor diese Fragen
nicht ausreichend beantwortet sind, hat alles keinen Wert. Die
Modulation bringt nichts für die integrierte Entwicklung
für die ländlichen Räume und für die
Arbeitsplatzentwicklung. Die Modulation ist eine Abkehr von dem
integrierten Ansatz.
Ich möchte noch einmal wiederholen, dass Pionierleistungen,
die bisher vollbracht worden sind, durch die Einführung der
Modulation regelrecht abgestraft werden.
Wir erinnern uns sehr gut, wie lange wir uns vor der
Einführung zum Umschalten von der Markt- und Preisstütze
hin zu direkten Einkommenszahlungen gewehrt haben. Wir befinden uns
jetzt noch im Prozess der Umsetzung, aber global stellt die Politik
dieses wieder in Frage. Dies ist im Sinne von Verlässlichkeit
und Treu und Glauben eine Katastrophe. Die meisten Junglandwirte
lehnen die Modulation ab.
Wir haben in Deutschland in der Ersten Säule ca. 5 Mrd. Euro,
in der Zweiten Säule 2,5 Mrd. Euro. Dies sind neben EU-Geldern
auch Landesmittel. Die Darstellung, dass die Zweite Säule
geringer ist als die Erste, trifft für Deutschland nicht zu.
Vielleicht trifft dies für andere Länder zu. Im
Vereinigten Königreich sind in der Vergangenheit keine Mittel
für die Zweite Säule ausgegeben worden.
Agrarumweltprogramme wurden nicht wahrgenommen. Hier ist ein
gewaltiger Unterschied zwischen der Handhabung in den verschiedenen
Mitgliedstaaten.
Sekr. agri. Arnd Spahn: Ich verweise noch einmal
auf unsere schriftliche Stellungnahme, wo wir insbesondere auf die
Maßnahmen eingegangen sind, die möglich sind und auch
angewendet werden. Die Anwendung der Modulation ist weitgehender,
als dies im Gesetz belegt ist. Dies hat die Anwendung in Frankreich
gezeigt. Die beschriebenen Maßnahmen beziehen sich zum einen
auf den Vorruhestand, der zu hundert Prozent aus den Mitteln der
Modulation finanziert werden kann. Im Bereich der Umweltstandards
und der benachteiligten Gebiete liegen die zwei weiteren
beschriebenen Maßnahmen. Für den Vorruhestand
möchte ich noch einmal deutlich sagen, dass es hier bei einer
flächenweiten Ausdehnung darum gehen wird, einen angemessenen
Beitrag zur Entlastung des landwirtschaftlichen Arbeitsmarktes und
zur Verringerung des Facharbeitermangels in der deutschen
Landwirtschaft zu leisten. Der landwirtschaftliche Arbeitsmarkt ist
auf diese Maßnahme im Besonderen angewiesen, insbesondere, da
die durchschnittlichen und realen Einkommen weder ausreichend noch
anreizend genug sind, um bestehende und künftige Probleme bei
der Anwerbung von jungen Leuten für den Sektor zu mindern. Der
Generationenwechsel ist überfällig.
In Bezug auf die Betriebe möchte ich noch einmal klarstellen,
dass ich mit meinen Aussagen vorhin Betriebe in Frankreich und
nicht in Deutschland gemeint habe. Frankreich sammelt hier ein
Volumen in Höhe von 330 Mio. DM und dies nicht zu Lasten der
Betriebe. Ich bezweifele deswegen Angaben, die hier gemacht worden
sind, dass durch die Modulation das Betriebseinkommen gesenkt wird.
Es gibt bereits bestehende Erfahrungen mit dem Instrument. Der
französische Agrarattaché, der hier im Raum sitzt,
könnte dies entsprechend darstellen. Die Anwendung dieses
Instruments führt nämlich zur Steigerung in den
Betrieben.
Die Art und Weise, wie ein nationales Modell der Modulation
aufgebaut wird, entscheidet, ob in einem erheblichen Maße
zusätzliche Verwaltungskosten entstehen oder möglichst
gering gehalten werden. Unabhängig davon hätten wir mit
der Aufnahme der Modulation in Deutschland ein viertes nationales
Modell und würden unabhängig von der Form, wie das Modell
gewählt wird, eine großartige Bereicherung für die
europäische Diskussion zur Frage der Einführung der
obligatorischen Modulation erhalten.
Im Bereich der Umwelt-, der Sicherheits- und
Qualitätsstandards möchte ich nochmal die
Möglichkeiten beschreiben, die insbesondere auch in Frankreich
angewendet werden. Dies sind Maßnahmen zur Verbesserung und
Umstellung der Erzeugung, Steigerung der Qualität, Erhaltung
und Verbesserung der natürlichen Umwelt, der
Hygienebedingungen und der Tierschutzstandards. Diese
Maßnahmen können mit der jetzigen Regelung der
Modulation, also mit der VO 1259, entsprechend getätigt
werden. Dies sind im großen Umfang keine investiven
Maßnahmen, aber Maßnahmen, die auch dazu beitragen
werden, die neuen Anforderungen, die über die Aufnahme der
Arbeit der Europäischen Lebensmittelbehörde an die
Betriebe herangeführt werden, auch entsprechend aktiv umsetzen
zu können. Es ist sehr spannend, insbesondere in Portugal,
mitzubekommen, wie eine Verknüpfung der künftigen
Anforderungen auf der EU-Ebene im Bereich der Hygiene- und
Sicherheitsstandards mit der Frage der Anwendung des Instruments
der Modulation verbunden wird. Es gibt dort gute Ansätze und
ich freue mich, wenn in Deutschland ein Beitrag gewählt wird,
der diesen Ansatz möglichst zukunftsorientiert aufgreifen
wird, unabhängig davon, dass niemand möchte, dass mit
diesem Instrument nun ein krasser Einschnitt in den Bereich der
Ersten Säule geleistet wird. Ganz im Gegenteil geht man mit
dem Einstieg von nur 2 % mit diesem Modell daran, erst einmal etwas
auszuprobieren, um dann die entsprechenden Wirkungen zu erhalten
und zu überlegen, ob es sachgerecht ist oder ob man
entsprechende Modifikationen vornehmen muss.
Die möglichen Maßnahmen können auch intensiv
für regionale Situationen, wie z. B. in Frankreich geschehen,
genutzt werden. Die regionalen Situationen sind je nach Bundesland
unterschiedlich. Ich erinnere an die Diskussionsbeiträge des
Landes Rheinland-Pfalz zu der Frage ?Integration des Bundeslandes?
bei der Diskussion über BSE und der Verbindung der
landwirtschaftlichen Betriebe zu den Schlachthöfen, die im
Rahmen der Hygiene- und Sicherheitsstandards dazu geführt
haben, dass sich das Bundesland an dieser Frage nicht hat
beteiligen können. Es liegt also besonders in Rheinland-Pfalz
ein ganz konkretes Beispiel vor, die Modulation anzuwenden, um ein
strukturelles Problem, das man aus den laufenden Ausgaben der GAK
nicht finanzieren kann, entsprechend aufgreifen zu können. Es
könnten unterschiedliche Modelle genutzt werden, um nationale
Probleme zu verbessern. Sollte der Bedarf nicht ausreichend
formuliert worden sein, um die Probleme und die Maßnahmen,
derer man bedarf, darzustellen, kann ich Ihnen zusagen, dass die
Arbeitnehmer in Deutschland gerne einen umfangreichen Katalog zur
Lösung von ihnen bekannten Problemen offerieren würden,
der dann entsprechend alternativ für eine solche Liste genutzt
werden könnte. Ich möchte noch einmal betonen, dass im
Bereich der benachteiligten Regionen, insbesondere der
Mittelgebirgslandschaften, bezüglich des Vorruhestandes ein
erheblicher Nachholbedarf besteht. Gerade im Bereich des
Vorruhestandes ist der Nachholbedarf so groß, dass der
landwirtschaftliche Arbeitsmarkt sich zur Zeit in Deutschland der
Nutzung dieses Instrumentes, seinen wirksamen Beitrag zur Senkung
der Arbeitslosigkeit zu leisten, verweigert.
Dr. Volkhard Wille: Agrarumweltprogramme werden in
den verschiedenen Ländern unterschiedlich angewendet. Dies
allein ist aber kein Hinweis auf unterschiedliche politische
Anstrengungen. Denn es gibt auch sehr viele unterschiedliche
naturräumliche Bedingungen, die sich in vielen anderen
Bereichen der Landwirtschaft niederschlagen. Des weiteren gibt es
große Differenzen, was die Inhalte angeht, mit denen
verschiedene Agrarumweltmaßnahmen verknüpft sind. Dies
muss man bei der Differenzierung mit in Betracht ziehen.
Zum Punkt der Zeitschiene möchte ich sagen, dass sich
Umweltverbände häufig den Vorwurf anhören
müssen, dass sie vieles verzögern. Der zeitliche Ablauf
zur Einführung der Modulation ist aber mehr als
großzügig. Ursprünglich war sie sogar ein Jahr
vorher geplant. Auf Grund eines politischen Kompromisses hat man
nun das Jahr 2003 vorgesehen. Ich kann also eine zu hohe
Geschwindigkeit hier nicht erkennen.
Das Prinzip der Modulation wird von uns begrüßt, auch
wenn es bis jetzt nur in einem sehr geringen Maße genutzt
wird. Die Möglichkeiten der Modulation sind auf 20 % begrenzt.
Wenn man nun aber die Modulation auf Grund der zu hohen
Verwaltungskosten schlecht findet, dann wäre die logische
Konsequenz, dass man mehr modulieren müsste, damit sich der
Aufwand lohnt.
Man kann einerseits mit dem System der bisherigen Agrarpolitik
argumentieren oder, wie der NABU es auch tut, versuchen, die
gesamtgesellschaftliche Situation zu sehen und auch die Diskussion
um die Agrarwende und damit zu anderen Schlüssen kommen.
Ursprünglich waren die Ausgleichszahlungen für die
Beschlüsse der Agenda 2000 vorgesehen. Mit zunehmendem Abstand
verlieren aus unserer Sicht die Berechtigungen solcher
Ausgleichszahlungen die gesellschaftliche Legitimation. Im Bericht
der Niederlande ?Zukunft der Landwirtschaft? wird auch auf dieses
Problem hingewiesen. Ausgleichszahlungen werden für einen
kurzfristigen Politikwechsel eingeplant, aber es lässt sich
daraus kein Anspruch auf alle Ewigkeit erheben. Die Agrarpolitik
und die Finanzen müssen so gestaltet werden, dass sie
gesellschaftlich ein hohes Maß an Legitimation haben und
durch dieses höhere Maß auch eine Risikosicherheit
haben.
Abg. Ulrike Höfken: Ein Problembereich ist
noch nicht angesprochen worden, nämlich die Frage der
Freibeträge und die Frage, inwieweit hier Mittel aus den
Haupterwerbsbetrieben den Nebenerwerbsbetrieben zugute kommen. Man
muss sich der Frage stellen, ob dies ein sinnvoller Weg ist. Die
Frage richtet sich an Herrn Buchta und an Herrn Griese, die auch in
ihren Bundesländern davon betroffen sind.
Aus der Diskussion ergibt sich für mich, was die
Verwaltungskostendiskussion anbetrifft, die Konsequenz, dass es,
wie Herr Wille auch bereits angesprochen hat, nicht geraten ist,
irgendwelche Ausnahmen überhaupt einzubeziehen. Dies betrifft
die Freibeträge, die Rinderhalter und alle möglichen
anderen Betriebsgruppen. Da die Verwaltungskosten dann zu hoch
sind, macht das alles keinen Sinn mehr.
Zum Zweiten ergibt sich, dass die Einstiegssumme zu gering ist. Es
würde sinnvoller sein, mit einem höheren Modulationsgrad
einzusteigen, um hier zu vernünftigeren Ergebnissen zu
kommen.
Es wurde gesagt, dass die Erste Säule zu hoch angesetzt ist
und dass sich daraus Verringerungen ergeben. Ich möchte auf
die Gefahr hinweisen, dass dann gekürzt wird ohne eine
Verwendungsmöglichkeit. Dies ist nicht in meinem Sinne.
Abg. Heidemarie Wright: In den verschiedenen
Bundesländern gibt es Unterschiede und jeder hat nur seinen
eigenen Bereich im Kopf. Ich bedauere, dass die Unzufriedenheit in
der Landwirtschaft in Bayern und Baden-Württemberg, wo die
Förderbeträge sehr hoch sind. Wenn jetzt festgestellt
wird, dass dort kein weiterer Bedarf vorhanden ist, dann
möchte ich auf den Bedarf im Bereich der Vorruhestandsregelung
hinweisen. Herr Hauck, können Sie sich vorstellen, dass wir in
den Südländern, in denen man kleine Strukturen hat und
eine Notwendigkeit zum Strukturwandel gegeben ist, positive Akzente
setzen können?
Herr St Griese, Sie haben neun neue Modellbausteine angeführt
und einige Beispiele dazu ausgeführt. Gibt es
Möglichkeiten in der Nutzung neuer Energien in dem Bereich
Landwirtschaft? Die Landwirtschaft produziert neue Energien, nutzt
sie aber nicht in dem Maße, sondern bringt sie auf den Markt.
Können wir in diesem Bereich etwas an
Fördermöglichkeiten erwarten?
Zur Degression möchte ich z. B. Herrn Steel fragen, wie die
Degression in anderen Ländern behandelt wird. Degression ist
meiner Meinung nach notwendig.
Abg. Albert Deß: Herr Spahn, Sie haben so
euphorisch von Frankreich berichtet. Ich habe von
französischen Kollegen gehört, dass in Frankreich ein
heilloses Durcheinander herrscht, was das ganze Programm anbelangt.
Die Anträge werden lange Zeit nicht bearbeitet. Aus der Praxis
wird somit etwas ganz anderes berichtet, als hier offiziell
erzählt wird. Man muss also klären, warum hier so
verschiedene Meinungen vorliegen. Im Übrigen sind die 350 Mio.
DM, die Frankreich für 28 Mio. Hektar ausgibt, weniger als
das, was Bayern im Umweltbereich ausgibt. Die Wirkung ist also sehr
bescheiden gegenüber dem, was man bereits auf Länderebene
in bestimmten Bundesländern gemacht hat, wenn die richtigen
Leute an der Regierung sind.
Herr Dr. Wille, kennen Sie die Untersuchungsergebnisse der
holländischen Universität Wageningen, wie sich
Agrarumweltmaßnahmen auf das Verhalten von Tieren auswirken?
Es gab auch einen interessanten Artikel in der Zeitschrift ?Die
Zeit? vom 25. Oktober 2001, Nr. 45, mit der Überschrift
?Tierische Ignoranten, auch die Viecher müssen sich am
Umweltschutz beteiligen?. Diese wollen aber nicht. Von 260
Tierarten haben 65 die Agrarumweltmaßnahmen nicht positiv
gesehen. Lediglich 103 Tierarten haben diese Maßnahmen
positiv gesehen. Ich möchte dazu ein Beispiel aus meiner
eigenen Landwirtschaft bringen. Die Kiebitze fliegen nicht in die
stillgelegten Flächen hinein, sondern immer in den Acker, wo
Getreide und Raps angebaut wird. Dort fühlen sie sich wohler,
weil die Umwelt der Umwelt überlassen wird. Es wäre
interessant zu erfahren, ob Programme geplant sind, wie Tiere die
Umweltmaßnahmen besser annehmen.
Frau Wright, die Unzufriedenheit der bayerischen Bauern war so
groß, dass 1998 bei 90 % Wahlbeteiligung, 86 % CSU und 6 %
FDP gewählt haben, so dass für rot-grün nicht mehr
viel übrig geblieben ist.
Der Vorsitzende: Es ist klar, dass die hohen
Direktzahlungen so nicht mehr durchzustehen sind. Man muss aber
auch sehen, wie das zustande gekommen ist und dass die
blue-box-Maßnahmen auch nicht der Friedenspflicht
unterliegen. Die blue-box müsste in der WTO nicht verhandelt
werden, aber sie wird sicherlich verhandelt werden. Aber irgendwo
müssen die Bauern ihr Geld verdienen. In einigen Bereichen
gibt es auch regionale Schwierigkeiten. Wenn man die
durchschnittliche Belastung, die man bei Rindern hat, auf alle
Bauern verteilen würde, hätte man nicht die Probleme.
Dies sind regionale Belastungen. Es sind Bereiche und Regionen, die
kaputtgehen.
Der Verwaltungsaufwand wäre bei 10 % Modulation genauso
groß wie bei 2 %. Ich möchte, dass dazu in der
anschließenden Debatte noch etwas gesagt wird.
Modulation führt zumindestens dazu, dass mehr Geld in die
Landwirtschaft hineinkommen kann. Warum haben sich die Länder
und insbesondere Nordrhein-Westfalen geweigert, dass man auf 10 %
der Modulation kommt? Die Antwort hätte ich gern von St Dr.
Griese.
Müsste man nicht darüber nachdenken, dass die
Modulationsmittel in die Gemeinschaftsaufgabe fließen? Wenn
es mehr Anträge gibt als man Modulationsmittel in die
Maßnahmen stecken kann, könnte man umschichten. In der
Gemeinschaftsaufgabe ist es so, dass sie 1 Euro nur einmal ausgeben
können. Umschichten heißt dann, dass man von anderen
Programmen etwas wegnehmen müsste. In Schleswig-Holstein
spielte das keine Rolle, weil dort sowieso 10 % zurückgegeben
worden sind. Aber in Nordrhein-Westfalen, wo viel ausgegeben worden
ist, muss dann zurückgeschraubt und gesagt werden, zu welchen
Lasten in der Gemeinschaftsaufgabe die Ausgaben gehen
würden.
In Rheinland-Pfalz beträgt die Modulation 0,5 %. In Bayern und
Baden-Württemberg werden es auch keine 2 % sein. In den neuen
Bundesländern ist die Kofinanzierung nicht so hoch, weil die
Kofinanzierungsanteile nicht so hoch sind, obwohl dort der
Modulationsanteil wahrscheinlich den höchsten Anteil
beinhaltet. Herr Kleinhanß, sagen Sie mir bitte, wie viel wir
überhaupt modulieren? Wie ist die saisonale Gewichtung der
Modulation und welche Ungleichgewichte gibt es in der
Modulation?
Wenn Sie, Herr Wille, die Modulation auch in diesem kleinen Betrag
so gelobt haben, dann loben Sie an sich die Maßnahmen, die
damit gemacht worden sind. Wo war der NABU bei den
Ungleichgewichten der Finanzierung, z. B. der Umweltprogramme der
Landwirtschaft ohne Modulation? Warum hat der NABU
Baden-Württemberg und Bayern keinen goldenen ?NABU-Strauch?
verliehen und den Niedersachsen z. B. einen ?roten Frosch?? Dies
ist alles nicht konsequent.
In der Bundesrepublik Deutschland bestanden
Vorruhestandsmöglichkeiten. Diese sind völlig ohne
Modulation finanziert worden. Warum Herr Spahn, setzen Sie so auf
die Modulation, um diese Dinge zu finanzieren, wohlwissend, dass
die Konkurrenz von Modulationsmitteln ausgesprochen groß sein
wird? Warum besteht die Forderung nicht auch ohne Modulation? Es
gibt keine Schwierigkeiten, dies national zu finanzieren oder
zumindest national zu begründen.
Adalbert Kienle: Die Modulation kann man nicht
damit begründen, dass die relativen Kosten der Bürokratie
damit gesenkt werden könnten. Je höher der
Modulationsgrundsatz, desto geringer ist die Bürokratie.
Man ging ursprünglich von einer Kürzung bis zu 20 % aus.
So ist man in die politische Diskussion eingestiegen.
Es ist unstrittig, dass zumindest Teile der Politik und der
Öffentlichkeit davon ausgehen, erst einmal mit 2 %
einzusteigen, um dann eine perspektivische Entwicklung zu haben.
Dort hat man dann einen Spielraum bis 20 %. Dies zeigt, dass die
Diskussion über Ausnahmen und Freibeträge schon sehr
früh stattfinden muss.
In der Tat gab es in früheren Jahren eine
Vorruhestandsregelung. Sie war außerordentlich erfolgreich.
Aber sie war auch sehr teuer. Wenn der Vorruhestand jetzt aus
Mitteln der Modulation finanziert würde, also aus Geldern der
aktiven Landwirte, dann wird die Verpflichtung, die bislang der
Gesellschaft und der Staat den Bauern gegenüber hatte,
verlassen.
Ich habe mich über die Frage des Abg. Deß an den NABU
gefreut. Zu unterschiedlichen Zeiten wird auch unterschiedlich
diskutiert. Dies ist auch dem DBV aufgefallen.
Die Diskussion über die Direktzahlungen wird auf lange Sicht
nicht nur in Deutschland, sondern auch in der WTO aufkommen. Wer so
tut, als könnte man die blue-box-Diskussion mit einer
2-%-Modulation aus der Welt schaffen, der geht davon aus, dass
andere, die er anspricht, vom Thema nichts verstehen.
Dr. Volkhard Wille: Die Landesprogramme sind von
dem NABU sehr intensiv bewertet worden, sowohl positiv als auch
negativ. In Nordrhein-Westfalen haben wir dafür gekämpft,
bestimmte Ausgleichszahlungen zu erhalten. Die Situation in den
einzelnen Bundesländern ist sehr unterschiedlich. In der
Vergangenheit waren es Bausteine der jeweiligen
Landesnaturschutzpolitik. Bei der Modulation geht es heute um eine
grundlegende Weichenstellung bezüglich der EU-Agrarpolitik.
Dort sind andere Maßstäbe angebracht.
Wir haben eine fundamental unterschiedliche Situation in den
einzelnen Räumen. Wir sehen die Erfolge in Süddeutschland
und auch in anderen Bundesländern. Wir müssen aber auch
sehen, dass z. B. in einer Mittelgebirgslandschaft die
Landwirtschaft ganz anders strukturiert ist. Dort entwickelt sich
eine umweltgerechte und multifunktionale Landwirtschaft fast von
alleine. An anderen Stellen stellt sich diese Frage sehr viel
schärfer. In Westniedersachsen ergibt sich eine ganz andere
Problemstellung. Dort besteht für die Landespolitik eine ganz
andere Herausforderung. Die Bundesländer bieten Programme an,
diese werden aber nicht wahrgenommen. In anderen Bundesländern
werden Programme von ähnlichem Zuschnitt sehr intensiv
wahrgenommen, weil die ökonomischen Rahmenbedingungen anders
sind. Es ist nicht nur ein Problem der Landespolitik, sondern auch
der Rahmenbedingungen.
Die neue Studie der Universität Wageningen geht im Moment
durch die Presse, weil sie gut in die politische Diskussion passt.
In dieser Studie sind 74 Vergleichsflächen mit
Vertragsnaturschutz, Agrarumweltprogrammen und ohne
Agrarumweltprogramme auf den Erfolg aus biologischer Hinsicht
vergleichen worden. Es ist fraglich, ob der Vertragsnaturschutz
geeignet ist, bestimmte Naturschutzziele zu erreichen. Die
Erhöhung des Vertragsnaturschutzes im Hinblick auf andere
Instrumente des Naturschutzes muss ins rechte Licht gerückt
werden. Es sind einzelne Flächen, die sich in einer intensiv
genutzten Landschaft befinden. Man kann nicht kleinräumig ein
Naturschutzziel erreichen. Wenn man z. B. ein
Feuchtwiesenschutzgebiet entwickeln will, braucht man ein mehrere
hundert Hektar großes Areal. Wenn man aber nur
Vertragsnaturschutz anbietet und eine Fläche davon
extensiviert, dann werden die Ziele nicht erreicht.
Vertragsnaturschutz dauert in der Regel nur fünf Jahre. Wenn
sie in den Intensivregionen in Holland anfangen, nur eine
Fläche mit einem 5-Jahres-Programm zu extensivieren, dann
haben sie auf Grund der hohen Überdüngung in den
Niederlanden erst einmal Negativeffekte. Es dauert eine ganze Zeit,
bis dies herausgewachsen ist und sich die Tier- und Pflanzenwelt
einstellt, die der Naturschutz will. Es ist auch ein Problem, wie
man Vertragsnaturschutz gestaltet. Bestimmte strukturelle
notwendige Veränderungen in Schutzgebieten werden mit dem
Vertragsnaturschutz nicht erreicht. Sie sind aber notwendig, um den
biologischen Erfolg zu haben.
Aus dieser Studie kann man die Schlüsse ziehen, dass man einen
Mix von drei verschiedenen Naturschutzinstrumenten braucht. Dazu
gehören der Vertragsnaturschutz, das Ordnungsrecht und der
Grunderwerb für Kernflächen. Man braucht eine Reform und
Weiterentwicklung des Vertragsnaturschutzes, insbesondere, was die
Laufzeit angeht. Mit Kurzzeitprogrammen wird man in biologischen
Systemen nichts erreichen. Wenn man es schafft, in einem Gebiet
längerfristig zu extensivieren, dann treten die
gewünschten Erfolge ein. Dies ist untersucht worden. Der
Vertragsnaturschutz muss auch noch mit anderen Maßnahmen
kombiniert werden. Alleine bringt er keine Erfolge.
Arnd Spahn: Im Bereich der Agrarumweltprogramme
ist es völlig falsch zu sagen, dass die Landwirtschaft
größter Artenvernichter usw. ist. Wer die Fläche
bearbeitet und verwaltet, hat natürlich auch den
größten Einfluss auf die Fläche. Die
Diskussionsgrundlage ist verlogen. Wer die Natur und die
Fläche nutzt, hat auch Wirkungen auf die Fläche. Man muss
auch die eingewanderten und durch die Landwirtschaft erst
vorhandenen Arten aufzählen.
Zur Situation in Frankreich könnte ich die Meinungen der vier
Mitorganisationen des EFFAT in Frankreich widergeben. Viel besser
könnte dies aber der Agrarattaché, der die gesamte
Situation in Frankreich darstellen könnte.
Der Vorsitzende: Es ist nicht üblich, in
einer öffentlichen Anhörung die
Sachverständigenrunde zu erweitern. Herr Ferret könnte,
wenn er will, schriftlich antworten, und dies könnte dann ins
Protokoll aufgenommen werden.
Arnd Spahn: Zur Frage der Freibeträge muss
man noch einmal deutlich machen, dass das zur Zeit favorisierte
deutsche System ein tief ausgestaffeltes Modulationssystem ist, im
Gegensatz zum britischen Modell, das im Kern kein Modulations-,
sondern ein Degressionssystem ist. Es produziert in der jetzt
gewählten Form entsprechende Mitteltransfers vom Haupterwerb
zum Nebenerwerb. Ob dies in Anbe- tracht der
Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe sinnvoll ist, muss in den
Bundesländern diskutiert werden. Ich führe in
Brüssel die Diskussion, von den Freibeträgen wegzukommen.
Jeder kommt in die Kürzungen der Transferleistungen mit
hinein, hat dann allerdings die Möglichkeit, von den daraus
abgeleiteten Maßnahmen zu partizipieren. Wenn nur einige
einzahlen, können nicht alle davon profitieren. Wenn es zu
einer obligatorischen Modulation kommt, muss man zu entsprechenden
Regelungen kommen, die alle einbeziehen. Alle müssten als
Solidargemeinschaft arbeiten.
Wenn ich die Argumentation der Bauerngelder zum Vorruhestand auf
die deutsche landwirtschaftliche Sozialversicherung übertrage,
dann kommen wir in andere Argumentationszwänge hinein. Es kann
nicht Sinn und Zweck sein, dass im Rahmen der Vorruhestandsregelung
Fehler, die ausschließlich im Sektor selber produziert worden
sind, nun auch noch durch öffentliche Gelder finanziert
werden. Denn die Entwicklung der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer
ist eine Betriebsentscheidung, die auf Grund betrieblicher
Situationen entstanden ist. Es ist eine betriebliche Entscheidung,
ob hier Familienmitarbeiter, Fremdarbeiter oder Facharbeiter
eingesetzt werden. Die Folgen daraus müssen in den Betrieben
gelöst werden. Entweder ist der Einzelbetrieb in der Lage,
über eine betriebliche Vorruhestandsregelung diese Probleme zu
lösen. Dies kann aber auf Grund der Betriebsstruktur nicht
möglich sein. Also muss es über die Summe der Betriebe
gelöst werden. Dies kann über das Instrument der
Modulation finanziert werden, muss aber nicht. Man kann nicht
Vorruhestand und Agrarumweltmaßnahmen regeln. Es müssen
Schwerpunkte gesetzt werden. Ich bin dafür, dass wir in
Deutschland wieder eine Vorruhestandsregelung bekommen. Die
damalige Durchführung des Vorruhestandsgesetzes hat sehr
positive Effekte gehabt. Sie hat den überfälligen
Generationenwechsel im Bereich der Arbeitnehmer massiv
unterstützt und dazu geführt, dass in den Bereichen, in
denen Vorruhestand angewendet wurde, ein erheblicher Transfer im
Bereich der Facharbeiter stattgefunden hat. Es ist eine wesentliche
Entlastung des landwirtschaftlichen Arbeitsmarktes erfolgt. Mit
Auslaufen des Vorruhestandsgesetzes haben wir die Situation, dass
der landwirtschaftliche Arbeitsmarkt im Bereich der Facharbeiter
seinen Beitrag für die allgemeine Entlastung des
Arbeitsmarktes nicht mehr ausreichend leistet. Hier erfolgen
geringere Beiträge zur Entlastung des Arbeitsmarktes. Eine
Vorruhestandsregelung muss wieder eingeführt werden.
Prof. Kleinhanß: Rindermastbetriebe sind bei
intensiver Mast von der Modulation betroffen. Viele
Rindermastbetriebe, vor allem in Bayern, überschreiten die
Freibetragsgrenze. Aber die Krise der Rindermäster kommt u. a.
durch das Auftreten von BSE und dem Tiermehlverbot zustande.
Die Zahl der Prämienbelastung, nach der Sie Herr Vorsitzender
gefragt haben, habe ich nicht parat.
Der Vorsitzende: Mir kommt es darauf an zu wissen,
wie viele Mittel aus nationalen Haushalten aufgewendet werden
müssen.
Prof. Kleinhanß: Zu dieser Frage müsste
man vielleicht die Ländervertreter befragen. Bei den
Betrieben, die betroffen sind, ist es nur ein sehr geringer Betrag
von 10 DM pro ha.
Gerrit Steel: Ich gebe Herrn Kienle fast recht. In
Großbritannien spielten Umweltprogramme eine niedrigere
Rolle. Bis 1997 betrugen die britischen Ausgaben für die
ländliche Entwicklung und Agrarumweltprogramme ein Prozent des
Agrarhaushaltes einschließlich der GAP-Zahlungen. Bis 2006
wird dieser Anteil wegen einer Kombination aus der Agenda 2000, der
kofinanzierten Modulation und einigen staatlichen Beihilfen auf 15
% steigen. Aber wir sind nicht völlig inaktiv auf diesem
Gebiet gewesen. Es gibt einen Streit zwischen uns und den
Niederlanden über die Frage, wer als erste die
umweltempfindlichen Regionen eingeführt hat. Die niedrigen
Ausgaben vor der Agenda 2000 erklären, warum
Großbritannien bei der Verabschiedung der Agenda 2000 so
wenig Finanzmittel für die Zweite Säule zuerkannt bekam.
Großbritannien hat nur 3,5 % gegenüber Frankreich -17 %
- erhalten.
Herr Kienle hat behauptet, dass es, wenn man sehr viel für
diese Dinge in Deutschland tut, keinen Bedarf mehr für die
Modulation gibt. Ich stimme mit ihm nicht überein. Es geht
nicht darum, wieviel man schon hat, sondern darum, wie sich die
Erste Säule langfristig entwickeln wird. Wir sehen die
Modulation als ein hilfreiches Symbol, als ein Zeichen für die
Landwirte, dass sich etwas ändert. Deshalb war es wichtig
für uns, die Modulation nach der Agenda 2000 einzuführen.
Wir sehen es als eine Gelegenheit, zu demonstrieren, dass in der
Frage, welche Güter des Gemeinwohls die EG von den Landwirten
kaufen möchte, ein Umdenken dahingehend stattfindet, dass der
Landwirt nicht mehr exklusiv als Lieferant von Nahrungsmitteln
angesehen wird, sondern seine allgemeinere Rolle in der
ländlichen Gemeinschaft anerkannt wird, und dass mehr und mehr
die Erfüllung wirtschaftlicher und sozialer umweltpolitischer
Ziele im Zentrum steht.
Das Wort Degression ist oft angesprochen worden. Bei diesem Wort
sehe ich einen Erklärungsbedarf über die Terminologie.
Ich habe selber über zeitliche Degressivität gesprochen.
Natürlich ist das nicht dasselbe wie Degression. Es ist die
Frage, ob man die Modulation universal einführt oder z. B. mit
Freibeträgen gestaffelte Zahlungen vornimmt, d. h. eine
diskriminierte Modulation oder eine progressive Modulation. Wenn
das System nicht funktioniert, kann nicht die Modulation das System
verbessern. Das System der Zahlungen von der Ersten Säule
müsste verändert werden.
Es ist nicht der Fall, dass die Queen viele Zuschüsse
erhält. Es gibt mehrere Betriebe, die Zahlungen erhalten. Wenn
man ein differenziertes System einführt, dann schafft man
einen Anlass, eine Ermunterung für die Landwirte.
MDg Manfred Buchta: Der Freibetrag privilegiert
die Nebenerwerbsbetriebe. Jedenfalls im Land Rheinland-Pfalz fallen
Nebenerwerbs- und Zuerwerbsbetriebe nicht unter die Modulation.
Über allem steht das geringe Modulationsaufkommen von 1,3 Mio.
DM. Es werden keine Verschiebungen in den Betriebsformen
eintreten.
Ich kann dem nicht zustimmen, wenn man sagt, dass, wenn die
Verwaltungskosten so hoch sind, man dann den Modulationssatz
erhöhen muss. Wenn ein System zu teuer ist, muss man
darüber nachdenken und muss es abschaffen.
Wenn es zutrifft, dass alles nicht mehr bezahlbar ist, und dass der
Verwaltungsaufwand zu hoch ist, dann gehen wir doch den direkten
Weg. Dann schichten wir den EU-Haushalt aus der Säule I in die
Säule II um. Dann sind auch die politischen
Verantwortlichkeiten ganz klar. Dann benötigt man nicht den
Weg über komplizierte Modulationswege, zumal die Modulation
auch ein Eingriff in die Planungskompetenzen der Länder ist.
Nach den entsprechenden EU-Verordnungen gibt es mehrjährige
Entwicklungspläne der Länder. Dort ist genau
ausgerechnet, wie in sechs bis sieben Jahren die Mittel eingesetzt
werden. Die Entwicklungspläne sind so, dass die
prioritären Maßnahmen enthalten sind und jetzt kommt die
Modulation, die ein Anreizsystem ist, Gelder zu binden. Alle
Länder versuchen jetzt, diese Gelder zu binden, einfach, um
die Gelder zu belegen. Das muss uns als Steuerbürger
nachdenklich stimmen.
Ralph Hägele: Die Freibeträge bringen
uns nichts. Der Beitrag zum Deutschen Bauernverband ist
größer als das, was wir an Freibeträgen
bekommen.
Wir in Deutschland können uns nicht mit der Queen vergleichen.
In Rheinland-Pfalz gibt es 400 Eigentümer und 200
Beschäftigte. Es kommt also darauf an, ob eine
Abschneidegrenze eingeführt wird oder nicht. Wir sind
natürlich flexibel, Betriebe aufzusplitten und neue Betriebe
zu gründen. Degression lehnen wir ab. Wir müssen etwas
für die ländlichen Räume tun. Wir wollen eine
Einkommensquelle nachhaltig für unsere Landwirte sichern. In
unserer Region haben wir tausende Kiebitze, hunderte Rotmelane und
tausende von Graugänsen. Wir wollen aber auch zukünftig
nachhaltig etwas tun. Die nachfolgenden Generationen brauchen
Konzepte.
MDg Joachim Hauck: Laut Zusammenstellung des BMVEL
gibt es im Bund 36,3 Mio. DM Kofinanzierungsmittel und in den
Ländern 24,4 Mio. DM. Dies sind zusammen 61 Mio. DM, bei
Kürzungsmitteln von 105,1 Mio. DM. So war die Hochrechnung
für das Jahr 2003.
Wir halten die Vorruhestandsregelung in diesem Zusammenhang nicht
für eine sinnvolle Maßnahme. Es würde zu
Verschiebungen zwischen den Bundesländern kommen, wenn man es
nur auf die Arbeitnehmer konzentrieren würde. Diese
Verschiebungen sind so nicht akzeptabel. Man hat diese
Möglichkeit verneint, weil sie noch schlechter als die
Agrarumweltmaßnahmen abgeschnitten hat.
Agrarumweltmaßnahmen gibt es nicht erst seit der Agenda 2000.
Bereits im Jahre 1992 ist mit der Verordnung 2078 ein
Agrarumweltmaßnahmenpaket eingeführt worden. Jedes Jahr
hat man von dort, wo zusätzliche Mittel verausgabt worden
sind, Gelder erhalten. Dies ist mit Grundlage für die Mittel,
die jetzt in der Zweiten Säule zur Verfügung stehen. Die
Maßnahme ist immer als eine Ergänzung zum reinen
Preisausgleich gesehen worden. Das Thema Nahrungsmittelversorgung
und Sicherheit kommt nie zur Sprache. Auch dies ist noch für
unsere Gesellschaft etwas wert. Dieses Thema muss weiter behandelt
werden. Agrarpolitik muss das Thema Nahrungsmittelversorgung und
sonstige gesellschaftliche Leistungen beinhalten. Diese Leistungen
in der Landwirtschaft sind zu entlohnen.
Zum Thema Unzufriedenheit der Bauern kommt es darauf an, ob man mit
den Bauern einzeln diskutiert oder in einem Kollektiv. Es kann
nicht sein, dass man den Landwirt moduliert, der pro Jahr zwei
Kühe zur Schlachtung bringt, nur dafür, dass er ein
Stück Grünland hält und die Kulturlandschaft
erhält. Die Probleme, die Nebenerwerbsbetriebe haben, werden
durch die Modulation nicht geändert.
Die Freibetragsregelung ist auch eine soziale Maßnahme.
Artikel 4 der Verordnung 1259 nennt drei Kriterien für einen
Freibetrag. Bei der Mittelverwendung wird Frankreich vorteilhaft
dargestellt. Aber wenn es um Freibeträge geht, diskutieren wir
über Großbritannien. Dies ist verwunderlich.
Auch wir werden nachher unsere Mittel der Modulation in der GA im
Maßnahmen- und Entwicklungsplan ausweisen. Für jeden
Euro Modulationsmittel müssen wir in einer eigenen
Haushaltslinie nachweisen, wofür er verwendet worden ist. Im
Länderhaushalt muss jeder Euro Modulationsmittel
/Kürzungsmittel/ Kofinanzierung in der Verausgabung
nachvollzogen werden können, wo er angekommen ist, für
welchen Betrieb und für welche Maßnahme. Der EU
müssen wir gegenüber nachweisen, dass wir die
Modulationsmittel nur für neue Begünstigte oder für
neue Maßnahmen eingesetzt haben. Intern müssen die
Modulationsmittel genau ausgewiesen werden. Dies macht einen
großen Verwaltungsaufwand aus.
St Dr. Thomas Griese: Wir halten es für
wichtig, dass das Modulationsregelwerk auf alle Betriebe
gleichermaßen angewandt wird. Alles andere würde
zusätzlichen Aufwand machen, um zu differenzieren, ob es ein
Haupt- oder Nebenerwerbsbetrieb ist. Alle müssten sowohl von
der Aufkommensseite her, als auch von der Verwendungsseite
gleichermaßen zahlen, damit alle die Möglichkeit haben,
entsprechende Modulationsbausteine in Anspruch zu nehmen.
Es muss aber zu einem Freibetrag kommen. Dies ist auch unter
sozialen Gesichtspunkten eine sehr wesentliche Frage. Denn der
Freibetrag ist aus der Überlegung geboren, dass diejenigen,
die im Verhältnis mehr tragen können, auch eher eine
Kürzung hinnehmen können als diejenigen, die das nicht
haben.
Die erneuerbaren Energien in das Maßnahmenpaket aufzunehmen,
geht nur über Umwege. Denkbar wäre der Weg über
Agrarumweltmaßnahmen. Wenn die Gülle zunächst in
der Bio-Gasanlage behandelt und damit Bio-Gas erzeugt wird, ist
dies auch ein Beitrag zur umweltfreundlichen Produktion, weil der
Gärrückstand mit weniger Geruchsbelästigungen
auszubringen ist. Man könnte auch im Maßnahmenpaket
Aufforstung darüber nachdenken, wenn man die Aufforstung daran
koppelt, dass die Biomasse Holz dann auch für energetische
Zwecke genutzt wird. Solche Dinge wären vorstellbar.
Der Vorsitzende: Sie dürfen aber keine
Doppelförderung haben.
St Dr. Giese: Das ist klar. Ich müsste eine
Kumulation solcher Fördermittel ausschließen.
Perspektivisch halte ich es für möglich, das
Maßnahmenpaket insgesamt zu erweitern, um damit durch die
Vordertür energetische Maßnahmen zur Nutzung
erneuerbarer Energien zu fördern.
Herr Carstensen, Sie hatten gefragt, ob es wirklich etwas bringt,
wenn man dies alles in die Gemeinschaftsaufgabe packt und damit die
gegenseitige Deckungsfähigkeit hat, weil man den Euro nur
einmal ausgeben kann. Letzteres stimmt natürlich, aber ich
gewinne ein sehr viel höheres Maß an Flexibilität.
In jedem Jahr haben wir innerhalb des großen
Maßnahmenspektrums Gemeinschaftsaufgabe große
Schwankungen gehabt. In diesem Jahr sind nicht besonders viele
Investitionsanträge im Bereich Neubau von Rinderställen
gekommen. In anderen Jahren ist dies anders gewesen. Ob ein
Flurbereinigungsverfahren oder eine Dorferneuerungsmaßnahme
in diesem oder im nächsten Jahr gemacht wird, kann ich dann
entscheiden. Indem ich dies in den Gesamtplafonds
Gemeinschaftsaufgabe hineinbringe, gewinne ich die
Flexibilität, die nötig ist, zumal man nicht wissen kann,
wie viele Landwirte eine bestimmte Agrarumweltmaßnahme
beantragen werden. Die Förderbausteine sind Angebote, die
beantragt werden können.
Der Vorsitzende: Dies widerspricht dem, was Herr
Hauck eben mit der eigenen Abrechnung gesagt hat.
St Dr. Griese: Natürlich muss ich am Ende den
Verwendungsnachweis erbringen. Wenn man die Modulationsbausteine
anbietet, wird es wahrscheinlich mehr Anträge geben, als man
speziell aus Modulationsmitteln bedienen kann. Insofern muss man
den überschießenden Teil aus der Gemeinschaftsaufgabe
mit finanzieren. Am Ende jedes Jahres müssen die Mittel
abgerechnet werden. Die EU erlaubt im Rahmen der Modulation, dass
man einen bis zu dreijährigen Ausgleichszeitraum möglich
macht. Auch das würde die Verwaltung sehr erleichtern, weil
man dann nicht mehr das strikte Jährlichkeitsprinzip
hat.
In Nordrhein-Westfalen betrachten wir die Modulation als das
einzige Instrument. Normale Agrarumweltmaßnahmen, die wir bis
zum Jahre 2006 geplant haben, werden am Ende etwa 100 Mio. DM pro
Jahr bedeuten, die wir ausgeben, ganz unabhängig von der
Modulation. Diese 100 Mio. DM kommen aus EU-, Bundes- und
Landesmitteln. Der Modulationsumfang in Nordrhein-Westfalen
beträgt etwa 8 Mio. DM. Im Verhältnis 100 Mio. zu 8 Mio.
sieht man, dass wir nicht plötzlich mit der Modulation
Agrarumweltmaßnahmen beginnen und dass die Modulation der
allein selig machende Teil wäre. Aber die Modulation ist eine
sinnvolle Erweiterung. Mit dem Instrument Modulation müssen
wir Erfahrungen gewinnen. Es ist besser, jetzt behutsam
einzusteigen, als in ein oder zwei Jahren sozusagen abrupt
einzusteigen.
Den Freibetrag halte ich für sehr wichtig. Im
Meinungsbildungsprozess in Deutschland hat es eine
präjudizierende Wirkung für die Frage, ob später auf
europäischer Ebene ein Freibetrag eingeführt werden wird
oder nicht. Es gibt die englische und die französische
Variante. Deutschland muss sich jetzt positionieren. Wenn sich
Deutschland jetzt nicht positioniert, ist es eine Vorentscheidung
gegen den Freibetrag. Wenn wir jetzt kluge Programmbausteine
präsentieren, dann gestalten wir auch die europäische
Diskussion, wie die Europäische Kommission und die EU nach dem
mid-term review entsprechende Verwendungsmöglichkeiten
zulassen werden. Wir gestalten jetzt die Weiterentwicklung der
Verordnung 1259. Der Einstieg muss aber sehr vorsichtig gemacht
werden. Wenn wir jetzt sofort eine sehr hohe Modulation machen
würden, dann wäre es fraglich, ob alles gleich
funktionieren würde. Auch auf Seiten der Landwirte wird es
erstmal ein vorsichtiges Herantasten geben. Das war bei den
Agrarumweltprogrammen 1992 auch so. Jahr für Jahr hat man sich
herangetastet, um Erfahrungen zu machen und diese dann
auszubauen.
Dr. Breitbarth: Der Eigentümer wird den
Anteil an den Direktzahlungen immer als Verpächter bekommen.
Unabhängig von der Betriebskonstruktion haben auch die
Betriebe in den neuen Bundesländern, die große
Flächenausstattung haben, enorm viele Eigentümer. Wenn
man also über die zeitliche Variante der Degression hinaus
nachdenkt, dann muss man diejenigen berücksichtigen, die von
dem Ertrag der Fläche leben müssen.
Die Freibetragsregelung betrachten wir als eine wesentliche
Legitimation der Modulation überhaupt. Wenn die
Mitgliedstaaten modulieren wollen, muss eines von den drei
Kriterien der Verordnung eingetreten sein.
Wenn man den Vorruhestand der Arbeitnehmer aus der Modulation
finanzieren will, habe ich Bedenken. Ausdrücklich lässt
die Modulation die Verwendung in der Vorruhestandsregelung zu. Aber
Rechtsgrundlage ist die Verordnung und die kennt die
Vorruhestandsregelung nur für Betriebsinhaber.
Der Vorsitzende: Dies ist nicht korrekt.
Dr. Breitbarth: Dann ist dies unsere Lesart. Wir
haben die Anpassungshilfe für ältere Arbeitnehmer. Dies
fällt auch nicht leicht zu finanzieren. Der Gesetzentwurf
sieht die Vorruhestandsregelung nicht vor.
Zur Frage der Einbindung der Verwendungsmittel in die
Gemeinschaftsaufgabe möchte ich sagen, dass die Verwendung in
die Gemeinschaftsaufgabe gehört. Die Flexibilität, die
damit erreicht werden könnte, halte ich für sehr
begrenzt, weil die Rechtstexte der EU ganz klar sagen, dass es
nicht zulässig ist, in einem Jahr eine Maßnahme aus den
Modulationsmitteln zu finanzieren und in einem anderen Jahr nicht.
Das ist ganz stringent anzumelden, welche Maßnahmen mit den
Modulationsmitteln finanziert werden sollen. Wenn sie finanziert
werden, müssen sie durchgängig finanziert werden.
Auch wenn die Modulation über weite Strecken als
Geldbeschaffungsmittel für die Stärkung von
Agrarumweltmaßnahmen gesehen wurde, ist es nicht so, dass die
Bundesregierung Modulationsmittel braucht, um den ökologischen
Landbau zu stärken. Denn diese Maßnahme ist nicht in das
Modulationspaket eingebunden worden. Es liegt schon zur Genehmigung
in Brüssel vor. Es sieht zwar nicht so aus, dass sich die
Kommission damit befassen wird und diese Maßnahme genehmigt,
aber der ökologische Landbau ist zumindest nicht im
Modulationspaket enthalten.
Losgelöst von der Modulation haben wir bei der Genehmigung der
Agrarumweltmaßnahmen eine Maßnahme eingereicht, die
eine gezielte Förderung für den Anbau von Energiepflanzen
vorsah. Dies hat die Kommission als nicht von der Verordnung
gedeckt abgelehnt.
Die Werbung für die Modulation mit der Aussage, dass
zusätzliche Finanzmittel für die Landwirte bereitgestellt
würden, passt nicht zusammen mit der Aussage, dass die
Säule I nicht erhalten werden kann. Das gegenwärtige
Rechtsgeschäft heißt: wenn Modulation, dann muss
hinzugefügt werden. Die Kommission hat die Termininologie
verwendet, dass sie zusätzliche Gemeinschaftshilfen
gewährt. Die Landwirte haben dieses Geld eigentlich schon
verplant, weil sie darauf vertrauen, dass sie es aus den
Direktzahlungen bekommen. Jetzt nehmen wir es ihnen weg, tun etwas
dazu und geben ihnen es für zusätzliche Leistungen
wieder.
Thüringen hat kein Problem mit dem Platzieren des Getreides am
Weltmarkt.
Der Vorsitzende: Das hat Herr Kleinhanß auch
nicht gesagt.
Modulation ist eine Systemveränderung, die in der
Landwirtschaft passiert. Wir werden das Modultionsgesetz am
Mittwoch im Ausschuss beraten und entscheiden. Am Freitag wird dann
die zweite und dritte Lesung im Bundestag stattfinden.
Ich bedanke mich für die vielfältigen
Informationen.
Der Vorsitzende schließt die
Sitzung