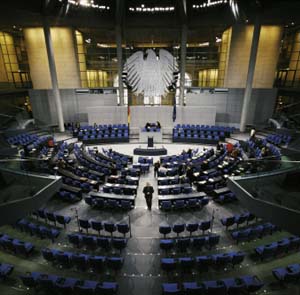Titelthema
Die Vertrauensfrage und die Mehrheit
Die Vertrauensfrage: Im Privatleben kann sie Partnerschaften
weiterbringen oder auch nur eine beiläufige Floskel sein. In
der Politik ist sie alles andere als eine Nebensächlichkeit.
Sie ist das entscheidende Instrument für den Kanzler, sich der
Regierungsmehrheit zu versichern, und im Falle des Scheiterns der
Weg zu vorgezogenen Neuwahlen. Ein Mittel von dramatischer Brisanz
also, und deshalb haben in der Geschichte der Bundesrepublik erst
vier Bundeskanzler vom Artikel 68 des Grundgesetzes Gebrauch
gemacht: 1972 Willy Brandt, 1982 Helmut Schmidt, 1982 Helmut Kohl
und jetzt auch Gerhard Schröder. Wie läuft das Verfahren
im Einzelnen? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein. Was
können die Folgen sein?
|
|
 |
|
Die Formulierungen können verschieden sein. Helmut Schmidt
schrieb am 3. Februar 1982: "Gemäß Artikel 68 stelle ich
den Antrag, mir das Vertrauen auszusprechen." Helmut Kohl schrieb
am 13. Dezember 1982: "Sehr geehrter Herr Präsident, hiermit
teile ich Ihnen mit, daß ich den Antrag gemäß
Artikel 68 des Grundgesetzes stelle." Die Vertrauensfrage von
Gerhard Schröder am 13. November war länger, weil
erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik die Vertrauensfrage
mit einem Sachantrag verbunden wurde: "Sehr geehrter Herr
Bundestagspräsident! In Verbindung mit der Abstimmung zum
Antrag der Bundesregierung ,Einsatz bewaffneter deutscher
Streitkräfte bei der Unterstützung der gemeinsamen
Reaktion auf terroristische Angriffe gegen die USA auf der
Grundlage des Art. 51 der Satzung der Vereinten Nationen und des
Art. 5 des Nordatlantikvertrags sowie der Resolutionen 1368 (2001)
und 1373 (2001) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen' stelle
ich den Antrag nach Art. 68 Abs. 1 des Grundgesetzes."
|
|
 |
|
Vor der Sitzung: 8.00 Uhr
Weil das Grundgesetz eine Frist von 48 Stunden zwischen Antrag
und Abstimmung vorschreibt, wird der Brief des Kanzlers nach seinem
Eingang im Präsidialbüro des Bundestages sofort auf den
Weg durchs Haus gegeben. Das Parlamentssekretariat bringt den Brief
aus dem Kanzleramt in die Form eines ordentlich registrierten
parlamentarischen Vorgangs, der noch am selben Tag in den
Fächern aller Abgeordneten liegt, womit die 48-Stunden-Frist
beginnt.
Die Vertrauensfrage wurde zur Bundestagsdrucksache 4/7440. Die
14 steht für die 14. Wahlperiode des Bundestages, und die
7.440 ergab sich aus der fortlaufenden Zählung der
Drucksachen. Die Vertrauensfrage des Kanzlers war der 7.440.
Vorgang. Seit Beginn dieser Wahlperiode waren bis Mittwoch, 13.
November 2001, 17.28 Uhr, 7.439 andere Anträge,
Gesetzentwürfe, Berichte, Anfragen, Antworten und andere
Vorlagen gedruckt und an die Mitglieder des Bundestages, des
Bundesrates und an die Bundesministerien verteilt worden.
Die Fachausschüsse durchleuchteten unter Federführung
des Auswärtigen Ausschusses die Bereitstellung von
Bundeswehrsoldaten für den Kampf gegen den Terrorismus –
die Sachfrage, mit der der Kanzler seine Vertrauensfrage
verknüpft hatte. Sie befürworteten diese Sachfrage mit
großer Mehrheit, auch der Opposition. Währenddessen
bereitete die Verwaltung die Abstimmung für die Mittagszeit am
Freitag, 16. November, vor. Denn die Vertrauensfrage wurde dieses
Mal nicht mit einfachem Handzeichen entschieden, sondern in
namentlicher Abstimmung.
Sitzungsbeginn: 9.00 Uhr
|
|
 |
|
|
|
 |
|
Damit das genauso schnell wie verlässlich abgewickelt
werden konnte, lagen für jeden Abgeordneten vor Beginn der
Abstimmung drei Plastikkarten in ansonsten verschlossenen Regalen
am Eingang des Plenarsaales bereit: jeweils eine blaue für
"Ja", eine rote für "Nein" und eine weiße für
"Enthaltung". Dazu kam noch ein kleiner gelber Zettel: der
Stimmausweis mit dem Namen des Abgeordneten. Jeder Parlamentarier
trat dann nach Abschluss der Aussprache an eine der drei Urnen,
überreichte einem der Bundestagsschriftführer, die selbst
Abgeordnete sind, seinen Stimmausweis und warf daraufhin seine
"Ja"-, "Nein"- oder "Enthaltung"-Karte in den Kasten. Aus alter
Tradition stehen Parlamentarische Geschäftsführer, also
die Manager des politischen Geschäftes aus den einzelnen
Fraktionen, während der Abstimmung in der Nähe und halten
ihre eigene rote, blaue oder weiße Karte hoch – je
nachdem, worauf sich die jeweilige Fraktion verständigt hat.
Eine letzte Erinnerung für den einzelnen Abgeordneten, bevor
seine Stimme zählt.
Wenn Schulklassen ihren Klassensprecher wählen, kann die
Auszählung der Zettel mit den Namen der Mitschüler schon
einmal etliche Minuten dauern. Selbst wenn die Klasse nur 20 oder
30 Schüler zählt. Bei namentlichen Abstimmungen des
Bundestages geht es nicht um 20 oder 30, sondern um weitaus mehr
Stimmen. In diesem Fall nahmen 662 der 666 Mitglieder des
Bundestages teil. Trotzdem dauert die Auszählung nicht
Stunden, sondern ist immer sehr zügig erledigt. Die Saaldiener
bringen die Urnen in einen Raum unmittelbar neben dem Plenarsaal.
Dort wird deren Inhalt auf einen großen Tisch gekippt, und
sogleich beginnen die Schriftführer damit, blaue, rote und
weiße Karten zu trennen. Schnell sind aus den handlichen
Karten kleine Stapel gebaut, die sich, zu Blöcken
zusammengestellt, schnell durchzählen lassen. Binnen Minuten
wissen die Schriftführer daher, wie die Abstimmung gelaufen
ist.
Diesmal zählten sie noch vor der Bekanntgabe mehrfach nach,
damit nicht bei späteren Überprüfungen das erwartet
knappe Ergebnis hätte korrigiert werden müssen. Die Summe
der Stimmen der 662 teilnehmenden Abgeordneten, der 336 Ja- und 326
Nein-Voten, schrieben die Schriftführer auf ein vorbereitetes
Formblatt ("Das Ergebnis der namentlichen Abstimmung ...") und
brachten es umgehend zum Präsidenten. Um 12.45 Uhr (und damit
elf Minuten nach dem Ende der Abstimmung) erfuhren auf diese Weise
die Volksvertreter und das per Livebericht im Fernsehen
zugeschaltete Volk gleichzeitig, dass der Bundeskanzler weiter das
Vertrauen der Bundestagsmehrheit hat und gleichzeitig die
Bereitstellung von 3.900 Bundeswehrsoldaten für den
Anti-Terror-Einsatz beschlossen wurde.
Doch das war nur der erste Teil der Auszählung. Wesen der
namentlichen Abstimmung ist es ja gerade, von jedem einzelnen
Abgeordneten zu wissen, wie er sich in dieser Frage verhalten hat.
Deshalb tragen alle Stimmkarten neben dem Namen des Abgeordneten
einen maschinenlesbaren Balkencode.
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
So wie im Geschäft die Preise der Einkäufe an der
Kasse blitzschnell per Scanner über die Strichkombinationen
erfasst werden können, "liest" ein Auszählgerät auch
das Votum der einzelnen Abgeordneten aus den Informationen am Rand
der blauen, roten und weißen Stimmkarten ab. Deshalb sind
schon etwa eine halbe Stunde später im Computer die Listen mit
den Namen der zustimmenden, ablehnenden und sich enthaltenden
Abgeordneten abrufbar, gehen an den Präsidenten, an
verschiedene Referate der Bundestagsverwaltung und nicht zuletzt an
die Fraktionen, die wie die Presse ein besonders großes
Interesse an den Details des Stimmverhaltens haben.Die
Vertrauensfrage ist entscheidend für das weitere Schicksal des
Kanzlers und seiner Regierung. Das geht schon aus dem Wortlaut des
Artikels 68 hervor: "Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das
Vertrauen auszusprechen, nicht die Mehrheit der Mitglieder des
Bundestages, so kann der Bundespräsident auf Vorschlag des
Bundeskanzlers binnen einundzwanzig Tagen den Bundestag
auflösen. Das Recht zur Auflösung erlischt, sobald der
Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen anderen
Bundeskanzler wählt." Das bedeutet, dass nicht die Mehrheit
der gerade anwesenden Abgeordneten entscheidet, wie bei den meisten
anderen Beschlüssen des Bundestages, sondern die Mehrheit der
Mitglieder. Das ist die "Kanzlermehrheit".
|
|
 |
|
Abstimmung: 12.25 Uhr
Am Tag der Vertrauensfrage umfasste der Bundestag 666
Mitglieder. Somit betrug die "Kanzlermehrheit" eine Stimme mehr als
die Hälfte, also 333 plus 1 = 334. Möglicherweise
irritiert den einen oder anderen politisch Interessierten, dass
sich diese Zahlen seit den Wahlen zum 14. Bundestag am 27.
September 1998 schon mehrfach geändert haben. Denn das
Parlament zählte bei der konstituierenden Sitzung vor drei
Jahren noch 669 Mitglieder. Der "Schrumpfungsprozess" hängt
damit zusammen, dass die SPD 13 so genannte "Überhangmandate"
erwarb. Das heißt, in dem jeweiligen Bundesland waren mehr
Abgeordnete dieser Partei in ihren Wahlkreisen direkt gewählt
worden, als der Partei nach ihrem Anteil am Zweitstimmenergebnis
eigentlich an Sitzen zustand.
Wenn einer von diesen Abgeordneten aus dem Bundestag
ausscheidet, so rückt für ihn niemand nach. Deshalb hatte
sich in den ersten drei Jahren dieser Legislaturperiode die
Mehrheit der Koalition verringert – von der
ursprünglichen "Kanzlermehrheit" von zehn auf zunächst
sieben Stimmen oberhalb der "Kanzlermehrheit" von 334. Drei
SPD-Abgeordnete waren in der Zwischenzeit ausgeschieden, ein
weiterer von der SPD- zur PDS-Fraktion gewechselt.
Deshalb entfaltete die Zahl von acht Abgeordneten der Koalition,
die den Einsatz der Bundeswehr am Ende von langen Diskussionen noch
ablehnen wollten, am Wochenende vor der Abstimmung eine besondere
Wirkung: Acht waren einer zu viel, um die historische Entscheidung
dieses Bundeswehreinsatzes mit der Mehrheit der
Regierungsfraktionen beschließen zu können. Gerade an
diesem Punkt wollte der Bundeskanzler aber "die politische
Bedeutung klar machen" – und verband ihn mit der
Vertrauensfrage, "weil das wichtig ist für die
Stabilität, auch für das Ansehen und für die
Arbeitsmöglichkeiten einer Koalition, die gut gearbeitet hat
und die nach meinem Urteil auch weiterhin gut arbeiten wird".
Sitzungsende: 12.48 Uhr
|
|
 |
|
|
|
 |
|
Erstmals verknüpfte ein Bundeskanzler auf diese Weise den
Antrag, das Vertrauen auszusprechen, mit einem Sachantrag. Für
den Sachantrag hätte die einfache Mehrheit gereicht, bei 662
an der Abstimmung teilnehmenden Parlamentariern wäre also der
Bundeswehreinsatz bereits mit 332 Ja-Stimmen beschlossen gewesen,
die "Kanzlermehrheit" aber verfehlt worden. Dann hätte der
Bundeskanzler zunächst Zeit für die Überlegung
gehabt, ob er trotzdem weiter regiert, ob er die Vertrauensfrage
erneut stellt, ob er sich von seinem Koalitionspartner trennt und
mit einer Minderheitsregierung weitermacht, ob er sich die
Unterstützung einer anderen Fraktion sucht und mit ihr eine
neue Regierung bildet – oder ob er die Möglichkeiten der
Verfassung ganz ausschöpft und dem Bundespräsidenten
vorschlägt, den Bundestag aufzulösen. Sowohl 1972 (Willy
Brandt) als auch 1982 (Helmut Kohl) hat ein Bundeskanzler diesen
Weg beschritten, um angesichts großer, das ganze Volk
bewegender, Fragen ein neues Votum der Wähler einzuholen.
Die Bundespräsidenten hatten dann jeweils knapp drei Wochen
Zeit zu prüfen, ob die Stabilität einer parlamentarischen
Regierung wirklich auf keine andere Weise durch den Bundestag
gesichert werden konnte – und schlossen sich dem Vorschlag
des Bundeskanzlers an, lösten den Bundestag auf und damit
vorgezogene Neuwahlen aus. Bei Helmut Schmidt und nun bei Gerhard
Schröder brauchte der Präsident nicht einzugreifen: Der
Bundestag bestätigte ja die Regierungsmehrheit aus eigener
Kraft. Insofern trägt selbst die Vorschrift über die
Auflösung des Bundestages dem grundsätzlichen Anspruch
des Grundgesetzes Rechnung, die Lehren aus der instabilen Weimarer
Republik zu ziehen und auch in schwierigen Krisenzeiten stabile
Haltepunkte zu geben.
Text: Gregor Mayntz, Fotos:
Kohlmeier
Der Entschließungsantrag
Der Bundeskanzler hatte die Vertrauensfrage mit dem Antrag der
Bundesregierung verknüpft, deutsche Streitkräfte zur
Bekämpfung des internationalen Terrorismus einzusetzen. Dazu
wurde auch ein Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen
mehrheitlich angenommen.
In Entschließungen wird die Auffassung des Deutschen
Bundestages zu politischen Fragen zum Ausdruck gebracht und/oder
die Bundesregierung zu einem bestimmten Verhalten aufgefordert.
Entschließungen sind rechtlich nicht verbindlich, sondern
allenfalls von politischer Relevanz.
Ein Entschließungsantrag kann nicht selbstständig beim
Bundestag eingebracht werden, sondern muss sich auf eine
vorliegende Initiative wie etwa einen Gesetzentwurf beziehen.
Entschließungsanträge können einem Ausschuss in der
Regel nur überwiesen werden, wenn die Antragsteller nicht
widersprechen. Über sie kann der Bundestag erst abstimmen,
wenn über die zu Grunde liegende Vorlage durch
Schlussabstimmung entschieden ist.