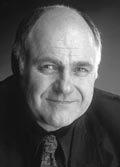STEUERREFORMDEBATTE IM
BUNDESTAG
SPD spricht von einem "Meilenstein in der deutschen
Steuerpolitik"
(fi) Das Steuersenkungsgesetz ist nach
Aussage des SPDAbgeordneten Joachim Poß eines der
größten Steuerreformpakete, das der Bundestag jemals
beraten hat. In der ersten Lesung dieses Entwurfs eines "Gesetzes
zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der
Unternehmensbesteuerung" (
14/2683) sowie der dazu vorliegenden
Alternativkonzepte von CDU/CSU (
14/2688) und F.D.P. (
14/2706) sagte Poß am 18. Februar im
Bundestag, es handele sich dabei um einen "Meilenstein in der
deutschen Steuerpolitik" (siehe auch Berichte auf den Seiten 18 und
19).
Entlastet würden vor allem Arbeitnehmer, Familien mit
Kindern und der Mittelstand, betonte Poß. Der verheiratete
Durchschnittsverdiener mit zwei Kindern werde im Jahr 2005
gegenüber 1998 um über 4.000 DM entlastet. Die
Forderungen nach einer noch größeren Senkung des
Spitzensteuersatzes als bisher vorgesehen nannte der Parlamentarier
eine "einseitige Interessenpolitik für einige gut Besoldete
mit Nebeneinkünften oder für andere Arbeitnehmer mit
Spitzeneinkommen". Poß zeigte sich zuversichtlich, dass das
Reformpaket im Mai beschlossen wird.
Pro und Contra Steuervorschläge der
Koalition argumentierten (von links) Joachim Poß (SPD),
Friedrich Merz (CDU/CSU), Rezzo Schlauch (Bündnis 90/Die
Grünen), Hermann Otto Solms (F.D.P.) und Gregor Gysi
(PDS).
"Mittelstand entlasten"
Auf die Entwicklung des EuroWechselkurses hob Friedrich Merz (CDU/CSU) ab. Der Wert des Euro
sei gegenüber dem des Dollars, aber auch gegenüber dem
anderer Währungen, erheblich gefallen. Die ausgebliebenen
Reformen, auch in der Steuerpolitik, dokumentierten sich in der
Schwäche des Euro, so Merz. Neben den
Körperschaftsteüersätzen müsse auch der
Einkommensteuertarif durchgehend vom Eingangs bis zum
Spitzensteuersatz so gesenkt werden, dass mittelständische
Unternehmen "ohne Hilfskonstruktionen" so entlastet würden wie
große Aktiengesellschaften. Das Regierungskonzept bedeute die
Auflösung der einheitlichen Einkommensbesteuerung und werde
eine "dramatische Verkomplizierung" des Steuerrechts
auslösen.
Rezzo Schlauch (Bündnis 90/Die
Grünen) erklärte, die Steuerzahler würden
alles in allem um mehr als 70 Milliarden DM entlastet. Damit werde
ein Steuersystem auf den Weg gebracht, das den Beziehern kleinerer
und mittlerer Einkommen sowie Familien spürbare finanzielle
Freiräume eröffne. Die Steuerfreiheit von
Beteiligungsveräußerungen gebe dem Strukturwandel den
entscheidenden Schub. Die Firmen würden ihre Beteiligungen
prüfen und oftmals zu neuen Investitionsentscheidungen
kommen.
Nach Ansicht von Hermann Otto Solms
(F.D.P.) muss die Entlastung abgelehnt werden, wenn sie dem
Anspruch, Steuergerechtigkeit zu erzielen, nicht gerecht wird. Das
entscheidende Missverständnis liege darin, dass nach Aussage
von Bundeskanzler Schröder die Unternehmen entlastet werden
müssten und nicht die Unternehmer. Diese Aussage zeige ein
Missverständnis um die Zusammenhänge der Wirkungsweise in
der sozialen Marktwirtschaft. Solms plädierte für einen
Stufentarif bei der Einkommensteuer (15 Prozent für die
Bezieher kleiner, 25 Prozent für die Bezieher mittlerer und 35
Prozent für Bezieher größerer Einkommen).
Für Gregor Gysi (PDS) setzt
sich die Umverteilung von unten nach oben fort. Die
Steuerentlastungen wirkten sich für Rentner, Arbeitslose und
Sozialhilfeempfänger nicht aus, da diese nicht steuerpflichtig
seien. Positiv wertete Gysi die Erhöhung des Existenzminimums
und die Senkung des Eingangssteuersatzes. Dagegen bedauerte er,
dass gleichzeitig auch der Spitzensteuersatz gesenkt werden
soll.
Weg aus der Schuldenfalle
Bundesfinanzminister Hans Eichel
(SPD) hält die Steuerentlastungen für das, was der
Gesamtstaat "bei äußerster Anstrengung" schultern kann.
Mit der Regierungspolitik werde der Weg aus der Schuldenfalle
beschritten. Ziel sei es, bis zum Ende der nächsten
Wahlperiode zu einem ausgeglichenen Haushalt zu kommen. Nur
Großbritannien und Portugal hätten in der EU einen
niedrigeren Spitzensatz bei der Einkommensteuer als Deutschland mit
dann 45 Prozent.
Nach den Worten von Gerda Hasselfeldt
(CDU/CSU) liegt die größte Schwachstelle des
Koalitionsentwurfs in der "Schieflastigkeit" zugunsten der
Großaktionäre und zulasten der Kleinaktionäre.