Stünker-Entwurf mit Mehrheit angenommen
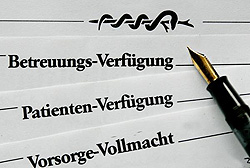
Bundestag beschloss Gesetz zur Regelung von Patientenverfügungen
Der Bundestag hat sich auf eine gesetzliche Regelung von Patientenverfügungen geeinigt. Er beschloss am Donnerstag, 18. Juni 2009, mit einer Mehrheit von 317 Stimmen bei 233 Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen einen Gesetzentwurf der Abgeordneten Joachim Stünker (SPD), Michael Kauch (FDP) und weiterer Parlamentarier, der die Patientenverfügung als Rechtsinstitut im Betreuungsrecht verankert.
Ergebnis der namentlichen Abstimmungen
Der verabschiedete Gesetzentwurf (
16/8442) sieht vor, den Willen des Betroffenen
unbedingt zu beachten, unabhängig von Art und Stadium der
Erkrankung. Festlegungen in einer Patientenverfügung, die auf
eine verbotene Tötung auf Verlangen gerichtet sind, bleiben
unwirksam.
Vormundschaftsgericht muss genehmigen
Besonders schwerwiegende Entscheidungen eines Betreuers oder Bevollmächtigten über die Zustimmung oder Ablehnung ärztlicher Maßnahmen muss das Vormundschaftsgericht genehmigen. Zudem stellt der Entwurf klar, dass niemand dazu verpflichtet werden kann, eine Patientenverfügung zu verfassen.
Zwei weitere Gesetzentwürfe, die mit je eigenen Ansätzen
auf eine gesetzliche Regelung der Patientenverfügung zielten,
wurden abgelehnt. Der Entwurf (
16/11360) einer Gruppe um den Abgeordneten
Wolfang Bosbach (CDU/CSU) hatte strengere formale Bedingungen
für eine Patientenverfügung vorgesehen. Dazu gehörte
unter anderem eine vorangehende umfassende ärztliche
Beratung.
Aktuellen Patientenwillen individuell ermittlen
Der Entwurf der Unionsabgeordneten Wolfgang Zöller und Dr. Hans Georg Faust hatte neben schriftlichen auch mündlich geäußerte Erklärungen als Patientenverfügungen gelten lassen wollen. Doch musste in beiden Fällen immer der aktuelle Patientenwille von Arzt und Betreuer oder Bevollmächtigtem individuell ermittelt werden.
Ebenfalls keine Mehrheit fand ein Antrag (
16/13262) der Abgeordneten Hubert Hüppe,
Beatrix Philipp, Prof. Dr. Norbert Lammert (alle CDU/CSU) und
weiterer Abgeordneter. Sie hatten darin gefordert, eine gesetzliche
Überregulierung der Patientenverfügung zu vermeiden.
"Wir nehmen den Willen von Menschen ernst"
In seiner Rede vor dem Bundestag sagte der SPD-Abgeordnete Christoph Strässer, der Entwurf Stünker/Kauch komme dem Ziel der Selbstbestimmung am Lebensende am nächsten. Seine zentrale Botschaft sei: "Wir nehmen den Willen von Menschen ernst, auch in einer Situation, in der sie nicht mehr selbst entscheiden können."
Der Kernunterschied zum Bosbach-Entwurf sei, dass der festgestellte
Wille des Patienten auch dann gelte, wenn seine Krankheit nicht
unumkehrbar zum Tod führt. Der Entwurf stelle sich damit gegen
eine "Zwei-Klassen-Willenserklärung".
"Feststehende Positionen können sich ändern"
René Röpsel (SPD) verteidigte den Bosbach-Entwurf und verwies darauf, dass "feststehende Positionen von Menschen sich im Laufe ihrer Krankheit ändern können". Eine verpflichtende ärztliche Beratung und eine Beschränkung auf tödlich verlaufende Krankheiten trage dem Rechnung.
Wolfgang Zöller (CDU/CSU) unterstrich die Notwendigkeit eines
Gesetzes, das das Notwendigste regelt: "Vielen Menschen
flößt nach wie vor Angst ein, am Lebensende zum Objekt
einer hochtechnisierten Medizin zu werden." Wichtig sei deshalb,
dass der Wille des Patienten respektiert werde und seine
Verfügung grundsätzlich verbindlich sei.
"Individuelle Betrachtung des Falles"
Dabei gebe es jedoch keinen Automatismus, der sich auf bloße buchstabengerechte Ausführung richte, sondern stets eine "individuelle Betrachtung" des Falles: "Die Vielfalt der denkbaren Situationen entzieht sich einer pauschalen Betrachtung und lässt sich nicht bis ins Detail regeln." Sterben sei nicht normierbar.
Der CDU-Abgeordnete Hubert Hüppe bezweifelte in seiner Rede,
dass ein Gesetz die Situation besser machen würde, als sie
jetzt sei. "Man sollte den Versuch nicht unternehmen, etwas zu
regeln, was nicht zu regeln ist." Die jahrelange Debatte habe
gezeigt, dass Sterben nicht bis in die letzte Minute und schon gar
nicht durch Gesetze regelt werden könne: "Das Parlament hat
sich übernommen".
"Entscheidung auf Augenhöhe mit dem Arzt"
Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen), die für den Bosbach-Entwurf warb, betonte den darin verankerten Dialog zwischen Arzt und den Angehörigen: "Der Arzt soll nicht allein entscheiden, der Bevollmächtigte entscheidet auf Augenhöhe mit dem Arzt."
Der Sprecher für Palliativmedizin der FDP-Fraktion, Michael
Kauch, verwies darauf, dass die Patientenverfügung nur ein
Baustein der Selbstbestimmung am Lebensende sei: "Ebenso
gehören dazu medizinische Versorgung und menschliche
Zuwendung." Mit Blick auf den Bosbach-Entwurf sagte Kauch: "Wir
wollen keine Bürokratisierung des Sterbens, keine
Zwangsbehandlung des Menschen, nur weil Formvorschriften nicht
erfüllt werden."
Bundestagsdrucksachen zum Thema
Weitere Informationen
Zum Thema
Informationsmaterial
- Fakten: Der Bundestag auf einen Blick
- Stichwort: Der Deutsche Bundestag



