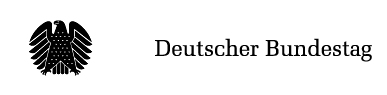|
13/1: Schutz des Menschen und der Umwelt
– Ziele und Rahmenbedingungen einer nachhaltig
zukunftsverträglichen Entwicklung
(aus Einsetzungsantrag Drs.
13/1533):
Die Enquete-Kommission setzt die Arbeiten der Enquete-Kommission
„Schutz des Menschen und der Umwelt –
Bewertungskriterien und Perspektiven für
umweltverträgliche Stoffkreisläufe in der
Industriegesellschaft“ [12. Wahlperiode] zu Leitbildern und
Entwicklungspfaden für die zukünftige
Industriegesellschaft fort. Um eine nachhaltig
zukunftsverträgliche Entwicklung zu ermöglichen, ist es
notwendig, entsprechende ökonomische, ökologische und
soziale Rahmenbedingungen zu erarbeiten, sowie deren
Umsetzungsmöglichkeiten im nationalen und internationalen Raum
zu überprüfen.
Der Deutsche Bundestag beauftragt die Enquete-Kommission,
folgende Schwerpunkte zu bearbeiten:
-
Erarbeitung von Umweltzielen für eine nachhaltig
zukunftsverträgliche Entwicklung
Im Zuge einer Orientierung von Wirtschaft und Gesellschaft am
Leitbild „Sustainable Development“ ist ein
Strukturwandel im Wirtschafts- und Gesellschaftssystem
erforderlich.
Die Bedingungen für eine nachhaltige Entwicklung
können nicht benannt werden, ohne die Frage nach den
Randbedingungen dieser Entwicklung zu klären. Einerseits
können Umweltziele nur unter Berücksichtigung der
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen formuliert
werden. Andererseits können soziale und wirtschaftliche Ziele
nicht ohne Rücksicht auf ökologische Auswirkungen
erreicht werden. Die Entwicklung neuer Konzepte und Strukturen wird
oft notwendig sein.
Die Begrenzung des Eintrages von Schadstoff in die Umwelt und
von klimaschädlichen Emissionen sind wesentliche
Voraussetzungen, um eine nachhaltig zukunftsverträgliche
Entwicklung zu erreichen. Dem umfassenden Anspruch des Leitbildes
folgend sind nicht nur die regional begrenzten unerwünschten
Auswirkungen auf das Ökosystem zu betrachten, sondern auch die
globalen Wirkungen.
Im Hinblick auf die Ausgestaltung nationaler Ziele wie auch der
Maßnahmen zu ihrer Erreichung müssen daher die
Möglichkeiten zur internationalen Ausweitung
berücksichtigt werden.
Um Maßstäbe für die Umweltpolitik zu erhalten,
sind folgende Arbeiten zu bewältigen:
- Bestandsaufnahme der Umwelt unter besonderer
Berücksichtigung der Quellen und der Senken belastender
Stoffe,
- Identifikation von konkreten Problemfeldern und
Stoffströmen,
- Fortentwicklung übergeordneter Bewertungskriterien
für den Umgang mit Stoffen, besonders bei umweltoffener
Anwendung,
- Normative Festlegung von Umweltzielen und
Umweltqualitätszielen,
- Erarbeitung von Grundlagen für einen nationalen
Umweltplan.
-
Erarbeitung ökonomischer und sozialer Rahmenbedingungen
für eine nachhaltig zukunftsverträgliche
Entwicklung
- Zur Erarbeitung ökonomischer und sozialer
Rahmenbedingungen sind folgende Schritte notwendig:
- In einem ersten Schritt müssen die Anpassungs- und
Leistungsfähigkeit des bestehenden Systems einer sozialen
Marktwirtschaft und des bestehenden sozio-kulturellen Systems
analysiert und beschrieben werden. Die Grenzen ihrer
Wandlungsfähigkeit im Rahmen einer nachhaltig
zukunftsverträglichen Entwicklung müssen
herausgearbeitet, Mindestanforderungen zur nachhaltigen Sicherung
der Stabilität dieser Systeme gegebenenfalls definiert
werden.
- In einem nächsten Schritt gilt es, die Wechselwirkungen
zwischen den sozio-ökonomischen Aspekten und Rahmenbedingungen
auch in Verbindung mit den ökologischen Zielsetzungen
darzustellen.
- Schließlich geht es um die Analyse der
sozio-ökonomischen Systeme im Hinblick auf ihre fundamentalen
Steuerungsprinzipien und -mechanismen. Dabei ist zu untersuchen,
wie sich die Prinzipien der Marktsteuerung, Vertragsfreiheit,
Eigentumsordnung sowie die Vorstellungen von Freiheit und
Gerechtigkeit an das Leitbild anpassen lassen.
-
Notwendigkeit gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und
technischer Innovationen
Eine nachhaltig zukunftsverträgliche Entwicklung ist nur
durch einen Wandel zu erreichen, der neben technischen auch soziale
und gesellschaftliche Innovationen umfasst.
Die Umsetzung des Leitbildes »Sustainable
Development« kann letztlich nur durch das Zusammenwirken
aller Akteure auf Basis eines entwickelten Problembewusstseins
gelingen.
Es ist daher nötig:
- Strategien zur Förderung neuer, ressourcenschonender und
schadstoffvermeidender Verfahren, Produkte und Strukturen zu
entwickeln,
- Szenarien zur Erreichung des übergeordneten Leitbildes
einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung im
internationalen Rahmen zu entwickeln,
- Schwerpunktsetzungen im Bildungsbereich zur Vermittlung des
Leitbildes und der zu seiner Verwirklichung erforderlichen
Qualifikationen vorzunehmen,
- innovationsfördernde Rahmenbedingungen in Kultur und
Gesellschaft zu verbessern,
- die Einflussfaktoren auf das Handeln und Verhalten von
Konsumenten und Produzenten im Hinblick auf die individuelle
Umsetzung von Umwelteinstellungen zu analysieren,
- den notwendigen Wandel zur Umsetzung des Leitbildes und die
damit einhergehende Neubewertung von Werthaltungen, Einstellungen,
Konsummustern und Lebensstilen auf Basis der gesellschaftlichen
Ziele und vorhandener Erfahrungswerte zu beschreiben.
-
Maßnahmen zur Umsetzung einer nachhaltig
zukunftsverträglichen Entwicklung
Zur Wahrnehmung seiner Aufgabe, geeignete Rahmenbedingungen
für gesellschaftliche, wirtschaftliche und technische
Innovationen zu schaffen, stehen dem Staat verschiedene
Möglichkeiten zur Verfügung, die im Sinne der aus dem
Leitbild abgeleiteten gesellschaftlichen Ziele entworfen,
umgestaltet, ergänzt oder kombiniert werden müssen. Im
Lichte der Knappheit der Umwelt und anderer Güter ist die
Frage zu klären, auf welche Weise bislang von der
Allgemeinheit getragene nachteilige Effekte am besten
verursachergerecht in interne Kosten überführt werden
können.
Dabei sind folgende Bereiche verstärkt zu behandeln:
- Überprüfung und Weiterentwicklung des
umweltpolitischen Instrumentariums:
- Vorschläge zur verbesserten Anpassung ordnungsrechtlicher
Bestimmungen an die Anforderungen und Möglichkeiten eines
betriebs- und medienübergreifenden Umweltschutzes,
- Untersuchung und Bewertung der Einsatzmöglichkeiten
ökonomischer Instrumente in einer sozialen und
ökologischen Marktwirtschaft anhand konkreter Beispiele aus
verschiedenen Bereichen (Abgaben, Steuern [z. B.
„ökologische Steuerreform“], Zertifikate,
Haftungsrecht etc.),
- Überprüfung der Möglichkeiten zur Förderung
informatorischer Instrumente und freiwilliger Maßnahmen
(Umweltmanagementsysteme, Öko-Audit, Ökobilanzen,
Environmental Performance Evaluation, Responsible Care, etc.),
- Überprüfung bzw. Neubewertung staatlicher Einnahmen
und Ausgaben auf ihre Umweltwirkung,
- Darlegung der ökologischen Folgen von
Gesetzesvorhaben,
- Weiterentwicklung der Methodik des Stoffstrommanagements unter
besonderer Berücksichtigung diskursiver und kooperativer
Vorgehensweisen,
- Diskussion darüber, wie Instrumente einzeln oder in
Kombination eingesetzt werden können, um konkrete Umweltziele
treffsicher und effizient zu erreichen (Untersuchung an konkreten
Beispielen aus verschiedenen Bereichen).
|
|
13/2: Demographischer Wandel –
Herausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den
Einzelnen und die Politik
(aus Einsetzungsantrag Drs.
13/1532):
Die Enquete-Kommission setzt die Arbeiten der Kommission der 12.
Legislaturperiode fort. Die Aufgaben sollen sich grundsätzlich
an den Empfehlungen im Zwischenbericht – Drucksache
12/7876 – orientieren.
Folgende Themenschwerpunkte sollen behandelt werden:
- Wandel familialer und außerfamilialer Strukturen, Aufbau
von Hilfs- und Helferstrukturen,
insbesondere
- die finanzielle Situation von Familien und der Wandel der
Familienstrukturen und -beziehungen über den Lebenslauf
(Lebensphasen),
- die Tragfähigkeit und Belastbarkeit von Freundschafts- und
Nachbarschaftsbeziehungen im fortschreitenden Alter (unter
Berücksichtigung der besonderen Situation ausländischer
Familien und älter werdender Behinderter),
- Möglichkeiten und Grenzen zur Stärkung und
Förderung außerfamilialer Netze und neuer gemeindenaher
Hilfs- und Helferstrukturen.
- Arbeitsmarktentwicklung und Innovationsfähigkeit der
Gesellschaft,
insbesondere
- die Konsequenzen einer steigenden Erwerbsbeteiligung auf die
Arbeitsnachfrage unter Berücksichtigung der Kommerzialisierung
bisheriger weitgehend unentgeltlicher Tätigkeiten,
- die Zusammenhänge zwischen einer älter werdenden
Gesellschaft und ihrer Innovationsfähigkeit unter
Berücksichtigung der Situation von Erwerbspersonen in der und
Konsequenzen für die Weiterbildungspraxis in der zweiten
Lebenshälfte,
- das Spannungsfeld zwischen den steigenden Arbeitslosenquoten
und der Frühverrentung sowie nachberuflichen
Tätigkeitsfeldern älterer Menschen.
- Soziale Sicherungssysteme,
insbesondere
- konkrete institutionelle Maßnahmen in verschiedenen
Bereichen der sozialen Sicherungssysteme sowie Möglichkeiten
einer Angleichung von Leistungsstrukturen,
- Auswirkungen des demographischen Wandels auf die verschiedenen
sozialen Sicherungssysteme und Möglichkeiten der Abfederung
von negativen Folgen.
- Situation der älteren Ausländer,
insbesondere
- ihre Lebensbedingungen,
- ihre Zukunftsperspektiven im Prozess des demographischen
Wandels.
- Für alle Schwerpunktthemen gilt:
- Die Datenlage sollte auf einen Zeitraum über das Jahr 2030
hinaus ausgedehnt und mit berücksichtigt werden,
- die europäische Dimension sollte – wo immer
möglich und sinnvoll – in den einzelnen Kapiteln mit
eingebracht werden,
- regionale Aspekte (z. B.
bezogen auf die neuen Bundesländer) sollten – wo
möglich und sinnvoll – in den einzelnen Themenkreisen
mit eingebracht werden.
|
|
13/3: Überwindung der Folgen der
SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit
(aus Einsetzungsantrag Drs.
13/1535):
Die Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und
Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ hat in der 12.
Legislaturperiode des Deutschen Bundestages grundlegende
Beiträge zur politischen, historischen und moralischen
Bewertung der zweiten Diktatur auf deutschem Boden geleistet. Sie
hat sich große Verdienste um die gesellschaftliche
Aufarbeitung von vier Jahrzehnten DDR-Vergangenheit erworben und
wird ein wichtiges Zeugnis dafür bleiben, wie sich der
Deutsche Bundestag und die politische Öffentlichkeit in den
ersten Jahren nach der Vereinigung dieser Herausforderung gestellt
haben. Die Mitwirkung der Enquete-Kommission am Prozess der inneren
Einigung Deutschlands hat – im In- und Ausland – eine
starke öffentliche Beachtung gefunden und ein
vielfältiges Echo ausgelöst.
[…]
Die Enquete-Kommission hat die folgenden Aufgaben:
- Sie soll, aufbauend auf den Ergebnissen der
Vorgängerkommission, Beiträge zu einer
politisch-historischen Analyse und einer politisch-moralischen
Bewertung der SED-Diktatur leisten, den gesamtgesellschaftlichen
Aufarbeitungsprozess fördern und für die Zukunft
Vorschläge für seine Weiterführung machen. Dabei
wird zu prüfen sein, ob dafür nicht auch zusätzliche
institutionelle Mittel, z. B. im Rahmen einer Stiftung, zu schaffen
sind. Das Erkenntnisinteresse der Kommission richtet sich
insbesondere auf die äußeren und inneren Folgen und
Nachwirkungen der SED-Diktatur und die daraus erwachsenden Probleme
für den Prozess der inneren Einigung.
- Die Enquete-Kommission soll zur Festigung des demokratischen
Selbstbewusstseins, des freiheitlichen Rechtsempfindens und des
antitotalitären Konsenses in Deutschland beitragen und allen
Tendenzen zur Verharmlosung und Rechtfertigung von Diktaturen
entgegenwirken. Dafür ist die Entwicklung gesamtdeutscher
Formen der Erinnerung an die beiden deutschen Diktaturen und deren
Opfer wichtig. Die Erinnerung an die Opfer von Unrecht und Gewalt,
an Widerstand und Mut in den Diktaturen sowie den Prozess der
Ablösung der SED-Herrschaft 1989 soll für das
öffentliche Bewusstsein und die nationale Kultur wach gehalten
werden. Gleichzeitig müssen die seinerzeit in beiden deutschen
Staaten entwickelten unterschiedlichen Formen und Inhalte der
Würdigung des Widerstands gegen den Nationalsozialismus sowie
die Instrumentalisierung des Antifaschismus als
Legitimationsideologie in der SBZ/DDR bedacht werden. In diesem
Zusammenhang soll die Kommission unter Berücksichtigung der
bestehenden Bund-Länder-Absprachen Vorschläge zu einer
umfassenden Gedenkstättenkonzeption unterbreiten.
- Die Enquete-Kommission soll helfen, dass sich die Menschen mit
ihren unterschiedlichen Biographien im Einigungsprozess besser
wiederfinden. Damit soll sie zur Versöhnung in der
Gesellschaft beitragen, begründet auf dem Willen zu Offenheit,
zu historischer Wahrheit und
zu gegenseitigem Verständnis.
Die personelle Würde der von Unrecht und Leid Betroffenen muss
wiederhergestellt werden.
Dazu gehört sowohl die öffentliche Würdigung der
Opfer wie die Notwendigkeit, ihnen, wo irgend möglich,
nachträglich Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. So wird
Gegenstand der Enquete-Kommission sein zu prüfen, inwiefern
heute in diesen Fragen aus der Sicht der Opfer Defizite bestehen
und wie dem durch die Gesetzgebung abgeholfen werden kann. Ferner
ist zu prüfen, ob und inwiefern es heute noch einen
politischen Handlungsbedarf in der Frage gibt, wie mit den
Verantwortlichen des Systems und ihren Helfern umgegangen werden
soll. In diesem Zusammenhang wird sich die Kommission auch den
Problemen der justitiellen Aufarbeitung der SED-Diktatur
zuwenden.
- Die Enquete-Kommission greift aktuelle anstehende Fragen auf
und erarbeitet politische Handlungsempfehlungen. Sie wird bei ihrer
Tätigkeit Schwerpunkte setzen müssen. Sie soll sich
exemplarisch solchen gesellschaftlichen Problemfeldern zuwenden, in
denen vor dem Hintergrund von 40 Jahren SED-Diktatur und deutscher
Teilung heute konkretes politisches Handeln besonders nötig
erscheint. Dazu gehören die Würdigung von Leistungen der
Menschen unter den repressiven Bedingungen in der DDR ebenso wie
der Ausgleich von Nachteilen und die Herstellung von
Chancengleichheit im vereinten Deutschland.
Die Kommission widmet sich insbesondere folgenden Themenfeldern,
wobei den ideologischen Grundlagen und den repressiven Strukturen
besondere Beachtung zuteil werden soll:
A. Bildung, Wissenschaft, Kultur
- Ziele und Methoden des ideologischen Einflusses der SED.
- Militarisierung der Gesellschaft und Bedeutung von
Feindbildern.
- Folgen der Durchdringung dieser Bereiche durch das Ministerium
für Staatssicherheit.
- Möglichkeiten der Gestaltung von Lebensräumen unter
dieser und trotz dieser Beeinflussung.
- Fortwirkung von Strukturen und Inhalten des Erziehungswesens,
der Jugendpolitik sowie in Wissenschaft, Kunst und Kultur in der
DDR sowie ihre Bewertung im Transformationsprozess.
- Welche Herausforderungen ergeben sich aus der Bilanz für
die heutige Politik in diesen Bereichen?
B. Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik
- Strukturen der sozialistischen Planwirtschaft und deren Bilanz
am Ende der 80er Jahre.
- Sozialpolitik und soziale Situation in der DDR: Anspruch und
Wirklichkeit.
- Umweltbilanz der SED-Diktatur.
- Die außenwirtschaftlichen Beziehungen der DDR.
- Folgerungen für den wirtschaftlichen
Transformationsprozess.
C. Das geteilte Deutschland im geteilten Europa
- Die Einbindung der beiden deutschen Staaten in die beiden
Blöcke und die Frage nach der Möglichkeit
selbständiger politischer Entscheidungen in der DDR und in der
Bundesrepublik Deutschland.
- Die Westarbeit der SED und des Ministeriums für
Staatssicherheit.
- Die Ostpolitik der Bundesregierung und der Parteien.
- Die wirtschaftlichen und finanziellen
Ost-West-Beziehungen.
- Die gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen
Ost-West-Kontakte.
- Verfolgung von Andersdenkenden in der SBZ/DDR.
- Die Bedeutung der Menschenrechte für die internationale
Politik.
- Welche Folgerungen ergeben sich für die Politik des
vereinten Deutschlands gegenüber Gesamteuropa und im Umgang
mit diktatorischen Regimes?
|
|
13/4: Zukunft der Medien in Wirtschaft und
Gesellschaft – Deutschlands Weg in die
Informationsgesellschaft
(aus Beschlussempfehlung und Bericht Drs.
13/3219):
Der Deutsche Bundestag beauftragt die Enquete-Kommission,
insbesondere die folgenden Schwerpunkte zu untersuchen:
- Technologie und Infrastruktur
- Technologische Entwicklung im Bereich der Netze, Dienste und
Anwendungen (Hard- und Software)
- Gestaltungspotentiale der Technik zur Unterstützung von
Entwicklungs- und Produktionsprozessen in den Bereichen
Dienstleistungen, Industrie und Handwerk
- Anforderungen an die Gestaltung der Informationstechnologien
aus Sicht der Endnutzer
- Infrastrukturelle Voraussetzungen (staatlich und privat) zur
Nutzung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien
- Modellanwendungen und Pilotprojekte im staatlichen,
gesellschaftlichen, unternehmerischen
und privaten Bereich.
- Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Umwelt, Verkehr
- Informations- und Kommunikationstechnologien als Katalysator
für die volkswirtschaftliche Dynamik; Auswirkungen der
Informationstechnologien auf die internationale Arbeitsteilung, auf
Güter-, Finanz- und Dienstleistungsmärkte sowie
Konsequenzen für die internationale Wettbewerbsfähigkeit
des Standorts Deutschland
- Auswirkungen auf den Strukturwandel in Deutschland (sektoral,
regional, betriebsbezogen), Entstehen neuer und Verlust alter
Arbeitsplätze und die sich daraus ergebenden
wirtschaftspolitischen Konsequenzen
- Qualifikation und Dequalifikation (Höherqualifizierung
durch die neuen Technologien, relativer Bedeutungsverlust manueller
Tätigkeiten und zunehmende Nachfrage nach Steuerungs- und
Überwachungstätigkeiten, Entwicklungen in der
Arbeitswelt)
- Internationale Zusammenarbeit und Allianzen im Informations-
und Telekommunikationsbereich; Wettbewerb und Konzentration
- Möglichkeiten zur Beschleunigung des Technologie- und
Wissenstransfers in der Gesellschaft
- Zugangsmöglichkeiten vor allem für kleine und
mittlere Unternehmen zu den modernen
Telekommunikationsinfrastrukturen und -diensten sowie zu den
öffentlichen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen
- Veränderungen innerhalb von Unternehmen und
öffentlicher Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) und
deren Auswirkungen auf Arbeitsmarkt, Arbeitsplätze und
Arbeitsrecht
- Arbeitsbedingungen, soziale Sicherheit und Arbeitsschutz
(insbesondere Fragen der Mitbestimmung und Betriebsverfassung),
Arbeitsrecht (z. B. Auswirkungen durch Individualisierung von
Arbeitsverhältnissen und geographische Trennung von Arbeitsort
und Unternehmen durch Telearbeit)
- Neue Verkehrssysteme, Steuerung der Verkehrsströme (z. B.
Einführung von Telematik-Lösungen zur Vernetzung der
Verkehrsträger, Verkehrsmanagement-Systeme, moderne
Verkehrsdienstleistungen)
- Entlastung der Umwelt und neue Umweltbelastungen durch moderne
Kommunikationstechnologien (z. B. Telearbeit, Satellitenbüros,
Telekonferenzen, Tele-Learning, Tele-Shopping, Entsorgung
elektronischer Altgeräte)
- Bedeutung und Chancen der Informationstechnologien im privaten
Sektor sowie im ländlichen Raum, Konsequenzen für die
räumliche und zeitliche Zuordnung von Wohnen, Arbeiten,
Einkaufen, Freizeit
- Rahmenbedingungen für Unternehmensgründungen
- Bildung und Ausbildung
- Entstehen neuer Ausbildungsberufe, Ausbildungsinhalte und
Beschäftigungsfelder in Industrie, Handel und Dienstleistungen
in qualitativer und quantitativer Hinsicht und sich daraus
ergebende Konsequenzen für das Bildungssystem
(zusätzlicher Fortbildungsbedarf)
- Anwendungen und Wirkungen der neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien im Bildungsbereich (Schule, berufliche
Ausbildung, Hochschule, Erwachsenenbildung, Fort- und
Weiterbildung)
- Schicht-, geschlechts- und altersspezifische Nutzung der neuen
Medien
- Medienerziehung in Schule, Hochschule und in der
außerschulischen Bildung und Ausbildung; Erwerb von
Medienkompetenz
- Erziehung zu mündigen Teilnehmern der
Informationsgesellschaft (Stärkung der Anwender, Schutz vor
Desorientierung und Falschinformation)
- Gesellschaft: Kultur, Demokratie, Meinungsvielfalt
- Auswirkungen auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
für beide Geschlechter (Telearbeit, Telekonferenzen), auch
durch Schaffung zeitlicher Freiräume (Teleeinkauf,
Tele-Banking)
- Gewährleistung von Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt,
Verhinderung demokratiegefährdender Machtkonzentration.
Die Enquete-Kommission soll – unabhängig von und
zusätzlich zu aktuellen Gesetzgebungsverfahren – auf
Basis ihrer Untersuchungsergebnisse den staatlichen
Handlungsbedarf, national und international, insbesondere auf
folgenden Feldern benennen:
- Angemessener ordnungspolitischer und rechtlicher Rahmen
für die Informationsinfrastruktur, Dienste und Anwendungen
(national, international und im
Bund-Länder-Verhältnis)
- Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen, damit die neuen
Informations- und Kommunikationstechnologien in Deutschland
für die Aus- und Fortbildung, den Umweltschutz, die
Raumordnung, die kulturelle Entwicklung und die politische
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung optimal genutzt werden
können
- Beseitigung von staatlichen Regelungen, die den Einsatz der
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien hemmen
- Liberalisierung und weltweite Öffnung der Netze und
Dienste im Bereich der Telekommunikation, so dass ein
funktionsfähiger Wettbewerb entsteht und kleine und mittlere
Unternehmen eine faire Marktchance erhalten
- Normen und Standards als Grundlage der Verbreitung und des
Wettbewerbs der neuen Medien
- Sicherung eines funktionsfähigen Wettbewerbs zur
Vermeidung marktbeherrschender Stellungen einzelner Unternehmen und
eines ungehinderten Zugangs zu den neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien (z. B. Entgelte, Lizenzen, Netzzugang,
Wegerechte, Nummernverwaltung, Tarifstrukturen auch für
Online-Dienste für Geschäfts- und Privatkunden)
- Maßnahmen zur Stärkung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, damit in
Deutschland möglichst viele neue, wettbewerbsfähige
Arbeitsplätze entstehen können und soziale Flankierung
dieses Strukturwandels
- Sicherung von Meinungsvielfalt und Informationsfreiheit
- Sicherung einer flächendeckenden und preisgünstigen
Informationsgrundversorgung als Voraussetzung für eine
angemessene Teilhabe am öffentlichen und politischen Leben,
insbesondere in den Bereichen Information, Bildung und Kultur, um
einen diskriminierungsfreien Zugang zu ermöglichen
- Vermittlung von Medienkompetenz
- Technische, administrative und rechtliche Voraussetzungen
für Datensicherheit und Datenschutz (Kryptographie), Wahrung
der Persönlichkeitsrechte und des Rechtes auf informationelle
Selbstbestimmung
- Schutz geistiger Eigentumsrechte (z. B. Urheberrechte) und der
Privatsphäre, Schutz der Wohnung vor unerwünschtem
Eindringen Dritter über Netze; Haftungsrecht
- Verbrechensbekämpfung
(Verschlüsseln/Entschlüsseln)
- Jugend- und Verbraucherschutz (Förderung der
Selbstverpflichtung der Anbieter), Minderheitenschutz
- Bestandssicherung und Entwicklung öffentlich-rechtlicher
Informationsangebote
- Definition von Rundfunk und neuen Diensten.
|
|
13/5: So genannte Sekten und
Psychogruppen
(aus Beschlussempfehlung und Bericht Drs.
13/4477):
-
Seit Mitte der 70er Jahre treten in der Bundesrepublik
Deutschland zunehmend so genannte Sekten und Psychogruppen in
unterschiedlichen Formen in Erscheinung. Der Deutsche Bundestag
befasste sich in jüngster Zeit, insbesondere im Zuge der
Beratungen einer Reihe von Petitionen besorgter und betroffener
Bürgerinnen und Bürger mit dem Auftreten dieser
Organisationen, ihren offiziellen und inoffiziellen
Untergliederungen, ihrem Einfluss auf Mitglieder und
Außenstehende sowie auf gesellschaftliche Teilbereiche. Die
in diesen Petitionen geführten Klagen betrafen vor allem
- das Innenverhältnis dieser Organisationen sowie ihrer
Untergliederungen zu ihren Mitgliedern;
- die durch bestimmte Praktiken und Ziele dieser Organisationen
hervorgerufenen unterschiedlichen Gefährdungen für
Mitglieder und die Gesellschaft;
- die Inanspruchnahme dieser Organisationen für von ihnen
verursachte finanzielle, soziale und gesundheitliche
Schäden;
- die missbräuchliche Ausnutzung staatlich gewährter
Vorteile für Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften bei
der Verfolgung wirtschaftlicher Zielsetzungen.
Im Hinblick auf die im Zuge der Petitionsverfahren aufgetretenen
ungeklärten Rechtsfragen hat der Petitionsausschuss wiederholt
die Untersuchung des Problemfeldes durch eine Enquete-Kommission
des Deutschen Bundestages empfohlen.
-
Dies nimmt der Deutsche Bundestag zum Anlass, eine
Enquete-Kommission einzusetzen, die sich mit dem Problemfeld der
neueren religiösen und weltanschaulichen Bewegungen, so
genannte Sekten und Psychogruppen, auseinandersetzt. Sie hat die
Aufgabe, Informationen von und über so genannte Sekten und
Psychogruppen einzuholen, zu bündeln und aufzuarbeiten.
Sie soll den gesellschaftlichen Hintergrund der Entstehung und
Ausbreitung des Phänomens analysieren, eine bewertende
Bestandsaufnahme der Ziele und Praktiken der Organisationen sowie
der damit in Zusammenhang stehenden Probleme erstellen und unter
Überprüfung der Möglichkeiten und Grenzen
staatlichen Handelns den aktuellen und absehbaren Handlungsbedarf
feststellen. Sie soll Empfehlungen geben für gesetzgeberische,
administrative und sonstige Maßnahmen in Verantwortung von
Bund, Ländern und Kommunen sowie von anderen betroffenen
gesellschaftlichen Institutionen.
-
Die Kommission soll dabei die folgenden Aspekte des Themas
schwerpunktmäßig behandeln:
- Analyse von Zielen, Aktivitäten und Praktiken der in der
Bundesrepublik Deutschland agierenden so genannten Sekten und
Psychogruppen
Die Analyse soll
- die von diesen Organisationen ausgehenden Gefahren für den
Einzelnen, den Staat und die Gesellschaft erfassen;
- die offenen und verdeckten gesellschaftspolitischen Ziele
dieser Organisationen aufarbeiten;
- nationale wie internationale Verflechtungen der Organisationen
darstellen und
- Grenzen der Inanspruchnahme der grundgesetzlich garantierten
Religionsfreiheit durch neuere religiöse und weltanschauliche
Bewegungen, so genannte Sekten und Psychogruppen, aufzeigen.
- Gründe für die Mitgliedschaft in einer so genannten
Sekte oder Psychogruppe und für die Ausbreitung solcher
Organisationen
Die Enquete-Kommission soll hierzu
- untersuchen, welche Einstiegswege und Verläufe der
Mitgliedschaft typisch sind;
- aufklären, welche gesellschaftlichen und politischen
Bedingungen ursächlich für eine verstärkte
Bereitschaft sind, so genannten Sekten und Psychogruppen
beizutreten;
- feststellen, welche Anwerbungs- und Rekrutierungsstrategien von
diesen Organisationen verfolgt werden und
- Vorschläge erarbeiten, auf welche Weise verhindert werden
kann, dass Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen,
Verbände, Interessenvertretungen und andere Institutionen
unbewusst in solche Organisationen hineingezogen bzw. von diesen
missbraucht werden.
- Probleme von Mitgliedschaft und Ausstieg
Die Mitgliedschaft kann nicht nur zu Problemen für das
einzelne Sektenmitglied, sondern auch für dessen
Angehörige und Freunde sowie zu Problemen in Unternehmen,
Verbänden, Interessenvertretungen und anderen Institutionen
führen.
Von besonderer Bedeutung sind Sozialisationsprobleme und
familienrechtliche Konfliktfälle. Auch wenn die
Betroffenheitssituationen unterschiedlich sind, ist der Umgang mit
den jeweiligen Problemen oder deren Lösung ohne eine
entsprechende Hilfestellung häufig nicht zu bewältigen.
So gilt es für die Kommission, die durch eine Mitgliedschaft
verursachten Probleme und Folgen für alle Betroffenen ebenso
zu untersuchen, wie die Frage, welche Hilfsangebote zur
Verfügung stehen bzw. stehen sollten. Wichtig ist bei der
Prüfung von Möglichkeiten und Notwendigkeiten von
Ausstiegshilfen, die Erfahrungsberichte ehemaliger Mitglieder
über von einigen Organisationen ausgeübten Druck, die
psychische Situation von Mitgliedern sowie ihre Chancen und
Möglichkeiten für die Zeit ,,danach“ zu
berücksichtigen.
- Ausarbeitung von Handlungsempfehlungen unter
Berücksichtigung der bisherigen gesellschaftspolitischen
Auseinandersetzung
Die Kommission soll für den zukünftigen Umgang mit dem
Phänomen der so genannten Sekten und Psychogruppen unter
Einbeziehung der damit tangierten gesellschaftlichen Institutionen
kurzfristig umsetzbare und grundsätzliche
Handlungsempfehlungen geben. Sie soll dabei auch die Frage
beantworten, ob die bisherige gesellschaftspolitische Behandlung
und die pauschale Bezeichnung dieser Organisationen als Sekte oder
Jugendsekte der tatsächlichen Entwicklung und den
Notwendigkeiten für eine angemessene gesellschaftspolitische
Auseinandersetzung entsprechen.
|