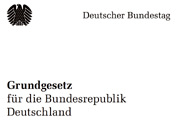Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Textarchiv > 2011 > Rechtsausschuss
Experten uneins über Regelungen zur Mediation
Der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktlösung (17/5335) ist unter Experten umstritten. Während einer öffentlichen Anhörung des Rechtsausschusses am Mittwoch, 25. Mai 2011, bildete insbesondere die neben der außergerichtlichen und der gerichtsnahen Mediation vorgesehene gerichtsinterne Mediation einen Streitpunkt. Einig waren sich die Experten hingegen in der Feststellung, dass die im Entwurf genannten Ausbildungs- und Fortbildungsregelungen für Mediatoren erweitert werden müssten.
"Gerichtsinterne Mediation ersatzlos streichen"
Die ersatzlose Streichung der Regelungen zur Einführung der gerichtsinternen Mediation forderte Michael Krämer, Vorsitzender Richter am Landgericht Mühlhausen. Er lehne es ab, solch ein ”kommunikationswissenschaftliches Schlichtungsinstrument aus fiskalischen Gründen an den Gerichten einzuführen“, sagte Krämer. Es sei zudem verfassungsrechtlich nicht haltbar, wenn künftig die Landesregierungen entscheiden sollen, ob eine gerichtsinterne Mediation angeboten wird.
Aber auch die Einführung durch den Bundesgesetzgeber wäre verfassungswidrig, betonte Krämer, da die Mediation als Streitschlichtungsinstrument eine Loslösung von der Gesetzesbindung der Richter vorsehe. Gerade dies sei jedoch mit dem Grundgesetz nicht vereinbar.
"Güterichtermodell statt gerichtsinterne Mediation"
Für eine "Umschichtung“ der gerichtsinternen Mediation zum Güterichtermodell sprach sich Michael Plassmann, Rechtsanwalt und Mediator aus Berlin, aus. Die vom Gesetzgeber gewollte Verschwiegenheit des Mediators sei bei einem "Richtermediator“ nicht immer zu erreichen, da dieser gleichzeitig in bestimmten Fällen zu einer Anzeige verpflichtet sei.
Die flächendeckende Einführung des Güterichtermodells würde hingegen den Richtermediatoren die Option eröffnen, ihre Mediationskompetenz, "die unzweifelhaft vorhanden ist“, einzubringen, ohne in Rollenkonflikte zu gelangen.
"Wir machen Mediation"
Gänzlich anderer Meinung ist der Deutsche Richterbund. Dessen Vertreter Oliver Sporré lehnte sowohl eine Abkopplung als auch eine Umbenennung der gerichtsinternen Mediation ab. Bei 60 bis 70 Prozent der Fälle würde auf diesem Wege eine gütliche Einigung erlangt, sagte er. Wolle man das Verfahren von dem Gesetzentwurf abkoppeln, nehme man dem Ganzen das Zugpferd weg, so Sporré.
Auch eine Umbenennung sei nicht nötig: "Wir machen Mediation“, machte er deutlich. Der Gesetzentwurf würde ohnehin schon aufgrund von "Einwänden von Interessenverbänden“ die gerichtsinterne Mediation zugunsten der anderen Mediationsarten beschneiden. "Das bedeutet eine Schwächung der Rechtsordnung in Deutschland“, sagte Sporré.
"Wir brauchen ein Sicherungsinstrument"
Dass Mediatoren "frei wie private Gesangslehrer“ ihre Tätigkeit ausüben dürften, kritisierte Wilfried H. Hausmanns, ehemaliger Präsident des Oberlandesgerichts Rostock. Der Entwurf sehe weder ein Zulassungsverfahren noch eine Zertifizierung vor. Die Aus- und Weiterbildung jedoch der Eigenverantwortung zu überlassen, sei "ungeeignet“, urteilte Hausmanns. "Wir brauchen ein Sicherungsinstrument, um zu einer allgemeinen Wertschätzung zu gelangen“, forderte er.
Seiner Kritik schlossen sich weitere Experten an. So sprach sich Prof. Dr. Reinhard Greger von der Universität Erlangen-Nürnberg dafür aus, eine Zertifizierungsmöglichkeit zu schaffen, die zwar nicht die Voraussetzung für die Arbeit als Mediator bilden solle, jedoch als Anreiz dienen könne, sich weiterzubilden.
"Das geht nicht an einem Wochenende"
Auch die Mediatorin Anita von Hertel betonte die Bedeutung der Ausbildung für die Mediation. Nach Angaben der Berufsverbände seien dafür mindestens 200 Stunden nötig. "Das geht nicht an einem Wochenende“, sagte von Hertel. Die von den Verbänden festgelegten Standards müssten Grundlage dieser Ausbildung sein, forderte sie. Ansonsten würden "die Hoffnungen in eine gute Mediation enttäuscht“.
Wie die Mehrzahl seiner Kollegen sprach sich auch der Fachanwalt für Familienrecht, Christoph C. Paul, für die Etablierung einer Mediationskostenhilfe aus. Das Argument, dafür stehe kein Geld zur Verfügung, sei wenig überzeugend, befand er. Schließlich könne dadurch etwa im Falle von Scheidungen der Weg der Mediation gegangen und gerichtliche Verfahren vermieden werden, was zu einer Verminderung der Ausgaben für die Prozesskostenhilfe führen würde.
Liste der geladenen Sachverständigen
- Prof. Dr. Reinhard Greger, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
- Dr. h.c. Wilfried H. Hausmanns, Präsident a.D. des Oberlandesgerichts Rostock
- Anita von Hertel, Akademie von Hertel, Hamburg
- Franz-Joachim Hofer,Rechtsanwaltskammer Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin
- Michael Krämer, Vorsitzender Richter am Landgericht Mühlhausen, Wanfried
- Christoph C. Paul, Sprecher der Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation (BAFM), Berlin
- Michael Plassmann, Rechtsanwalt, Berlin
- Oliver Sporré, Deutscher Richterbund, Berlin
- Rainer Tögel, D.A.S. Deutscher Automobilschutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft, München
Weitere Informationen
Weitere Informationen
Informationsmaterial
-
Informationsmaterial
-
Broschüre: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
-
Fakten: Der Bundestag auf einen Blick