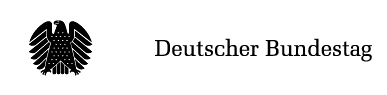Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Protokolle > Tagesaktuelles Plenarprotokoll > Vorläufiges Protokoll der 179. Sitzung vom 11. Mai 2012
Vorläufiges Protokoll der 179. Sitzung vom 11. Mai 2012
**** NACH § 117 GOBT AUTORISIERTE FASSUNG ****
*** bis 9.45 Uhr *** wird fortlaufend aktualisiert ***
Deutscher Bundestag
179. Sitzung
Berlin, Freitag, den 11. Mai 2012
Beginn: 9.00 Uhr
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nehmen Sie bitte Platz. Die Sitzung ist eröffnet.
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie alle herzlich.
Heute gibt es bedauerlicherweise keine Geburtstage zu erwähnen, sodass wir gleich in die Tagesordnung eintreten können und müssen. Das muss aber der guten Laune nicht im Wege stehen.
Ich rufe unseren Zusatzpunkt 6 auf:
Abgabe einer Regierungserklärung durch den Bundesminister des Auswärtigen
Europas Weg aus der Krise: Wachstum durch Wettbewerbsfähigkeit
Ich weise darauf hin, dass es hierzu einen Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke gibt.
Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache im Anschluss an die Regierungserklärung 90 Minuten vorgesehen. - Auch das ist offensichtlich einvernehmlich und damit so beschlossen.
Das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung hat der Bundesminister des Auswärtigen, Dr. Guido Westerwelle.
Dr. Guido Westerwelle, Bundesminister des Auswärtigen:
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Kolleginnen und Kollegen! Europa ist in einer Prägephase. Das Bild Europas in der Welt wird jetzt nachhaltig geprägt. Das Bild Europas bei den Bürgerinnen und Bürgern in Europa wird jetzt nachhaltig geprägt, aber auch das Bild Deutschlands in Europa wird jetzt für viele Jahre nachhaltig geprägt.
Wir haben es mit einer Staatsschuldenkrise zu tun. Die Schuldenstände einzelner Euro-Staaten sind zu hoch. Die Finanzmärkte haben infrage gestellt, ob diese Schuldenberge jemals wieder abgetragen werden können. Aus der Staatsschuldenkrise ist somit eine Vertrauenskrise geworden. Um Vertrauen zurückzugewinnen, müssen wir überzeugend darlegen, dass der Euro-Raum künftig ein Ort dauerhafter finanzieller Stabilität sein wird. Dazu haben wir die richtigen Weichen gestellt. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt bekommt neue Autorität. Verstöße gegen den Stabilitätspakt werden in Zukunft früh und wirkungsvoll sanktioniert. Die Bundesregierung aus dem Jahre 2004 hat den Stabilitätspakt aufgeweicht. Diese Bundesregierung wird die Fehler von damals nicht wiederholen.
Wir wollen raus aus der Schuldenpolitik hier bei uns in Deutschland, auch in den Bundesländern,
in Europa, weil wir der Überzeugung sind, dass das Anwerfen von Notenpressen, das Drucken von Geld keine Antwort sein kann. Das führt zur Geldentwertung. Das führte zur Inflation. Die Stabilität unseres Geldes ist ein Kernanliegen der Bundesregierung. Es ist auch eine soziale Herausforderung. Denn unter Inflation leiden die Ärmsten am allermeisten.
Mit dem Fiskalpakt verpflichten sich die Regierungen in ganz Europa, nationale Schuldenbremsen einzuführen. Der Fiskalpakt trägt die Unterschrift von 25 Staats- und Regierungschefs. Drei Mitgliedstaaten haben den Fiskalpakt bereits ratifiziert, nämlich Portugal, Slowenien und auch Griechenland. Irland führt am 31. Mai ein Referendum zum Fiskalpakt durch. In anderen Mitgliedstaaten ist das parlamentarische Verfahren eingeleitet.
Ich will es noch einmal mit großer Deutlichkeit sagen: Der Fiskalpakt ist beschlossen, und er gilt.
Das Ende der Schuldenpolitik in Europa ist vereinbart. Dabei bleibt es. Vereinbarungen zwischen Staaten werden durch Wahlen nicht ungültig.
Deutschland hat für diesen Kurs unermüdlich geworben und hart verhandelt: der Finanzminister, ich selbst als Außenminister, aber vor allem an der Spitze die Bundeskanzlerin. In Europa und international setzt sich Deutschland für ein Ende der Politik des Schuldenmachens ein. Es untergräbt die Glaubwürdigkeit unseres Landes, wenn einzelne Bundesländer in Deutschland ihre Schuldenpolitik trotzdem weiter fortsetzen wollen.
Die Ursache der Krise waren zu hohe Staatsschulden. Die Folge waren verantwortungslose Spekulationen. Gegen beides brauchen wir neue Regeln.
Zu den richtigen Lehren aus der Krise gehört auch die bessere Regulierung der Finanzmärkte. Die Bundesregierung hat ungedeckte Leerverkäufe bereits im Mai 2010 dauerhaft verboten. Wir sorgen für einen stabileren Bankensektor. Wir haben strengere Eigenkapitalvorschriften eingeführt. Mit der Bankenabgabe haben wir Risiko und Haftung wieder zusammengebracht.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die erste Säule unserer Politik ist der Fiskalpakt für weniger Schulden; die zweite Säule unserer Politik ist Wachstum durch mehr Wettbewerbsfähigkeit. Zu einer wachstumsorientierten Politik muss diese Bundesregierung niemand überreden. Wachstum ist ein Kernanliegen der christlich-liberalen Koalition.
Ohne Schuldenabbau kein Vertrauen. Ohne Vertrauen keine Investitionen. Ohne Investitionen kein Wachstum. Ohne Wachstum keine Arbeitsplätze. Ohne Arbeitsplätze keine neuen Staatseinnahmen. Haushaltsdisziplin und Wachstum sind deshalb zwei Seiten derselben Medaille.
Die Bundesregierung hat sich seit Beginn der Staatsschuldenkrise neben der notwendigen Haushaltskonsolidierung konsequent für mehr Wachstum durch Wettbewerbsfähigkeit in Europa eingesetzt. Bereits vor zwei Jahren wurde die neue Strategie für Beschäftigung und Wachstum „Europa 2020“ beschlossen. Seither haben sich alle - alle! - Europäischen Räte wie auch zahlreiche Allgemeine Räte und Fachräte mit den Themen „Wachstum“, „Wettbewerbsfähigkeit“ und „Beschäftigung“ befasst, übrigens immer wieder auch auf deutsch-französische Initiative.
Auch der letzte Europäische Rat im März dieses Jahres betonte die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung wie auch die Notwendigkeit der Förderung von Wachstum, von Wettbewerbsfähigkeit und natürlich auch von Beschäftigung. Wie schon beim informellen Sonderrat am 23. Mai - die Bundeskanzlerin hat gestern in ihrer Regierungserklärung darauf hingewiesen - steht auch beim Europäischen Rat im Juni das Thema Wachstum erneut auf der Tagesordnung.
Manche haben uns in den letzten Monaten und in den letzten beiden Jahren empfohlen, wir hätten von Anfang an einen anderen Weg einschlagen sollen, der im Wesentlichen in folgender Weise zusammengefasst ist: Von Anfang an hätte Deutschland, hätte die Bundesregierung einen großen Batzen Geld ins Schaufenster legen sollen zur Stabilisierung und zur Abschreckung der Spekulation der Finanzmärkte. - Hätten wir als Bundesregierung zu Beginn der Krise gleich den von der Opposition geforderten Blankoscheck der Solidarität ausgestellt: Wir hätten in den Verhandlungen keine einzige der Gegenleistungen für Stabilität durchsetzen können.
Es war richtig, dass Leistung und Gegenleistung von uns stets zusammen gesehen wurden.
Wachstum kann man nicht mit Schulden kaufen. Wettbewerbsfähigkeit ist der Schlüssel für mehr Wachstum. Wettbewerbsfähigkeit erlangt man durch Strukturreformen; darauf weist der Wirtschaftsminister zu Recht hin.
Gut zehn Jahre ist es her, da galt Deutschland als der kranke Mann Europas. Heute ist Deutschland wieder die Wachstumslokomotive in Europa.
Heute ist Deutschland wieder global wettbewerbsfähig. Die Arbeitslosigkeit sinkt; vor allem die Jugendarbeitslosigkeit ist so niedrig wie nirgendwo sonst in Europa. Das ist der Lohn der Mühe unserer Bürgerinnen und Bürger. Das ist das Ergebnis von verantwortungsvollem Handeln der Tarifparteien. Es ist auch das Ergebnis der neuen politischen Rahmenbedingungen durch die christlich-liberale Koalition.
Ich füge ausdrücklich hinzu: Auch die Agenda 2010 hat die Grundlagen dafür gelegt, dass wir heute so gut dastehen. Deswegen ist es gänzlich unverständlich, dass Sie sich davon wieder abseilen wollen.
Wir wissen um den schweren Weg, den viele Menschen in Europa derzeit gehen müssen. Dafür empfinden wir großen Respekt und höchste Anerkennung. Die Menschen, die derzeit in vielen Ländern Europas in einer sehr schwierigen Lage sind, können persönlich nichts dafür, dass Reformen in ihren Ländern in den letzten Jahren unterlassen worden sind. Deswegen rate ich uns allen, nicht mit Hochnäsigkeit auf die Lage in diesen Ländern zu reagieren, sondern Verständnis dafür zu haben, was diese Menschen durchmachen. Diesen Rat richte ich nicht nur an eine Seite, sondern an alle, die darüber diskutieren. Gerade weil wir derzeit wirtschaftlich so stark sind, müssen wir in den europäischen Diskussionen eine besondere Sensibilität zeigen.
Angesichts einer zum Teil stark schrumpfenden Wirtschaft, angesichts hoher Arbeitslosigkeit, angesichts einer vor allem erschreckend hohen Jugendarbeitslosigkeit sind die jetzt angepackten Reformen die einzige nachhaltige Chance. Nur so können wir die wirtschaftliche und soziale Lage in den jeweiligen Mitgliedstaaten und überall in Europa zum Guten wenden.
Ein Wort zu Griechenland: Wir stehen zu unseren Hilfszusagen. Das bedeutet aber auch, dass die vereinbarten Reformen in Griechenland umgesetzt werden. Wir wollen die Euro-Zone zusammenhalten. Die Zukunft Griechenlands in der Euro-Zone liegt nun in den Händen Griechenlands. Wir wollen und werden Griechenland helfen. Griechenland muss sich aber auch helfen lassen wollen. Wenn der verbindlich vereinbarte Reformweg verlassen werden sollte, dann ist die Auszahlung weiterer Hilfstranchen nicht mehr möglich. Solidarität ist keine Einbahnstraße. Solidarität funktioniert nicht ohne Solidität. Was vereinbart ist, muss gelten.
Das ist die Haltung der Bundesregierung, meine Damen und Herren Abgeordnete. Das ist die Haltung unserer europäischen Partner. Das ist übrigens auch die Haltung des Präsidenten der Europäischen Kommission, und das ist die Haltung des Präsidenten des Europäischen Parlaments.
Für neues Wachstum liegt die Verantwortung zuerst und vor allem bei den Mitgliedstaaten. Durch nationale Strukturreformen müssen die Mitgliedstaaten die Wettbewerbsfähigkeit wieder herstellen, die für neues Wachstum zwingend ist. Hierzu gehört es beispielsweise, die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest zu machen. Dazu zählt, die Arbeitsmärkte gerade für junge Menschen stärker zu öffnen und Schwarzarbeit abzubauen.
Dazu bedarf es eines klaren Bekenntnisses zur Förderung von Bildung, Wissenschaft und Forschung. Auch auf europäischer Ebene wollen wir noch stärker auf Wachstum setzen. Ein europäischer Wachstumspakt muss folgende sechs Punkte beinhalten:
Erstens. Die Europäische Union darf nicht mehr ausgeben als bisher. Sie muss aber ihre Mittel besser einsetzen als bisher.
Geld ist durchaus vorhanden. Der Zukunftshaushalt der Europäischen Union für die Jahre 2014 bis 2020 sieht ein Volumen von über 1 Billion Euro vor. Aus diesem Haushaltsplan muss der politische Anspruch der Europäischen Union ablesbar sein, Zukunft zu gestalten und nicht nur Vergangenheit zu verwalten. Wir brauchen bei der Verwendung dieser Mittel ein neues Denken. Es darf nicht mehr darum gehen, einfach möglichst viel Geld für die eigenen nationalen Steckenpferde zurückzuholen. Das führt am Ende zu Fehlentwicklungen wie europäisch geförderte Wellnessoasen in Romantikhotels. Wir alle kennen solche Beispiele, übrigens auch aus unserem eigenen Land.
Strukturmittel, die die Europäische Union ausgibt, müssen zu mehr Wachstum und zu mehr Wettbewerbsfähigkeit in Europa beitragen. Das sind wir nicht nur denen schuldig, die auf unsere Solidarität angewiesen sind, sondern das schulden wir allen europäischen Steuerzahlern. Die Bundesregierung hat in die laufenden Haushaltsverhandlungen in Brüssel einen Aktionsplan zum „Better Spending“ eingebracht. Gleichzeitig wollen wir, dass die Ausgaben stärker überwacht und an messbare Kriterien geknüpft werden. Mit dem Geld der europäischen Steuerzahler wollen wir gute Ergebnisse befördern statt Förderquoten zu erfüllen.
Zweitens. Aus den Struktur- und Kohäsionsfonds der laufenden Haushaltsperiode stehen noch knapp 80 Milliarden Euro zur Verfügung, die bis heute noch keinen konkreten Projekten zugeordnet sind. Wir wollen, dass die Europäische Kommission diese Mittel nutzt und gemeinsam mit den Mitgliedstaaten jetzt schneller und wirkungsvoller in neues Wachstum durch bessere Wettbewerbsfähigkeit investiert.
Drittens. Weil der Bankensektor unter der Last fauler Kredite leidet, klagen viele Unternehmen in Europa über eine Kreditklemme. Mit der Europäischen Investitionsbank verfügen wir über ein Instrument, das wir stärker und gezielter nutzen sollten. Wir wollen den Zugang gerade kleinerer und mittelständischer Unternehmen zu Krediten verbessern und die Expertise der Europäischen Investitionsbank besser nutzen.
Viertens. Europas Straßen und Schienen, unsere Energie- und Telekommunikationsnetze gehören zu den großen Trümpfen der europäischen Wirtschaft. Sie zu erhalten und zu verbessern, eröffnet neue Wachstumsperspektiven. Für den grenzüberschreitenden Ausbau der europäischen Infrastruktur muss mehr privates Kapital mobilisiert werden. Wir müssen hier auch innovative Wege im Bereich Public-private-Partnership ausloten.
Fünftens. Schon einmal wurden in den 80er- und 90er-Jahren durch die Verwirklichung der sogenannten vier Freiheiten im europäischen Binnenmarkt enorme Wachstumskräfte freigesetzt. Heute bietet die Ausdehnung des Binnenmarktes auf neue Felder erneut große Chancen. Das gilt für die digitalisierte Wirtschaft und den Internethandel. Das betrifft den Energiesektor, wo mehr Wettbewerb zu niedrigeren Preisen und größerer Versorgungssicherheit für die Verbraucher führen wird, und das zielt auf die Stärkung von kleinen und mittleren Unternehmen durch den Abbau von Bürokratie, durch besseren Zugang zu Risikokapital und eine Modernisierung des europäischen Vergaberechts.
Sechstens. Wir wollen den Freihandel stärken. Drei Viertel der Weltwirtschaft liegt außerhalb der Europäischen Union. Mehr als 80 Prozent des weltweiten Wachstums werden mittlerweile außerhalb der Europäischen Union erwirtschaftet, vor allem in Asien sowie in Nord- und Südamerika. Solange ein Abschluss der Doha-Runde für ein weltweites Freihandelssystem nicht erreichbar ist, muss die Europäische Union daran arbeiten, weitere Freihandelsabkommen mit den alten und neuen Kraftzentren der Welt abzuschließen.
Die Verhandlungen mit Kanada und Indien wollen wir zügig zum Abschluss bringen. Mit Singapur und Malaysia sind die Verhandlungen auf gutem Wege. Auf dem EU-Asien-Außenministertreffen vor wenigen Tagen hat sich gezeigt, dass in der gesamten Region großes Interesse an Abkommen mit der Europäischen Union besteht. Die Vorgespräche für die Aufnahme von Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Japan stehen kurz vor ihrem Abschluss.
Gegenüber Partnern wie den Golfstaaten und Brasilien werben wir dafür, den Verhandlungen neue Impulse zu geben. Mit den USA gibt es Vorgespräche und bereits erhebliche Vorarbeiten. Wir sind bereit zu einem umfassenden Abkommen mit unseren engsten Verbündeten, den Vereinigten Staaten von Amerika.
Diese sechs Punkte für mehr Wachstum in Europa zeigen, dass man Wachstum schaffen kann, ohne neue Schulden zu machen.
Der Kurs der Bundesregierung bei der Bewältigung der Krise ist klar.
Wir sind der Überzeugung: Europa ist nicht das Problem, sondern es ist Teil der Lösung des Problems. Es reicht nicht, aus der Krise nur finanz- und wirtschaftspolitische Konsequenzen zu ziehen, so wichtig die natürlich sind. Wir müssen strukturelle Antworten geben. Die Europäische Union muss handlungsfähiger und effizienter werden. Auch das ist eine Lehre aus der Krise.
Wir haben eine Zukunftsgruppe ins Leben gerufen,
in der wir institutionelle Verbesserungen diskutieren, die auch unterhalb von Vertragsänderungen umgesetzt werden können. Wir werden alle europäischen Mitgliedsländer und natürlich auch die europäischen Institutionen, insbesondere das Europäische Parlament und die Europäische Kommission, in diese Diskussion einbeziehen. Mit dem Präsidenten des Europäischen Parlamentes habe ich dazu in dieser Woche hier in Berlin Gespräche geführt.
Die große historische Frage ist, ob die Fliehkräfte, die in der Krise auf Europa wirken, größer sind als die politische Kraft des Zusammenhalts. Es gibt Renationalisierungstendenzen, die mich besorgen. Die Reisefreiheit gehört für mich zu den kostbarsten europäischen Errungenschaften. Sie zu bewahren und zu verteidigen, ist ein Kernanliegen der Bundesregierung. Wer anfängt, Europa stückweise aufzugeben, der wird es am Ende ganz verlieren.
Die Welt verändert sich, und die Architektur der Welt verändert sich, weil die Gewichte sich verschieben. Deutschland ist in Europa relativ groß, in der Welt ist Deutschland relativ klein. Wir brauchen unsere europäischen Partner. Gefragt ist der ökonomische, politische und kulturelle Selbstbehauptungswille von uns Europäern. Europa ist eine Wertegemeinschaft. Deshalb schweigen wir nicht, wenn in unmittelbarer Nachbarschaft auf unserem europäischen Kontinent gemeinsame Werte verletzt werden. Wir stehen an der Seite der Unterdrückten in Weißrussland, übrigens auch dann, wenn dies nicht jeden Tag Gegenstand medialer Betrachtung ist. Das ist Europa, und das, was in Weißrussland stattfindet, ist eine Schande für Europa.
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind Grundpfeiler unserer europäischen Werteordnung. Ohne sie, ohne Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, kann es keine weitere Annäherung an die Europäische Union geben. Das gilt auch für die Ukraine.
Es gibt ein europäisches Lebensmodell, auf das wir stolz sein können. Dazu gehört, dass Freiheit und Sicherheit in Balance gehalten werden, dass der Einzelne etwas zählt und nicht nur das Kollektiv, dass wir nicht nur materielle, sondern auch postmaterielle Werte schätzen, nämlich individuelle Freiheit, soziale Sicherheit,
Freiheit von Angst, kulturelle Vielfalt und eine lebenswerte Umwelt. In der Globalisierung müssen wir dieses Lebensmodell gemeinsam verteidigen. Wir wollen, dass sich Europa als Kulturgemeinschaft behauptet.
Die deutsch-französische Freundschaft ist für den Erfolg Europas unverzichtbar. Wir gratulieren dem neu gewählten französischen Präsidenten François Hollande.
Wir werden bewährt und eng mit der neuen französischen Regierung zusammenarbeiten und gemeinsam mit unseren europäischen Partnern die Lösung der Probleme anpacken. Ich denke - das hat der Beifall gezeigt -, wir gratulieren alle gemeinsam dem neu gewählten, dem demokratisch gewählten französischen Präsidenten.
Ich bin gespannt auf das Folgende. Wir danken dem scheidenden Präsidenten Frankreichs, Nicolas Sarkozy, für die freundschaftliche Zusammenarbeit der letzten Jahre. Erlauben Sie mir, dass ich in diesen Dank auch Außenminister Alain Juppé und die andere Kabinettskollegen einschließe.
- An dieser Stelle, Genossen, fehlt der Beifall.
Ich will es Ihnen ganz offen sagen: Ich finde, dass die deutsch-französische Freundschaft von nationalen parteipolitischen Präferenzen völlig unabhängig ist.
Wir kämpfen für Europa - mit Pragmatismus und Weitsicht, mit Verstand und Herz. Unser Auftrag ist das, was bereits in der Präambel des Grundgesetzes festgelegt wurde. An diese Präambel des Grundgesetzes, die uns alle verpflichtet, möchte ich erinnern: „... in einem vereinten Europa“ - so heißt es dort - „dem Frieden der Welt zu dienen“. Europa ist die Antwort auf das dunkelste Kapitel unserer Geschichte. Europa ist eine Antwort des Friedens auf Jahrhunderte der Kriege. Noch mehr aber ist Europa unsere Zukunft. Europa ist unser Schicksal, und Europa ist auch unsere Leidenschaft. Deshalb arbeiten wir alle gemeinsam dafür, dass Europa diese Bewährungsprobe besteht. Wir wissen, was wir an Europa haben. Deshalb wollen wir, dass Europa diese Lage meistert.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist der Kollege Hubertus Heil für die SPD-Fraktion.
Hubertus Heil (Peine) (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Westerwelle! Als Sie vor einigen Tagen für heute eine Regierungserklärung zum Thema „Europas Weg aus der Krise: Wachstum durch Wettbewerbsfähigkeit“ angemeldet haben, hatte ich gewisse Hoffnungen. Ich wollte eigentlich sagen: Willkommen in einer Debatte über Europa, an der Sie zwei, drei Jahre nicht teilgenommen haben. Herzlich willkommen in einer Debatte über Wachstum, zu der Sie in den letzten Wochen und Monaten nichts beigetragen haben. - Und jetzt höre ich 26 Minuten lang nichts anderes als heiße Luft und Stanzen. Der Verdruss über Europa hat auch mit dieser Art von Reden zu tun, die Sie hier liefern.
Es war kein einziger neuer Gedanke und kein konkreter Vorschlag zu hören, sondern lediglich das Mantra von Guido Westerwelle zwei Tage vor der nordrhein-westfälischen Landtagswahl. Das ist der Grund für Ihre Regierungserklärung. Das ist aber keine Regierungserklärung von Guido Westerwelle. Das hätte eine Regierungserklärung der Bundesregierung sein sollen, die in diesem Punkt sträflich versagt.
Lassen Sie uns einmal Klartext reden, Herr Westerwelle, über das, was Sie in den letzten zwei, drei Jahren unterlassen haben: Ihr Zögern und Zaudern, auch die Feigheit der Bundeskanzlerin, den Menschen die Wahrheit über das Ausmaß der Krise zu sagen, und die Unfähigkeit, Wachstumsinitiativen auf den Weg zu bringen, sowie der Glaube daran, dass man allein mit Hilfskrediten und kurzfristigen fiskalischen Auflagen Europa aus der Krise führen kann - dieser Weg ist es, der Europa im Moment noch tiefer in die Krise führt, anstatt Europa herauszuführen.
Wenn Sie uns nicht glauben, Herr Westerwelle, dann hören Sie wenigstens auf das, was Ihnen inzwischen die ganze Welt ins Stammbuch schreibt. Hören Sie auf Christine Lagarde, die Chefin des IWF. Hören Sie auf Bill Clinton, der sich zu diesem Thema geäußert hat. Hören Sie auf den Nobelpreisträger für Ökonomie, Paul Krugman, der Ihnen das ins Stammbuch geschrieben hat. Ja, Strukturreformen sind notwendig. Das ist gar keine Frage. Davon haben wir übrigens ein bisschen mehr Ahnung als diese Regierung; das will ich klar sagen.
Ich sage Ihnen einmal etwas, Herr Brüderle: Dampfplauderreden, wie Sie sie hier halten, kann jeder. Wir hingegen haben uns darangemacht, schwierige und mutige Entscheidungen zu treffen, und das hat Deutschland gedient. Das waren wir und nicht Sie.
Jetzt will ich Ihnen etwas zu dem Popanz sagen, den Sie hier aufbauen: Es ist doch überhaupt gar keine Frage, dass Länder, die Probleme mit der Wettbewerbsfähigkeit haben, auch langfristig wirkende Strukturreformen brauchen. Das bezweifelt niemand. Es ist auch keine Frage, dass Europa Haushaltsdisziplin braucht. Die Staaten müssen unabhängiger werden von den Launen der Finanzmärkte und ihrer Finanzierung. Ganz klar ist aber auch: Ohne Wachstumsperspektiven und wirtschaftliche Dynamik gelingt es nicht, die Haushalte zu konsolidieren, und Wachstum braucht Investitionen, Herr Westerwelle. Das ist in dieser Situation wichtig, aber das haben Sie nicht begriffen.
- Private und öffentliche Investitionen; das sage ich Ihnen. - Das haben Sie nicht begriffen. Private Investitionen fallen nicht vom Himmel, zumal nicht in dieser Situation. Dafür braucht man mutige Politik und mutige Initiativen. Ich will Ihnen dazu gleich ein paar Vorschläge machen.
Niemand bezweifelt - das sage ich noch einmal -, dass wir von der Staatsverschuldung in Europa heruntermüssen. Aber schon die Krisenanalyse, die Sie hier zimmern, stimmt so nicht.
Ja, es gab Staaten, die fiskalisch weit über ihre Verhältnisse gelebt haben. Das ist Politikversagen. Aber es gab auch Staaten wie Irland und Spanien, wo es kein Politikversagen oder Haushaltsversagen gab, das zu einem Defizit führte. In Irland ist eine Finanzblase geplatzt, in Spanien eine Immobilienblase. Dann musste der Staat ins Obligo gehen und Banken retten. Das ist der Grund, warum diese Länder im Defizit sind. Dort hat nicht Politik versagt, sondern die Finanzkrise hat diese Länder in Schieflage gebracht. Das verschweigen Sie, weil es nicht in Ihr Weltbild passt.
Vor Jahren haben Sie uns Irland noch als leuchtendes Beispiel genannt. Der keltische Tiger, die Zukunft der tollen Finanzmarktdienstleistungen, der Abschied von der Industrie - das war jahrelang das Mantra von Guido Westerwelle in diesem Parlament. Wohin das führt, können wir gerade in Irland beobachten.
Darüber müssen wir einmal reden. Herr Westerwelle, wir haben Ihre fünf oder sechs Punkte mit großer Aufmerksamkeit verfolgt,
und wir haben festgestellt, dass Sie im Rahmen dessen, was man sich mit Copy and Paste an Überschriften aus europäischen Papieren ziehen kann, einen großartigen Redenschreiber haben.
Lassen Sie uns jetzt über fünf konkrete Vorschläge reden. Ich willen wissen, wie sich diese Bundesregierung dazu verhält.
Erstens. Um öffentliche und private Investitionen zu bündeln, um Investitionsimpulse für Wachstum in Europa zu generieren, schlagen wir Ihnen die Gründung eines Investitions- und Aufbaufonds vor, gespeist aus den Mitteln der europäischen Strukturhilfen - die da sind - aus einer Umsteuerung bei der Strukturförderung im Agrarsektor, die in den Krisenländern zum Teil vollkommen falsch geleitet war - warum Sie dazu keinen Satz sagen, weiß ich nicht -, und dem Aufkommen einer Finanztransaktionsteuer; das Wort fehlt bei Ihnen.
Wir wollen nicht neue Schulden machen. Wir brauchen die Besteuerung der Finanzmärkte, um Wachstumsimpulse zu bekommen. Herr Westerwelle, da sind Sie der Bremser in Europa. Dass Frau Merkel hilflos in Europa herumstrauchelt und sagt: „Privat bin auch ich irgendwie für eine Finanztransaktionsteuer, aber ich schaffe es nicht einmal, das in meiner eigenen Koalition durchzusetzen“, das zeigt, dass das Chaos von Schwarz-Gelb zum Problem für Europa geworden ist.
Also: Sind Sie für einen solchen Investitions- und Aufbaufonds, ja oder nein?
Zweitens. Sind Sie für die Beteiligung des Finanzsektors? Sagen Sie doch einmal einen Satz dazu, was diese Bundesregierung auf dem nächsten europäischen Gipfel in Sachen Finanztransaktionsteuer auf den Weg bringen will. Die Chance ist jetzt nach der Wahl in Frankreich noch größer. Es gibt immer mehr Verbündete. Die Einzigen, die es nicht begriffen haben, sind die Menschen, die der FDP angehören.
Drittens. Sie haben erfreulicherweise - vielleicht hat Herr Hoyer, der neue Chef der Europäischen Investitionsbank, Ihrem Redenschreiber das zugearbeitet - die Europäische Investitionsbank als ein wesentliches Instrument genannt, um private und öffentliche Investitionen zu mobilisieren - vollkommen d'accord -, aber Sie haben keine Idee, wie Sie die Europäische Investitionsbank als Instrument in dieser Situation stärken können, um öffentliche und private Investitionen miteinander zu verbinden. Herr Westerwelle, sind Sie bereit, den Menschen in Deutschland offen zu sagen, dass das nicht geht, wenn man nicht die Möglichkeiten der Europäischen Investitionsbank, zum Beispiel durch die Erhöhung des Stammkapitals der Mitgliedstaaten, ausbaut?
Viertens. Sie haben sehr nebelig davon gesprochen, dass man auch innovative Möglichkeiten der Public-private-Partnerships zur Finanzierung von Infrastruktur nutzen soll. Was meinen Sie eigentlich damit? Meinen Sie das Instrument der Projektanleihen? Das ist ein gutes Instrument. Meinen Sie die Möglichkeit, dass wir öffentliches und privates Kapital in die Netze investieren, in die Telekommunikationsnetze, in Energienetze und in Verkehrswege? Dann sagen Sie das. Aber Sie haben doch Projektbonds schon fast wieder ausgeschlossen. Sie sagen den Menschen nicht, dass wir das brauchen, um diese Investitionen in diesem Land tatsächlich zu hebeln.
Nein, Sie sind jemand, der morgen schon wieder fressen muss, was er gestern ausgeschlossen hat.
Ich sage ihnen - fünftens - auch: Mich hat richtig enttäuscht,
dass Sie neben den Weihrauchreden über Europa mit den gestanzten Formeln, die in Europa keiner mehr hören kann und die das Vertrauen untergraben, nicht einen Satz zur Jugendarbeitslosigkeit in den Defizitländern gesagt haben. Sie sprechen von Herz und Leidenschaft. Ihnen fehlt aber jegliche Empathie mit den jungen Menschen im Süden Europas, die keine Perspektive haben.
Ihnen fehlt jede Idee für ein Sofortprogramm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, das wir fordern. Wenn in Spanien jeder dritte junge Mensch arbeitslos ist, wenn die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland bei fast 50 Prozent liegt, dann kann man nicht dabei zugucken, dass eine ganze verlorene Generation perspektivlos ist.
Dann brauchen wir auch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und Qualifizierungsmaßnahmen. Dass Sie dazu konkrete Vorschläge machen, hätten wir erwartet.
Unter Strukturreformen, Herr Westerwelle, verstehen Sie höchstens die Deregulierung des Taxigewerbes in Griechenland. Das hat mit wirtschaftspolitischem Sachverstand nichts zu tun. Ich sage Ihnen: Der fehlende Mut dieser Regierung, der fehlende Mut von Angela Merkel und Guido Westerwelle,
hat Europa schon Schaden zugefügt.
Die Realität wird aber in diesem Sommer über Sie hinweggehen. Dessen bin ich mir sicher.
Herzlichen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Gunther Krichbaum erhält nun das Wort für die CDU/CSU-Fraktion.
Gunther Krichbaum (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter Herr Kollege Heil, ich habe Ihnen sehr aufmerksam zugehört.
Eines ist sicher: Mit Ihnen hätten wir den Weg aus der Krise nicht geschafft, und mit Ihnen würden wir den Weg aus der Krise nicht schaffen.
Vor zwei Tagen jährte sich die Schuman-Erklärung. Robert Schuman, damaliger französischer Außenminister, unterbreitete Deutschland einen revolutionären Vorschlag: Nach einem entsetzlichen Krieg, von Deutschland verursacht, sollten Kohle und Stahl für die Zukunft unter eine gemeinsame Verantwortung gestellt werden, Rohstoffe, die leider auch für die Rüstungsindustrie maßgeblich waren und die deswegen auch mit die Ursache für viele Kriege waren. Dies war die Geburtsstunde der europäischen Integration. Sozusagen im Zeitraffer dargestellt: Es folgten 1957 mit den Römischen Verträgen die Gründung der Europäischen Gemeinschaft und mit dem Vertrag von Maastricht 1992 die Gründung der Europäischen Union.
Aus den Jahrzehnten der Zusammenarbeit erwuchsen Frieden, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Wohlstand und auch sozialer Fortschritt, wie Sie, Herr Außenminister Westerwelle, es vorhin richtig benannt haben. Der Wechsel von EG zu EU bedeutete sicherlich mehr als nur den Austausch eines Buchstabens. Mit der Verwirklichung einer Union war auch der Anspruch verbunden, Probleme in Zukunft politisch lösen zu wollen. Dies war ein politischer Anspruch. So ist es auch jetzt ein politischer Anspruch, auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren und diese Krise bewältigen zu wollen.
Ich glaube, an dieser Stelle dürfen wir die Ursachen dieser Krise nicht ausblenden. Die Ursachen lagen darin, dass viele Staaten auf der Welt über ihre Verhältnisse gelebt haben
und dass die Ausgaben weit über den Einnahmen lagen. Die Pleite einer Bank namens Lehman Brothers veränderte, ausgehend von den Vereinigten Staaten von Amerika, die Welt und auch Europa. Das, was lange Zeit als ein Axiom galt, dass nämlich europäische Staaten ihren Rückzahlungsverpflichtungen nachkommen können, geriet plötzlich in Zweifel. Mit den Zweifeln schwand das Vertrauen. Mit dem schwindenden Vertrauen stiegen die Zinsen. Wir müssen genau dort ansetzen, wo die Ursachen dieser Krise liegen: bei einer überbordenden Verschuldungspolitik.
Der erste Schritt ist, dass die Haushalte innerhalb der Europäischen Union konsolidiert werden und die Staaten ihrerseits Strukturreformen durchführen müssen, weil wir sonst gar keine Möglichkeit haben, mit Hilfe anzusetzen.
Sie haben es richtigerweise gesagt, Herr Außenminister: Erst einmal müssen sich die betreffenden Staaten selbst helfen. Da wir oftmals allgemein von Strukturreformen sprechen, sei dies an nur zwei Beispielen etwas konkretisiert.
Beispiel Nummer eins: Spanien. Ja, es ist richtig: Die Jugendarbeitslosigkeit ist hier viel zu hoch. Ich muss Ihnen aber sagen, dass gerade auf dem spanischen Arbeitsmarkt abstrus hohe Abfindungsregelungen existieren, die mittelständische und kleine Betriebe davon abhalten - auch bei Auftragslagen, die das eigentlich rechtfertigen würden -, Mitarbeiter einzustellen. Genau daran liegt es, dass der Arbeitsmarkt mit der Auftragslage der Firmen nicht zusammengebracht werden kann.
Beispiel Nummer zwei: Griechenland. Die Außenstände des griechischen Staates bei den Steuerforderungen liegen bei einer Größenordnung von 60 Milliarden Euro. Das ist deutlich mehr, als wir im ersten Griechenland-Paket allein an möglichen Privatisierungserlösen angesetzt haben. Das heißt, es geht hier gar nicht darum, nur entsprechende Gesetzeslagen zu schaffen - sie existieren dort bereits -, sondern darum, Gesetze zu vollziehen.
Allein an diesen Beispielen wird deutlich, wo wir ansetzen müssen.
Ich möchte auch den Blick auf die bisherige Politik der Europäischen Kommission und der Europäische Union lenken:
Gerade in diesen Tagen kann man schon etwas irritiert sein, wenn versucht wird, den Eindruck zu erwecken, als würden Wettbewerbspolitik und Wachstumspolitik etwas ganz Neues für die Europäische Kommission und die Europäische Union bedeuten. Seit wir ab 1957 die Strukturfonds und später auch die Kohäsionsfonds haben, ist es eine der Maximen der Europäischen Union, Wachstum und Beschäftigung in der Europäischen Union zu fördern. Last, but not least dokumentiert sich das in der Agenda 2020, einer Wachstumsagenda, und auch in den Beschlüssen des letzten Europäischen Rates, die Sie, Herr Außenminister, vorhin noch einmal dargestellt haben. Deswegen möchte ich mir hier weitere Ausführungen dazu sparen.
Eines ist aber sicher: Genau diese Dinge, die jetzt oftmals lautstark gefordert werden - auch von einem Nachbarland -, gibt es längst, und sie werden jetzt mit Sicherheit auch konkretisiert werden.
Wenn wir über Europa, den politischen Anspruch und die Krise sprechen, dann dürfen wir auch nicht das vergessen, was uns Europa in der Vergangenheit gebracht hat, nämlich Errungenschaften, um die wir weltweit beneidet werden. Ich habe sie vorhin schon genannt: Frieden, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. All das ist alles andere als selbstverständlich. Diese Werte und Errungenschaften zu bewahren, muss eine Vision sein, die wir erfüllen müssen - erst recht vor dem Hintergrund, dass wir in Europa immer weniger werden.
Heute repräsentieren wir Europäer nur noch einen Bruchteil der Weltbevölkerung. Am Ende dieses Jahrhunderts werden wir nur noch 4 Prozent sein. Die deutsche Bevölkerung hat schon heute nur noch einen Anteil von 1 Prozent an der Weltbevölkerung. Das bedeutet im Zeitalter der Globalisierung, dass wir nüchtern auf die Realitäten schauen müssen.
Wir sind dazu verurteilt - in Anführungszeichen -, zusammenzuarbeiten und zusammenzuwirken. Die Herausforderungen durch die Finanz- und Wirtschaftskrise sind unglaublich hoch. Dazu kommen noch: der Klimawandel, die Gewährleistung von Sicherheit - allein mit Blick auf den Iran wird hier manches deutlich -, aber auch eine Industriepolitik, die uns unabhängig macht, auch von Märkten in der Welt. Hierzu kann ich Ihnen auch zwei Beispiele nennen: Hätten wir Airbus nicht, dann gäbe es in der Welt nur Boeing; hätten wir Galileo nicht, gäbe es auf der Welt nur GPS. - Daneben geht es um die Sicherheit der Rohstoffversorgung, die Sicherheit der Energieversorgung und auch um die Bewahrung unserer sozialen Standards. Deswegen müssen wir alles darauf richten, auch diese Werte zu bewahren.
Eine Vision muss aber auch dem afrikanischen Kontinent gelten. Die Bekämpfung des Hungers und die Schaffung von Lebensperspektiven verlangen geradezu nach einer europäischen Entwicklungspolitik. Der arabische Frühling droht in einigen Ländern schon heute zu einem demokratischen Herbst zu werden.
Es kann uns als Europäischer Union nicht egal sein, was dort vor Europas Haustüre passiert. Wir müssen deswegen bereit sein, auch unsere Märkte zu öffnen, dort produzierte Ware nach Europa hereinzulassen, auch wenn das mehr Wettbewerb und Konkurrenz für hiesige Länder und hiesige Unternehmen bedeutet. Wenn wir das nicht schaffen, wird der Migrationsdruck - das ist bisher nur die Spitze des Eisberges -, der gegenwärtig in Europa zu spüren ist, weiter zunehmen.
Herr Außenminister, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie auch die Verhältnisse in Belarus und der Ukraine angesprochen haben. Gerade dort sind die Wahrung von Menschenrechten und die Schaffung von demokratischer Teilhabe leider noch nicht verwirklicht. Bei dieser Gelegenheit möchte ich insbesondere den vielen NGOs und auch unseren politischen Stiftungen danken, die gerade hier eine hervorragende Arbeit leisten. Das ist eine Investition in die Demokratie. Deswegen sollte gerade auch, lieber Norbert Barthle, was die Haushaltsverhandlungen angeht, die Arbeit der Stiftungen eine ganz besondere Berücksichtigung finden.
Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Wir werden die Herausforderungen, von denen ich eben gesprochen habe, nur gemeinsam bewältigen können. Eines fällt auf: Wir werden von außen als wesentlich stärker wahrgenommen als von uns selbst. Deswegen können wir es ruhig einmal wagen, den Blick nach außen zu richten. Die USA sind ein Land, das mit einer Staatsverschuldung von 15 Billionen Dollar kämpft. Auf der anderen Seite haben wir China, das freien Zugang zum Markt in den USA bekommt, aber im Gegenzug die amerikanischen Bonds kauft und damit den Markt finanziert. In China darf die Duldsamkeit der Menschen nicht mit Stabilität verwechselt werden; die Ereignisse von 1989 haben darauf ein Schlaglicht geworfen. Deswegen: Auch diese Länder und Regionen haben ihre Probleme; mit ihnen möchte ich nicht unbedingt tauschen.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege.
Gunther Krichbaum (CDU/CSU):
Die Ursache der Krise lag mit Sicherheit in einem Zuwenig an Europa. Die Lösung kann also nur darin liegen, dass wir mehr Europa wagen. Wenn wir das beherzigen, ist mir persönlich um die Zukunft unseres Kontinents nicht bange.
Vielen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Sahra Wagenknecht ist die nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke.