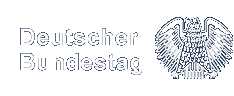22. Sitzung
Berlin, Donnerstag, den 9. März 2006
Beginn: 9.00 Uhr
* * * * * * * * V O R A B - V E R Ö F F E N T L I C H U N G * * * * * * * *
* * * * * DER NACH § 117 GOBT AUTORISIERTEN FASSUNG * * * * *
* * * * * * * * VOR DER ENDGÜLTIGEN DRUCKLEGUNG * * * * * * * *
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Die Sitzung ist eröffnet.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle herzlich und wünsche Ihnen einen guten Tag und uns gute und konstruktive Beratungen.
Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich zwei nachträgliche Geburtstagsglückwünsche vortragen. Die Kollegin Dr. Lukrezia Jochimsen feierte am 1. März ihren 70. Geburtstag und der Kollege Ottmar Schreiner am 21. Februar seinen 60. Im Namen des ganzen Hauses gratuliere ich zu diesen runden Geburtstagen nachträglich herzlich und wünsche Ihnen alles Gute.
Die Kollegin Elke Hoff hat ihr Amt als Schriftführerin niedergelegt - was ich natürlich sehr bedauere. Als Nachfolger schlägt die Fraktion der FDP den Kollegen Christian Ahrendt vor. Können wir uns darauf einigen? - Das ist offenkundig der Fall. Dann ist der Kollege Christian Ahrendt damit zum Schriftführer gewählt.
Interfraktionell ist vereinbart worden, die verbundene Tagesordnung um die in der Zusatzpunktliste aufgeführten Punkte zu erweitern:
ZP 1 Beratung des Antrags der Abgeordneten Ekin Deligöz, Kai Boris Gehring, Grietje Bettin, weiterer Abgeordneter und der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN
Neue Chancen und Perspektiven für Kinder und Jugendliche in Deutschland
- Drucksache 16/817 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f)
Finanzausschuss
Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung
Haushaltsausschuss
ZP 2 Beratung des Antrags der Abgeordneten Ina Lenke, Sibylle Laurischk, Miriam Gruß, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
Frauenpolitik - Gesellschaftlicher Erfolgsfaktor
- Drucksache 16/832 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f)
Innenausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung
ZP 3 Beratung des Antrags der Abgeordneten Karin Binder, Dr. Lothar Bisky, Diana Golze, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der LINKEN
Gleichstellungsgebot des Grundgesetzes auf dem Arbeitsmarkt durchsetzen
- Drucksache 16/833 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f)
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Arbeit und Soziales
ZP 4 Weitere Überweisungen im vereinfachten Verfahren
(Ergänzung zu TOP 19)
a) Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Wachstum und Beschäftigung
- Drucksache 16/753 -
Überweisungsvorschlag:
Finanzausschuss (f)
Rechtsausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Gesundheit
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96
GO
b) Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Betriebsprämiendurchführungsgesetzes
- Drucksache 16/858 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (f)
Finanzausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
ZP 5 Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktion der LINKEN:
Die Zukunft der Rente
ZP 6 Beratung des Antrags der Abgeordneten Volker Schneider (Saarbrücken), Klaus Ernst, Katja Kipping, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der LINKEN
1-Euro-Jobs aus der Berechnungsgrundlage für die Rentenanpassung herausnehmen
- Drucksache 16/826 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Arbeit und Soziales
ZP 7 Beratung des Antrags der Abgeordneten Bärbel Höhn, Ulrike Höfken, Cornelia Behm, weiterer Abgeordneter und der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN
Recht auf Girokonto auf Guthabenbasis gesetzlich verankern
- Drucksache 16/818 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (f)
Rechtsausschuss
Finanzausschuss
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
ZP 8 Beratung des Antrags der Abgeordneten Hans-Michael Goldmann, Dr. Christel Happach-Kasan, Jens Ackermann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
Verbraucherschutz in der Marktwirtschaft durch mündige und aufgeklärte Verbraucher sicherstellen
- Drucksache 16/825 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (f)
Finanzausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Gesundheit
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung
Ausschuss für Tourismus
ZP 9 Beratung des Antrags der Abgeordneten Hans-Michael Goldmann, Dr. Christel Happach-Kasan, Dr. Edmund Peter Geisen, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
Keine Wettbewerbsverzerrungen für Landwirte durch die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Haltung von Nutztieren in nationales Recht
- Drucksache 16/590 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
ZP 10 Beratung des Antrags der Abgeordneten Winfried Nachtwei, Jürgen Trittin, Marieluise Beck (Bremen), weiterer Abgeordneter und der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN
Abrüstung der taktischen Atomwaffen vorantreiben - US-Atomwaffen aus Deutschland und Europa vollständig abziehen
- Drucksache 16/819 -
Überweisungsvorschlag:
Auswärtiger Ausschuss (f)
Verteidigungsausschuss
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen
Union
ZP 11 Beratung des Antrags der Abgeordneten Jürgen Trittin, Winfried Nachtwei, Volker Beck (Köln), weiterer Abgeordneter und der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN
Nuklearen Dammbruch verhindern - Indien an das Regime zur nuklearen Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtweiterverbreitung heranführen
- Drucksache 16/834 -
Überweisungsvorschlag:
Auswärtiger Ausschuss (f)
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Verteidigungsausschuss
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen
Union
Von der Frist für den Beginn der Beratungen soll - soweit erforderlich - abgewichen werden.
Außerdem ist vorgesehen, die Tagesordnungspunkte 6 - hierbei handelt es sich um das Gesetz zur Vereinfachung der abfallrechtlichen Überwachung - und 7 - Kinderbetreuung - abzusetzen und stattdessen an dieser Stelle die Tagesordnungspunkte 8 - Wahlen in Belarus - und 11 - GmbH-Gründungen - zu beraten.
Schließlich mache ich auf zwei nachträgliche Ausschussüberweisungen im Anhang zur Zusatzpunktliste aufmerksam:
Der in der 17. Sitzung des Deutschen Bundestages überwiesene nachfolgende Antrag soll zusätzlich dem Ausschuss für Tourismus (20. Ausschuss) zur Mitberatung überwiesen werden.
Beratung des Antrags der Abgeordneten Winfried Hermann, Peter Hettlich, Cornelia Behm, weiterer Abgeordneter und der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN
Den Schutz der Anwohner vor Fluglärm wirksam verbessern
- Drucksache 16/551 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(f)
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Verteidigungsausschuss
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Ausschuss für Tourismus
Der in der 19. Sitzung des Deutschen Bundestages überwiesene nachfolgende Gesetzentwurf soll zusätzlich dem Haushaltsausschuss (8. Ausschuss) gemäß § 96 GO überwiesen werden.
Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU und der SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Wachstum und Beschäftigung
- Drucksache 16/643 -
Überweisungsvorschlag:
Finanzausschuss (f)
Rechtsausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Gesundheit
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96
GO
Sind Sie mit diesen gerade vorgetragenen Vereinbarungen einverstanden? - Das ist offenkundig der Fall. Dann ist das so beschlossen.
Bevor wir nun in die Tagesordnung eintreten, müssen wir einen Geschäftsordnungsantrag behandeln. Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD haben fristgerecht beantragt, die heutige Tagesordnung um vier Anträge zu erweitern. Es handelt sich hierbei um vier Anträge im Zusammenhang mit der geplanten Föderalismusreform, die in der 19. Sitzung am 16. Februar an die Ausschüsse überwiesen wurden. Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD beantragen, diese vier Anträge auf die heutige Tagesordnung aufzusetzen und sodann in Abänderung unseres früheren Überweisungsbeschlusses federführend an den Rechtsausschuss zu überweisen. - Ich hoffe, dass die Debattenlage damit hinreichend geklärt ist.
Ich erteile das Wort zur Geschäftsordnung zunächst dem Kollegen Dr. Norbert Röttgen für die CDU/CSU-Fraktion.
Dr. Norbert Röttgen (CDU/CSU):
Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir werden morgen hier im Haus die erste Lesung des Gesetzentwurfs zur Reform des Bundesstaates durchführen. Bei dem Thema „Reform des Bundesstaates“ stellen sich ganz viele Einzelfragen. Diese Einzelfragen machen aber nicht das Thema „Reform des Föderalismus“ aus. Die Reform des Föderalismus erhebt den Anspruch, insbesondere die Gesetzgebung im Bundesstaat besser zu machen, den Staat zu verbessern, zu reorganisieren, effizienter zu gestalten.
Das ist der Anspruch. Man kann kontrovers darüber diskutieren, ob der Gesetzentwurf diesem Anspruch gerecht wird.
- Genau so ist es. - Weil dieses eine politische Thema gleichzeitig mit einer Vielzahl von Einzelfragen verbunden ist, stellen sich an die parlamentarische Behandlung besondere Anforderungen. Man muss diesem Thema in ganz besonderer Weise gerecht werden.
Wenn Sie sich mit diesem Thema parlamentarisch nur oberflächlich befassen wollen, ist das Ihre Sache. Wir nehmen es ernst.
Darum wollen wir es adäquat behandeln.
Dieses Thema stellt besondere Ansprüche an uns. Wenn Sie ihnen nicht genügen, dann ist das bedauerlich. Aber das kann uns nicht daran hindern, den parlamentarischen Ansprüchen, die das Thema stellt, gerecht zu werden.
Nun gibt es zwei Varianten: Die erste Variante - ihr scheinen Sie zuzuneigen - besteht darin, zu versuchen, dieses Thema nur von seinen Einzelaspekten her zu erfassen.
- Das scheint Sie ja sehr zu erregen. Aber vielleicht hören Sie mir erst einmal zu. Dann können Sie Ihre Meinung sagen. Das wäre doch eine Möglichkeit, mit unserer Geschäftsordnung umzugehen.
Praktisch jeder Ausschuss ist mit diesem Thema befasst: unter anderem der Umweltausschuss, der Finanzausschuss und der Rechtsausschuss. Alle Ausschüsse beschäftigen sich mit einem Einzelaspekt der Föderalismusreform.
Das ist die von Ihnen bevorzugte Form der Behandlung dieses Themas.
Sie würde dazu führen, dass jeder Ausschuss den Einzelaspekt betrachtet, der ihn betrifft. Aber das Gesamtanliegen dieser Reform würde nicht erfasst. Bei diesem Thema handelt es sich allerdings um ein Gesamtanliegen des Staates, nicht aber um ein Einzelanliegen, das zu vertreten ist.
Darum schlagen wir vor - das ist die zweite Variante -, eine Beratung durchzuführen, die beides gewährleistet: dass das Thema in seiner Gesamtheit erfasst wird und dass sich alle Fachausschüsse mit dem Aspekt beschäftigen, der sie betrifft. Das ist dadurch zu realisieren, dass das Gesamtthema an einen Ausschuss, den Rechtsausschuss, zur federführenden Beratung überwiesen wird. Alle Fachausschüsse bleiben weiterhin mitberatend zuständig. Selbstverständlich werden in diesem Rahmen alle ihre Rechte gewahrt. Wir können und wollen dadurch kein einziges Minderheitenrecht beschneiden.
Selbstverständlich werden auch Sachverständigenanhörungen stattfinden. Wir wollen und - wenn Sie das beruhigt - wir können auch keine Minderheitenrechte beschneiden. Darum werden wir ein Verfahren durchführen, das nach meiner Prognose in einer mehrtägigen Sachverständigenanhörung münden wird und in dessen Rahmen sowohl das Gesamtanliegen betrachtet wird als auch alle Möglichkeiten, auch alle zeitlichen Möglichkeiten, bestehen werden, jeden Einzelaspekt strukturiert zu beraten.
In dieser Weise werden wir beiden Anliegen gerecht: sowohl den Gesamtzusammenhang als auch die Details zu betrachten. Beides muss in einem ordnungsgemäßen Gesetzgebungsverfahren bewertet werden. Das wollen wir tun. Ich denke, das ist das einzig zielführende Verfahren.
Sie müssen Ihre Oppositionsrolle natürlich selbst gestalten. Aber ein reiner Oppositionsgestus, der davon lebt, dass man etwas nicht so macht, wie es die anderen machen wollen, obwohl das in der Sache geboten wäre, ist wirklich nicht überzeugend.
Überlegen Sie sich das noch einmal.
Vielen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Bevor ich dem Kollegen van Essen für die FDP-Fraktion das Wort erteile, möchte ich dafür werben, das Ausmaß der Zwischenrufe auf ein Volumen zu reduzieren, das es noch erlaubt, die erkennbar unterschiedlichen Positionen der Fraktionen durch ihre jeweiligen Sprecher überhaupt hörbar zu machen.
Nun hat der Kollege van Essen für die FDP-Fraktion das Wort.
Jörg van Essen (FDP):
Vielen Dank, Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die FDP-Bundestagsfraktion hat Anfang dieser Woche mit großer Mehrheit beschlossen, die Föderalismusreform zu unterstützen.
Mit gleicher Klarheit fordern wir im Deutschen Bundestag aber auch, dass dieses Paket nicht bloß „durchgewunken“ wird.
Genau das zu tun, ist allerdings die Absicht der Koalition. Sie wollen eine Massenanhörung im nur für Verfassungsfragen zuständigen Rechtsausschuss durchführen.
Das zeigt, dass Sie die notwendige Diskussion scheuen, die sich beispielsweise in den Bereichen Bildung, Umwelt und Strafvollzug angedeutet hat.
Ich weiß, dass ich nicht nur für meine Fraktion spreche - die anderen Oppositionsfraktionen werden sich gleich ähnlich äußern -, sondern auch für viele Fachkollegen in der Koalition.
Denn eines ist völlig klar: Die von Ihnen geplante Massenanhörung, an der auch der Bundesrat beteiligt werden soll, hätte zur Folge, dass die einzelnen Kollegen kaum noch die Möglichkeit hätten, Fragen zu stellen. Auch wenn Sie hier so großzügig verkünden, dass dafür mehrere Tage vorgesehen sind, ist das kein Angebot, mit dem sich das Parlament zufrieden geben kann.
Nein, was Sie hier praktizieren, ist schlicht die Arroganz der Macht!
Wir sind in dieses Parlament gewählt, die Anregungen - die ja in vielfältiger Form gekommen sind - zu berücksichtigen. Ich beispielsweise bin Berichterstatter im Bereich des Strafvollzugs. Es muss uns doch nachdenklich machen, dass alle Organisationen, die mit dem Strafvollzug zu tun haben - die Kirchen, der Richterbund, die Gewerkschaften und viele andere Organisationen -, uns auffordern, es anders zu regeln. Nehmen wir die Anregungen aus der Öffentlichkeit doch ernst und führen wir geordnete Beratungen durch! Das ist der Wunsch unserer Fraktion und, wie ich weiß, auch der der anderen Oppositionsfraktionen.
Wir werden das deshalb nicht mitmachen.
Vielen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort hat nun der Kollege Olaf Scholz für die SPD-Fraktion.
Olaf Scholz (SPD):
Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir führen hier eine etwas komische Debatte.
Komisch wird eine Debatte dann, wenn Opposition zur Attitüde wird. Ich glaube, man sollte durch inhaltliche Beiträge Unterstützung leisten und nicht einfach dagegen sein, nur weil man das an dieser Stelle schön machen kann.
Ich glaube im Übrigen, dass es notwendig ist, nicht mit Unterstellungen zu arbeiten. Deswegen will ich etwas darüber sagen, wie es sein wird, wenn heute so beschlossen wird, wie wir das vorschlagen: Natürlich wird auch dann jeder Sachverständige und jede Sachverständige, die sonst in den Ausschüssen gehört würden, gehört werden.
Wir werden genauso lange über die Fragen diskutieren, wie wenn das einzeln in den Ausschüssen verhandelt würde, und jeder Abgeordnete wird die Möglichkeit haben, die Fragen zu stellen, die er stellen will. Niemand wird in Bezug auf Zeit oder Inhalt beschnitten werden.
Man fragt sich schon, warum Sie etwas dagegen haben, dass in einer auch für die Öffentlichkeit nachvollziehbaren Weise über die Föderalismusreform diskutiert wird.
Denn dafür haben wir als Parlament ja ebenfalls Verantwortung: dass man nachvollziehen kann, was stattfindet. Dafür ist es besser, wenn nacheinander und im Zusammenhang über diese Fragestellung diskutiert wird statt in vielen Ausschüssen und für die Öffentlichkeit kaum bemerkbar.
Ich glaube deshalb, dass wir der Debatte und der Entscheidung einen Gefallen tun, wenn wir Platz einräumen für eine lange, sorgfältige und intensive Diskussion im Rechtsausschuss - in Zusammenarbeit mit allen einzelnen Fachausschüssen in diesem Deutschen Bundestag.
Ich habe am Anfang kurz etwas über die Attitüde gesagt. Ich will dazu ergänzen: Eigentlich finde ich das Ganze schade. Denn die Grünen haben der Föderalismusreform schon einmal zugestimmt.
- Doch!
Auch die FDP hat gesagt, sie will die Reform unterstützen. Dieser konstruktive Geist sollte Sie bei der ganzen Debatte begleiten!
Schönen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort hat die Kollegin Dagmar Enkelmann für die Fraktion Die Linke.
Dr. Dagmar Enkelmann (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Kollege Röttgen, Ihre Rede hatte den Charme einer eingesprungenen Sitzpirouette. Wie Sie das zurückgenommen haben, was Sie hier einmal mehrheitlich beschlossen haben, das verdient schon Respekt, Herr Kollege!
Die große Koalition ist Gift für die parlamentarische Demokratie; das beweist genau der Vorgang, über den wir gerade beraten.
Wir haben vor drei Wochen mehrere Anträge, die im Zusammenhang mit der Föderalismusreform stehen, in diesem Haus beraten und sie gemeinsam an die zuständigen Fachausschüsse überwiesen - was sinnvoll war, was vernünftig war und was bisher als Verfahren üblich war.
Was ist in den Ausschüssen passiert? Im Umweltausschuss zum Beispiel hat man sich bereits über den Fortgang des Verfahrens verständigt. Herr Scholz, dort ist gestern beschlossen worden, dass eine öffentliche Anhörung stattfinden wird.
So weit zum Umgang mit der Öffentlichkeit. Ich würde gerne wissen, wie Sie mit diesem Beschluss des Ausschusses umgehen wollen.
Der Bildungsausschuss ist etwas anders verfahren; das gebe ich gerne zu. Hier hat sich die Mehrheit geweigert, dem Auftrag des Parlaments zu folgen, nämlich die Anträge, die in den Ausschuss überwiesen worden sind, dort auch ordentlich zu beraten.
Jetzt wollen Sie die Federführung des Rechtsausschusses. Das heißt, die Fachpolitiker sollen in einer so wichtigen Debatte wie der über den Umbau bzw. die Neuorganisation des Staatswesens de facto entmachtet werden;
denn wir alle wissen sehr wohl, dass nach der Geschäftsordnung eine eigenständige Anhörung in den Fachausschüssen dann nicht mehr möglich ist. Das heißt, wir alle sind auf das Wohlwollen der Koalition angewiesen, im Rechtsausschuss gegebenenfalls auch Fachpolitiker anzuhören. Ich denke, das kann es nicht sein.
Spannenderweise geht es ja gerade um die Politikfelder - das konnten wir den Medien in den letzten Tagen entnehmen -, die innerhalb der Koalitionsfraktionen noch strittig sind. Wollen Sie die Federführung also zur Disziplinierung der Abtrünnigen in Ihren eigenen Reihen nutzen?
Ich denke, das ist ein unglaublicher Vorgang in diesem Hohen Hause. Herr von Essen, mir war genau das Gleiche eingefallen wie Ihnen: Das strotzt nur so von Arroganz der Macht.
Kraft Ihrer Wassersuppe werden Sie das Zurückholen der Anträge und die Überweisung in den federführenden Ausschuss heute natürlich mit Mehrheit beschließen. Sie sollten davon ausgehen, dass wir das nicht auf sich beruhen lassen werden. Wir werden gegebenenfalls rechtliche Schritte prüfen.
Ich denke, die Opposition sollte sich nicht wie ein lästiges Übel in diesem Parlament behandeln lassen.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Zum Schluss der Geschäftsordnungsdebatte erhält der Kollege Volker Beck, Bündnis 90/Die Grünen, das Wort.
Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Unsere Fraktion will eine Föderalismusreform, eine Reform, durch die die Wirrnisse zwischen dem Bund und den Ländern aufgelöst und eigenständige Gesetzgebungsspielräume für die verschiedenen staatlichen Ebenen erreicht werden.
Von der Bundesratsbank wurde uns vollmundig gesagt, diese Reform solle die Mutter aller Reformen sein. Wir haben den Verdacht, dass das, was morgen hier debattiert werden soll, die Mutter allen Murkses werden könnte. Deshalb sind wir in großer Sorge und meinen wir, dass wir eine vernünftige Debatte in diesem Parlament brauchen.
Wenn die große Koalition für eine Sache in der Geschichte gut sein könnte, dann für eine Föderalismusreform aus einem Guss. Sie legen aber nicht mehr vor als den Belagerungskompromiss von Bundestag und Bundesrat aus der letzten Wahlperiode. Zu Recht fürchten Sie hier die Kritik Ihrer eigenen Fachpolitiker.
Wir schreiben nun Parlamentsgeschichte, weil Sie die Rechte der Opposition und die Rechte des Parlaments insgesamt mit diesem Beschluss heute hier mit Füßen treten.
Nach unserer Geschäftsordnung ist eindeutig vorgesehen, dass selbst mitberatende Ausschüsse Anhörungen durchführen können. Sie haben in der letzten Sitzungswoche gepennt, als wir Anträge in den Bildungs- und in den Umweltausschuss überwiesen haben, damit wir dort eigenständige Anhörungsrechte haben. Sie scheuen diese Anhörungen, weil Sie die Argumente der Fachpolitik scheuen; denn Sie wissen, dass Sie in der Fachdiskussion keine guten Argumente haben.
Die Vorsitzende des Umweltausschusses, die Kollegin Petra Bierwirth, sagte auf die Frage, ob sie die Auffassung der Umweltverbände teile, die kritisiert hätten, dass die Chance auf ein modernes übersichtliches Umweltrecht leichtfertig vertan worden sei:
Ja, diese Einschätzung teilen wir Umweltpolitiker der SPD-Bundestagsfraktion ebenso.
Kein Wunder, dass Sie nicht wollen, dass die gestern beschlossene Anhörung des Umweltausschusses stattfindet, Sie befürchten nämlich ein Desaster für den umweltpolitischen Teil der Föderalismusreform.
Am 23. Januar 2006 verkündete der „Lautsprecher“ der SPD-Bildungspolitik, Jörg Tauss, in einer Pressemitteilung, er wolle Expertengespräche und eine umfangreiche Anhörung im Bildungsausschuss des Deutschen Bundestages durchsetzen.
Wo ist denn der „Lautsprecher“ Jörg Tauss heute? Wo versteckt er sich denn? - Heute sitzt er ganz hinten. Ansonsten sitzt er immer vorne und ist darauf auch sehr stolz.
Als wir nach der Debatte in der letzten Sitzungswoche diese Vorschläge überwiesen haben, sagte der SPD-Bildungspolitiker Thomas Oppermann zu dem, was Sie im Bildungsausschuss nicht diskutieren wollen:
Art. 104 b des Grundgesetzes in der neuen Fassung lässt Finanzhilfen des Bundes an die Länder nicht mehr zu: gerade auf einem Gebiet, auf dem Deutschland einen finanziellen und gestalterischen Kraftakt vor sich hat und deshalb alle verfügbaren Kräfte und Ressourcen mobilisieren müsste, erscheint ein Finanzhilfe- und Kooperationsverbot wenig plausibel.
Sie sehen, dass über die neuen Zuständigkeiten für Bildung, Wissenschaft und Forschung im Grundgesetz noch sehr intensiv beraten werden muss.
Genau diese Beratungen wollen wir durchsetzen. Haben Sie keine Angst! Wir machen erst eine Anhörung im Bildungsausschuss und im Umweltausschuss. Danach können Sie alles in einer dreitägigen oder auch 14-tägigen Anhörung im Rechtsausschuss zusammenführen. Diese Anhörungen verschlagen doch nichts. Aber Sie wollen Ihre eigenen Fachpolitiker zu Zaungästen dieser Veranstaltung machen, weil Sie sich selber bei Ihrer Reform unsicher sind.
Ihr Verhalten ist unsouverän und unparlamentarisch. Ich bitte Sie wirklich, sich das noch einmal zu überlegen. Gerade weil diese Reform so wichtig ist, können wir es uns nicht leisten, statt wie erhofft den Anteil der zustimmungspflichtigen Gesetze um 35 oder 40 Prozentpunkte zu verringern, am Ende nur eine Reduktion um 10 Prozentpunkte und eine Rechtszersplitterung im ganzen Lande als Ergebnis zu erhalten. Deshalb müssen wir hier sorgfältig beraten.
Ich sage Ihnen: Die Menschen im Lande wollen die Rechtszersplitterung mit der doppelten Rückausnahmeregelung, die Sie sich ausgedacht haben, nicht. Vielmehr wollen sie klare Zuständigkeiten. Gerade da Sie auch immer an die Wirtschaft denken, meine Damen und Herren von der Union, überlegen Sie sich einmal Folgendes: Ein Wirtschaftsunternehmer schaut sich die Regelungen im Umweltgesetzbuch an und hält sich an diese Bestimmungen. Im Ergebnis hat er dann mit Zitronen gehandelt, weil sein Bundesland von diesen Regelungen abweichen durfte und davon im Bundesgesetz nichts stand.
Solche Regelungen machen die Menschen verrückt. Einen solchen Murks können wir uns nicht leisten. Durch eine sorgfältige Beratung können wir vielleicht eine klügere und mehrheitsfähige Lösung finden. Deshalb lassen Sie uns die Kompetenz des ganzen Hauses für diese große Staatsreform nutzen, um eine große Murksreform zu vermeiden!
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Wir kommen nun zur Abstimmung, und zwar zunächst über den Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung. Wer für die Aufsetzung der Anträge auf den Drucksachen 16/674, 16/654, 16/648 und 16/647 auf die heutige Tagesordnung stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer stimmt dagegen? - Wer enthält sich? - Dann ist der Aufsetzungsantrag mit der Mehrheit der Koalition gegen die Stimmen der Opposition angenommen.
Wer für die Überweisungsvorschläge der Fraktionen der CDU/CSU und SPD stimmt, wobei die Federführung beim Rechtsausschuss liegen soll, die bisherigen federführenden Ausschüsse mitberaten sollen und im Übrigen die Überweisungsbeschlüsse vom 16. Februar 2006 unverändert fortbestehen sollen, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer stimmt dagegen? - Wer enthält sich? - Auch dies ist mit der gleichen Mehrheit so beschlossen.
Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 3 sowie den Zusatzpunkt 1 auf:
3. Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung
Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland
- Zwölfter Kinder- und Jugendbericht -
und
Stellungnahme der Bundesregierung
- Drucksache 15/6014 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f)
Rechtsausschuss
Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung
ZP 1 Beratung des Antrags der Abgeordneten Ekin Deligöz, Kai Boris Gehring, Grietje Bettin, weiterer Abgeordneter und der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN
Neue Chancen und Perspektiven für Kinder und Jugendliche in Deutschland
- Drucksache 16/817 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f)
Finanzausschuss
Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung
Haushaltsausschuss
Zur Unterrichtung durch die Bundesregierung liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke vor.
Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache eineinhalb Stunden vorgesehen.
Bevor ich die Aussprache eröffne, bitte ich diejenigen, die nun anderen Verpflichtungen nachkommen müssen, möglichst zügig den Plenarsaal zu verlassen.
Ich darf darum bitten, dass wichtige Staatsgespräche, die sich aber offenkundig nicht auf diesen Tagesordnungspunkt beziehen, außerhalb des Plenarsaals geführt werden.
Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort zunächst für die Bundesregierung der Bundesministerin Ursula von der Leyen.
Dr. Ursula von der Leyen, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht stellt ganz klar fest: Auf den richtigen Anfang kommt es an. Für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft gibt es keine wichtigere Aufgabe als die zugewandte, verlässliche und kompetente Unterstützung aller Kinder, die in diese Gesellschaft hineinwachsen. Jedes Kind braucht seine Chancen, damit es seine Fähigkeiten entfalten kann, und zwar von Anfang an. Denn es sind in Wahrheit auch die Chancen für das ganze Land.
Es ist gut, dass der Deutsche Bundestag mit der Vorlage des Kinder- und Jugendberichts die Situation der Kinder und Jugendlichen in unserem Land regelmäßig in den Mittelpunkt der parlamentarischen Debatte stellt. Bildung, Erziehung und Zuwendung müssen Kindern aller Altersstufen zugänglich sein. Dieser Kernbotschaft des Kinder- und Jugendberichts kann ich voll zustimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir aber noch besser werden. Denn in keinem vergleichbaren Land ist der Einfluss der Herkunft auf die Bildungschancen so groß wie in Deutschland.
Wir haben zu lange die Augen vor den Tatsachen verschlossen. Einerseits leisten junge Eltern einen enormen persönlichen, privaten Einsatz für Erziehung, Bildung und Zuwendung für ihre Kinder. Andererseits wollen und müssen diese jungen Eltern in wirtschaftlichen Umbruchzeiten gemeinsam das Familieneinkommen erarbeiten. Verglichen mit der Situation in anderen Ländern haben diese Eltern in Deutschland relativ wenig Unterstützung in der Infrastruktur rund um Kinder und Familie erhalten.
Im Ergebnis sehen wir, dass bei unseren europäischen Nachbarn mehr Kinder geboren werden, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser gelingt, die Kinder im Bildungsvergleich besser abschneiden - also mehr innere Ressourcen für die Zukunft mit auf den Lebensweg bekommen - und die Familienarmut geringer ist. Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht mahnt dies an und fordert notwendige Veränderungen.
Die Bundesregierung unterstützt die grundlegende Richtung des Zwölften Kinder- und Jugendberichts.
Viele Forderungen, die insbesondere in die Verantwortung des Bundes fallen, finden sich als konkrete politische Verpflichtung im Koalitionsvertrag.
Eltern brauchen eine ökonomische Perspektive. Dort setzt auch der Kinder- und Jugendbericht mit seiner Forderung an, Eltern finanziell in die Lage zu versetzen, Kinder im ersten Lebensjahr in der Familie zu erziehen. Er stellt Folgendes fest:
Die derzeitige Höhe des Erziehungsgeldes scheint wenig geeignet, jungen Familien einen Ausgleich gegenüber dem vorgeburtlichen Einkommen zu bieten.
Unsere Antwort auf diese Forderung des Kinder- und Jugendberichts ist das Elterngeld. Mit dem Elterngeld signalisieren wir ganz klar: Es ist dem Staat nicht gleichgültig, wenn sich junge Menschen für ein Kind entscheiden. Heute ist es in der überwiegenden Zahl der Fälle so, dass, wenn ein Kind geboren wird, die Familie wächst, aber das Einkommen wegbricht. Das Elterngeld mildert dies in Zukunft ab.
Außerdem bringt es Anerkennung. Der Staat honoriert die Erziehungsleistung der Eltern und unterstützt sie mit dem Elterngeld, sich Zeit für das Neugeborene zu nehmen.
Das Elterngeld berücksichtigt aber auch die Wahlfreiheit der Lebensentwürfe.
Ich will es ganz klar sagen: Das Elterngeld zwingt niemanden in ein bestimmtes Familienmodell. Es ist ein kluger und effektiver Beitrag, Eltern Zeit zu ermöglichen, in die Rolle des Vaters oder in die der Mutter hineinzuwachsen, und zwar ohne finanziellen Druck. Das zeigen uns die Erfahrungen aus anderen Ländern.
Unser Latein darf aber nicht am Ende sein, wenn die Kinder ein, zwei Jahre alt sind. Wir wissen aus der Säuglingsforschung, dass Kinder andere Kinder brauchen, wenn sie sich gut entwickeln sollen. Wenn es die große Geschwisterschar nicht mehr gibt, wenn es nicht mehr selbstverständlich zehn, 15 Gleichaltrige in derselben Straße gibt, dann müssen wir eben andere Möglichkeiten schaffen, damit Kinder Beziehungserfahrungen sammeln. Sie sollen mit und durch andere Kinder lernen, mit ihnen die Welt entdecken und Kontakt zu anderen Erwachsenen aufnehmen. Eine frühe Förderung sorgt für Bildung im Sinne einer Entdeckermentalität im Alltag.
Eltern werden durch gute Betreuungsangebote dabei unterstützt, Familie und Beruf zu vereinbaren. Wir wissen aus Untersuchungen, dass 52 Prozent der Eltern mit Kindern unter sechs Jahren erwerbstätig sein möchten, bevorzugt der Vater in Vollzeit, die Mutter in Teilzeit. Doch nur 6 Prozent gelingt es - das ist die Krux -, ihren Wunsch umzusetzen. Eine vor zwei Tagen veröffentlichte Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass es Eltern vor allem wichtig ist, ihre Kinder nicht nur gut betreut, sondern auch gefördert zu wissen. Gerade unter dem Aspekt der Qualitätsstandards halten sie den flächendeckenden Ausbau einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung für vordringlich.
Die große Koalition steht daher zu dem gesetzlich verankerten Ausbau der Betreuungsangebote für unter dreijährige Kinder.
Dies ist als Pflichtaufgabe der Kommunen definiert und gesetzlich verankert. Für die Umsetzung tragen Bund, Länder und Kommunen gemeinsam Verantwortung. Ich betone deshalb, dass die Bundesregierung die den Kommunen zugesicherten 1,5 Milliarden Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung für unter Dreijährige ab 2005 bereitgestellt hat. Das ist ein starkes Wort.
Ich werde in Kürze dem Parlament den ersten Bericht über den Stand des Ausbaus der Tagesbetreuung für unter Dreijährige vorlegen. Ich begrüße es sehr, dass im Kinder- und Jugendbericht die Tagespflege und die Betreuung in Einrichtungen gleichgestellt werden. Das entspricht den Bedürfnissen der Eltern; denn Eltern wollen selbst wählen, wie ihre Kinder betreut werden. Gerade wenn es um die Jüngsten geht, wählen sie oft eine familiennahe Tagesbetreuung. Das Bundesfamilienministerium unterstützt die Qualifizierung in der Tagespflege. In wenigen Wochen werde ich das Onlinehandbuch „Tagespflege“ vorstellen, das sich an die verantwortlichen Akteure vor Ort richtet und Bausteine zum Ausbau der Kindertagespflege bereithält. Zudem wird die gerade verabschiedete verbesserte Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten ganz klar mehr Angebote und mehr Qualität in die Tagespflege bringen.
Die meisten Eltern sind in der Lage, ihre Kinder gut zu versorgen, gut zu erziehen und ihnen liebevolle Zuwendung zu geben. Doch wenn Eltern völlig überfordert sind und mit ihren Kindern in eine Spirale von Isolation, Gewalt, Vernachlässigung und Verwahrlosung geraten, dann müssen wir früher hinschauen und rechtzeitig dafür sorgen, dass Hilfe in den Familienalltag kommt. Der Kinder- und Jugendbericht bestätigt, dass es richtig ist, diesen Weg zu gehen. Deshalb entwickeln wir in den nächsten Monaten auf der Grundlage von Erfahrungen aus Kommunen und Bundesländern, aber auch aus dem Ausland Modellprojekte für soziale Frühwarnsysteme. Das Ziel ist, dabei vor allem die Grenzen zwischen Gesundheitssystem und Jugendhilfe zu überwinden. Wir haben hier lange wenig getan. Es ist nun an der Zeit, auch hier den ganzheitlichen Aspekt von Anfang des Lebens des Kindes an ins Auge zu fassen.
Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht mahnt außerdem an, dass zu viele Jugendliche heute keine echten Zukunftsperspektiven haben, vor allem keine Chance auf dem Arbeitsmarkt sehen. Sie kennen sicherlich die Zahlen: 9 Prozent der Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule ohne Abschluss. Jede fünfte Berufsausbildung wird abgebrochen, weil die Jugendlichen nicht gut vorbereitet sind. 15 Prozent der Jugendlichen zwischen 20 und 29 Jahren haben gar keine Berufsausbildung. Ich denke, diese Zahlen verweisen auf eine der Hauptursachen der Jugendarbeitslosigkeit. Ich stimme deshalb der Aussage im Kinder- und Jugendbericht zu, dass alle Jugendlichen zumindest die Chance haben müssen, gleichberechtigt an Bildung teilzunehmen.
Wir müssen natürlich in den Schulen anfangen. Aber auch vonseiten des Bundes können wir Wege aufzeigen, zum Beispiel wenn es darum geht, Jugendliche zurück in die Schulen zu bringen und ihnen eine zweite Chance zu geben. In einem bundesweiten Modellprojekt in Zusammenarbeit mit freien Trägern, Jugendämtern und Schulen erproben wir Wege zur Reintegration so genannter harter Schulverweigerer in die Schulen und begleiten sie bis zum Schulabschluss. Hinzu kommen die vom Bundesjugendministerium geförderten Kompetenzagenturen, die die berufliche Integration von benachteiligten Jugendlichen durch passgenaue Angebote verbessern. Dass dies funktioniert, lässt sich eindrucksvoll belegen. Von den Jugendlichen, die von Kompetenzagenturen betreut wurden, ist fast jeder Zweite in Ausbildung oder Arbeit und jeweils jeder Vierte in ein Förderangebot oder in eine weiterführende Schule vermittelt worden. Das ist eine gute Bilanz.
Schließlich erhebt der Kinder- und Jugendbericht auch die Forderung nach einer besseren Infrastruktur für Familien im Interesse der Kinder und Jugendlichen. Ich greife die Anregung der Kommission, Familienzentren einzurichten, gern auf, möchte sie aber noch erweitern und Mehrgenerationenhäuser schaffen. Denn warum beziehen wir in die Angebote für Familien, Kinder und Jugendliche nicht auch ältere Menschen ein? Ältere Menschen sind heute so gesund, so gut ausgebildet und so kompetent wie nie zuvor. Paradoxerweise haben wir kaum Nachfrage nach ihren Kompetenzen. Mehrgenerationenhäuser bieten die Chance dafür.
Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht macht uns darauf aufmerksam, dass noch viel zu tun ist, wenn wir unseren Kindern Voraussetzungen geben wollen, dass sie Chancen haben, ihre vielfältigen Fähigkeiten und Talente zu entwickeln. Sie werden in Zukunft viel Verantwortung tragen müssen und es geht um unsere gemeinsame Zukunft.
Ich danke Ihnen.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Für die FDP-Fraktion erhält nun die Kollegin Miriam Gruß das Wort.
Miriam Gruß (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal freue ich mich, dass wir heute an so prominenter Stelle eine Drucksache von 434 Seiten behandeln, in der es ausschließlich um Kinder und Jugendliche in Deutschland geht. Die FDP-Fraktion begrüßt den Zwölften Kinder- und Jugendbericht und dankt der Sachverständigenkommission für ihre intensive Arbeit.
In vielen Punkten entsprechen die Empfehlungen der Experten denen der FDP. Das ist die gute Nachricht. Die FDP wird die Forderungen des Berichts konstruktiv unterstützen, die die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen.
Denn darum muss es uns allen gemeinsam gehen: die Anliegen der Kinder und Jugendlichen in Deutschland ernst zu nehmen und ihnen eine möglichst behütete, sorgenfreie und glückliche Kindheit zu ermöglichen.
Die Bundesregierung hat offenbar ein anderes Verständnis von Kindeswohl. Wie sonst ist es zu erklären, dass sie mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer um 3 Prozentpunkte Familien und damit auch Kinder zusätzlich belasten will?
Kinder brauchen Eltern, die ihnen ein intaktes und beschütztes Zuhause bieten. Aber Eltern brauchen auch die Mittel, um ihre Kinder versorgen zu können. Diese Möglichkeit wird ihnen von der jetzigen Bundesregierung verbaut. Vom „Abenteuer Kinder“ ist in dem Kinder- und Jugendbericht die Rede. Laut Duden ist ein Abenteuer ein „riskantes Unternehmen“, eine „gefahrvolle Situation, die jemand mit Wagemut zu bestehen hat“. Ich kann gut verstehen, dass junge Menschen es heutzutage als ein Abenteuer empfinden, sich für Kinder zu entscheiden. Die Menschen fragen sich: Wie kann ich mich auf ein Kind freuen, wenn ich nicht weiß, wie es mit meinem Arbeitsplatz weitergeht? Wie soll ich meinen Kindern eine sorglose Kindheit bieten, wenn alles immer teurer wird? Kann ich mir ein Kind überhaupt leisten? Diese Fragen und Zweifel haben Sie zu verantworten, verehrte Damen und Herren der Bundesregierung.
Ist es das, was Sie den Menschen suggerieren wollen? Wollen Sie den Menschen suggerieren, dass Kinder nichts anderes sind als ein Risiko, ein Experiment oder gar eine Gefahr? Durch die Mehrwertsteuererhöhung holen Sie sich jeden zusätzlichen Cent zurück, den Sie den Familien durch das Elterngeld oder die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten gewähren wollen.
Und das nennen Sie Familienförderung?
Sie legen Familien noch mehr Steine in den Weg, als ohnehin schon überwunden werden müssen. Familien sowie allein erziehende Mütter und Väter haben es heute in Deutschland schon schwer genug. Es ist doch ein Unding, sie noch stärker durch eine unsoziale und familienfeindliche Erhöhung der Mehrwertsteuer zu belasten. Wir Liberale wollen jungen Menschen in Deutschland die Ängste und Sorgen nehmen.
Wir wollen ihnen die Freiheit bieten, sich für Kinder zu entscheiden.
Wilhelm von Humboldt hat gesagt:
So wichtig und auf das ganze Leben einwirkend auch der Einfluss der Erziehung sein mag, so sind doch noch immer wichtiger die Umstände, welche den Menschen durch das ganze Leben begleiten. Wo also nicht alles zusammenstimmt, da vermag diese Erziehung allein nicht durchzudringen.
Es ist Aufgabe der Politik, die bestmöglichen Umstände für Familien zu gewährleisten. In diesem Punkt ist Humboldt ganz aktuell. Das haben auch die Autoren des Kinder- und Jugendberichts verstanden: Wichtig ist das Zusammenspiel aller an Bildung, Betreuung und Erziehung Beteiligten. Kinder und Familie müssen als ein Joint Venture gelten.
Grundlage dafür ist ein neuer, umfassender Bildungsbegriff, den die Kommission definiert. Bildung wird verstanden als das Erlernen der Fähigkeit, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Das Kind wird nun als ein Subjekt gesehen, mit einer eigenen Persönlichkeit, mit individuellen Talenten und Kompetenzen. Der Vorsitzende der Kommission, Professor Rauschenbach, hat dafür ein schönes Bild gefunden: Bildungsprozesse sind Bausteine, die Menschen dazu befähigen, zum „Architekturbüro ihrer eigenen Lebensplanung“ zu werden.
Der Bericht fokussiert die Trias Bildung, Betreuung und Erziehung. Gleichzeitig wird uns in Deutschland aber in genau diesen Bereichen attestiert, dass wir hier einen „unübersehbaren Nachholbedarf“ haben. Was heißt das? Das heißt:
Erstens. Die familiäre Herkunft ist in Deutschland entscheidend für die Bildungsbiografie eines Kindes.
Zweitens. Die Bedürfnisse der Kinder sind mit den Lebensentwürfen der Frauen und Männer schwer vereinbar.
Drittens. Ganz Deutschland braucht dringend ein gutes Betreuungsangebot für unter Dreijährige. Gleichzeitig herrschen hier „unübersehbar schwierige fiskalische Rahmenbedingungen“.
Viertens. Die pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen wird bemängelt und der erhebliche Reformbedarf in der Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher wird angemahnt.
Fünftens. Es fehlt in Deutschland an einer gründlichen Qualitätssicherung und Evaluation im Bildungsbereich.
Es kann doch nicht sein, dass Selbstbräunungscremes, Kartoffelpüree und Digitalkameras permanent auf ihre Qualität und Verträglichkeit überprüft werden, nicht aber die Einrichtungen, denen wir unsere Kinder anvertrauen.
Es gibt einzelne Stichproben und einzelne Studien, zum Beispiel die von Professor Tietze, übrigens Mitautor des Kinder- und Jugendberichts, aus dem Jahre 1998, die gezeigt haben, dass nur 30 Prozent der Kindergärten eine gute Qualität aufweisen. Das heißt, wir Eltern können gemäß dieser Studie unsere Kinder guten Gewissens nur jedem dritten Kindergarten anvertrauen.
Wer gleiche Startchancen für Kinder fordert, der muss auch etwas dafür tun,
dass öffentliche Angebote in ausreichendem Maß und in einer geprüften Qualität zur Verfügung stehen. Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind.
Kinder sind in einem hohen Maß von einer fürsorglichen, beschützenden und emotional sicheren Umgebung abhängig. Dieser Aufgabe und Verantwortung müssen sich Eltern und Bindungspersonen jederzeit bewusst sein. Leider ist dies nicht immer der Fall. Immer mehr Eltern sind mit dem Spagat zwischen den hohen Ansprüchen, die Kinder zu Recht stellen, und der Existenzsicherung der Familie überfordert. Die schreckliche Wahrheit der vergangenen Woche hat uns dies wieder einmal deutlich vor Augen geführt: Am 27. Februar berichtet dpa: Mutter gesteht Kindstötung - Leiche lag monatelang in Kühltruhe. - Einen Tag später vermeldet die Agentur: Neunjähriger Stiefsohn erwürgt. - Heute genau vor einer Woche schreibt die Presseagentur AFP: „Totes Baby in Papiersortieranlage in Nordfriesland entdeckt“. Am vergangenen Freitag mussten wir über ein verwahrlostes Kind in Hamburg lesen: Vater pflegt Waffensammlung statt achtjährigen Sohn. - Meine Damen und Herren, das ist die traurige Realität von Kindern in Deutschland aus der vergangenen Woche.
Allen klugen Empfehlungen des Zwölften Kinder- und Jugendberichts gebührt Anerkennung und eine fundierte Debatte über ihre Umsetzung, aber gegen diese bittere Wirklichkeit bleiben sie blass.
Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem Reden und Ratschläge nicht mehr weiterhelfen. Wenn Meldungen wie diese beinahe alltäglich werden, ist es an der Zeit, zu handeln.
Ich habe es vorhin schon gesagt: Kinder sind auf die Fürsorge, die Verantwortung und die Pflege der Erwachsenen besonders angewiesen. Sie sind das schwächste Glied in unserer Gesellschaft und gleichzeitig unsere Zukunft. Dem Entwurf für eine EU-Verfassung und verschiedenen Landesverfassungen ist der Schutz von Kindern eigene Passagen wert, nicht aber unserem Grundgesetz. Auch der Nationale Aktionsplan „Für ein kindergerechtes Deutschland“ weist in die folgende Richtung: Die Bedeutsamkeit von Kindern für unsere Gesellschaft gebietet es, ihren Schutz im Grundgesetz ausdrücklich zu verankern. Wir müssen den besonderen Schutz von Kindern explizit in das Grundgesetz aufnehmen.
Wir brauchen keine Politik der besten Absichten. Was wir brauchen, ist eine Politik der besten Ergebnisse für Kinder und Familien.
Deshalb bitte ich Sie, Frau von der Leyen: Erschweren Sie Familien nicht das Leben durch eine schädigende Mehrwertsteuererhöhung! Bauen Sie nicht noch höhere Hürden für junge Menschen auf, die mutig sind und das „Abenteuer Kind“ wagen wollen! Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht die Leidtragenden der Finanzknappheit öffentlicher Kassen sind!
Räumen Sie dem Schutz von Kindern und ihren Rechten den Status ein, den sie verdienen! Unsere Gesellschaft hat ohne Kinder keine Zukunft. Sie sind unser wunderbarster Reichtum. Lassen Sie uns dies endlich zur Maxime unseres Handelns machen!
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Frau Kollegin Gruß, das war Ihre erste Rede im Deutschen Bundestag, zu der ich Ihnen herzlich gratulieren möchte - verbunden mit allen guten Wünschen für die weitere parlamentarische Arbeit.
Das Wort hat nun die Kollegin Kerstin Griese für die SPD-Fraktion.
Kerstin Griese (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht: Das sind über 350 Seiten eines starken Plädoyers für mehr Chancen für Kinder und Jugendliche. Das ist zugleich ein Appell an die Politik und an die Gesellschaft insgesamt, die Verantwortung für die Zukunft von Kindern und Jugendlichen wahrzunehmen.
- Auch ich gratuliere noch einmal der Kollegin Gruß. Wenn ich das von dieser Stelle aus kollektiv mache, geht es vielleicht schneller.
Ich danke den Mitgliedern der Kommission, die den Zwölften Kinder- und Jugendbericht erstellt hat, und ihrem Vorsitzenden Professor Rauschenbach - sie alle hören uns, wie ich glaube, jetzt zu - auch im Namen der SPD-Fraktion ganz herzlich für ihre Arbeit und das gute Werk, das sie erstellt haben. Sie haben uns damit viele wichtige Daten und Argumente an die Hand gegeben. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen auch für den kommunikativen Prozess, in dem dieser Bericht entstanden ist. Es handelt sich nämlich nicht um einen Bericht, der im stillen Kämmerlein geschrieben wurde, sondern um einen, der mit gesellschaftlichen Gruppen, Verbänden, Fachleuten und auch bei uns im Jugendausschuss im Januar 2005 sehr intensiv und sehr spannend diskutiert wurde. Auch deshalb, weil bei der Erstellung dieses Berichtes enge Kommunikation mit der Politik gepflegt wurde, konnte vieles, was Sie dort entwickelt haben, in die Tagespolitik einfließen und angedacht werden. Die frühere SPD-Regierung hat schon vor Jahren damit begonnen, mehr in Bildung und Betreuung zu investieren, um Kindern früher bzw. mehr Chancen zu geben.
Ich bin sehr froh und danke Ihnen, Frau Ministerin von der Leyen, dass sich dieser Ansatz wie ein roter Faden durch unsere gemeinsamen Vereinbarungen für die Kinder-, Jugend- und Familienpolitik für die nächsten Jahre zieht und dass Sie auch in diesem Punkt an die Politik Ihrer Vorgängerin Renate Schmidt anknüpfen.
Ich will etwas zu den Hauptbotschaften des Kinder- und Jugendberichtes sagen und dazu, wo nach Auffassung der SPD Schwerpunkte gesetzt werden müssen:
Erstens. Der Bericht macht ganz klar: Wir müssen die Spirale von Armut und mangelnden Bildungschancen durchbrechen. Besonders Kinder und Jugendliche, die in sozialen Brennpunkten leben oder einen Migrationshintergrund haben, haben weniger Bildungschancen; das heißt zugleich, auch immer weniger Zukunftschancen. Der Bericht sagt, nicht alle Kinder haben die gleichen Zugänge zu einer guten Entwicklung. Es gibt immer noch viel zu viele Kinder, die ohne ein gesundes Frühstück aus dem Haus gehen und zu Hause kein Buch vorgelesen bekommen, sondern eher Fastfood und Fernsehen in der Freizeit konsumieren. Das sind Alltagsrealitäten. Da müssen wir noch stärker auf dem aufbauen, womit wir begonnen haben, noch stärker vernetzte Angebote in den Stadtteilen machen, früher beginnen, Kinder zu fördern, sowie stärker die Eltern einbeziehen und unterstützen.
Auch das steht in dem Bericht. Es geht also in der Kinder- und Jugendpolitik um die soziale Integration und um bessere Teilhabemöglichkeiten für Kinder. Das Motto „Auf den Anfang kommt es an“, das wir als SPD als Überschrift gewählt haben und das auch jetzt die Kinder-, Jugend- und Familienpolitik weiter durchzieht, verlangt ein Handeln nach der Devise: Je früher man Eltern unterstützt, Familien begleitet und Kinder fördert, desto positiver. Der Vorschlag des Berichtes, mehr vernetzte Angebote, so genannte Häuser für Familien, zu schaffen, verdient unseres Erachtens besondere Beachtung. Mit der Förderung von Mehrgenerationenhäusern - Frau Ministerin hat es schon gesagt - und von Familien- bzw. Eltern-Kind-Zentren greifen wir diese Idee auf. Das ist wichtig für die Entwicklung in den Stadtteilen.
Die zweite wichtige Botschaft lautet: Wir müssen die gesellschaftliche Verantwortung für Bildung, Betreuung und Erziehung stärken. Auch da bin ich stolz auf das, was die frühere SPD-Regierung schon begonnen hat. Ich erinnere an das 4-Milliarden-Euro-Programm für mehr Ganztagsschulen - in NRW gibt es jetzt schon 1 000 offene Ganztagsgrundschulen; das ist ein Erfolgsprojekt -
und an das Tagesbetreuungsausbaugesetz, das den Ausbau der Betreuung für die unter Dreijährigen vorsieht. Ich will in dem Zusammenhang auch den Erzieherinnen und Erziehern danken. Ich weiß, dass sie immer viel kritisiert und beschimpft werden, obwohl sie eine wirklich schwere Arbeit für wenig Geld machen. Wir sollten eigentlich dafür sorgen, dass sie mehr Chancen auf Weiterbildung erhalten, und so neue Wege aufzeigen, statt immer nur zu sagen, die Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland seien alle schlecht.
Sie sind es nicht. Sie leisten eine wichtige Arbeit. Zugleich müssen ihnen aber mehr Möglichkeiten für Weiterbildung eröffnet werden.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der zur Botschaft von der gesellschaftlichen Verantwortung für den Ausbau von Bildung und Betreuung gehört, ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Die große Koalition hat deutlich gesagt, dass dieser Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ab dem zweiten Lebensjahr kommen wird, wenn der Ausbau in den Kommunen nicht zügig genug vorangeht. Dazu stehen wir und das werden wir durchziehen.
Die dritte wichtige Botschaft lautet: Wir brauchen einen umfassenderen Begriff von Bildung. Diesen Punkt behandelt der Bericht sehr deutlich und ausführlich. Bildung findet viel früher statt und in viel mehr Kontexten, als man noch vor einigen Jahren dachte. Bildung findet nicht nur in der Familie statt, sondern auch in der Nachbarschaft, im Kindergarten, in der Freizeit und in den Medien. Bildung ist eben nicht nur mit Schule gleichzusetzen, sondern bedeutet, dass Kinder vielfältige Kompetenzen entwickeln. Da betont der Kinder- und Jugendbericht ganz ausdrücklich die frühkindliche Bildung und empfiehlt deshalb auch, mehr Möglichkeiten zu schaffen, damit Kinder schon ab dem zweiten Lebensjahr, also nach dem ersten Geburtstag, einen Kindergarten besuchen können. Unter dem schönen Motto „Kinder brauchen mehr als Windeln“ weist der Kinder- und Jugendbericht darauf hin, dass der Kontakt zu Gleichaltrigen als Ergänzung zur Erziehung in der Familie wichtig ist.
Die vierte wichtige Botschaft des Berichtes: Wir brauchen eine nachhaltige Familienpolitik, um Kinder und Jugendliche zu stärken. Dazu gehört der Ausbau der Betreuung. Der Bericht weist aber auch noch einmal sehr deutlich darauf hin, dass wir etwas tun müssen, um im ersten Lebensjahr des Kindes die Eltern finanziell zu unterstützen. Deshalb ist der Weg der großen Koalition, das Elterngeld einzuführen, richtig.
Ich wundere mich immer über den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, der einerseits das Elterngeld ablehnt und gleichzeitig im eigenen Land massive Kürzungen bei Kindertageseinrichtungen, bei der Familienbildung und bei der Jugendförderung vornimmt. Wenn das Jahr 2006 zum Jahr des Kindes ausgerufen wird, gleichzeitig aber 75 Millionen Euro bei den Kindergärten gekürzt und stattdessen Polizeipferde und Landwirtschaftskammern unterstützt werden, dann empfehle ich die Lektüre des Kinder- und Jugendberichtes. Das müsste eigentlich zu einem Umdenken führen.
In dieser Woche will ich auch eine Anmerkung zu einem Thema machen, das heute früh schon auf der Tagesordnung stand, nämlich die Reform unserer Verfassung. Ich denke, wir sollten bei dieser Reform darauf achten, dass wir handlungsfähig bleiben und uns nicht den Weg verbauen, notwendige Schritte für die Verbesserung der Chancen von Kindern und Jugendlichen zu tun. Viele von uns haben die Umsetzung des 4-Milliarden-Euro-Programms für mehr Ganztagsschulen begleitet. Das war ein außerordentlich wichtiger Schritt. Es war sehr schwierig, das im Föderalismus umzusetzen; aber es war nicht unmöglich. Wir sollten uns solche Möglichkeiten erhalten; denn Deutschland ist eines der letzten Länder Europas, die noch eine Halbtagsschule haben. Wenn wir hier den Anschluss an die europäische Entwicklung schaffen wollen, müssen wir in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Bildungspolitik und bei den Investitionen für Kinder und Jugendliche bundesweite Standards setzen können.
Noch ein Satz zur aktuellen Diskussion über die Gebührenfreiheit von Kindertageseinrichtungen, die wir alle zu Recht, wie ich finde, immer wieder fordern: Ja, auch die SPD will langfristig die Gebührenfreiheit. Unser erster Schritt ist der Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten. Das ist immer noch nötig, auch angesichts der regionalen Unterschiede. Wir wollen, dass alle Kinder in den Kindergarten gehen können und vor der Schule die deutsche Sprache richtig lernen können. Das ist ganz wichtig.
Ich weise auf ein Beispiel hin, wie das positiv umgesetzt werden kann. Rheinland-Pfalz hat das Programm „Zukunftschance Kinder: Bildung von Anfang an“ umgesetzt. Dort ist seit dem 1. Januar dieses Jahres das letzte Kindergartenjahr gebührenfrei. Gleichzeitig werden die Kindergärten schon für Zweijährige geöffnet und damit auch in der Fläche erhalten. Da hat Kurt Beck, wie ich finde, eine gute Tat vollbracht und ein sinnvolles Programm vorgeschlagen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Erich Kästner hat einmal gesagt: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Das Beispiel in Rheinland-Pfalz zeigt: Man kann es tun, wenn man will. Man kann mehr investieren für Kinder und Jugendliche. Man kann die Prioritäten richtig setzen, wie uns das auch der Kinder- und Jugendbericht vorschlägt.
Ich finde, dass wir auf der Bundesebene in der großen Koalition auf einem guten Weg sind, diese Priorität in der Kinder- und Jugendpolitik gut zu setzen.
Unser roter Faden ist, dass Kinder eine gute Zukunftschance haben. Das ist unsere Politik für mehr Chancen für Kinder. Denn nur eine kinderfreundliche Gesellschaft hat eine gute Zukunft. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir daran gemeinsam weiterarbeiten.
Vielen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nächste Rednerin ist die Kollegin Diana Golze für die Fraktion Die Linke.
Diana Golze (DIE LINKE):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Zum wievielten Mal stehen bzw. sitzen wir heute eigentlich im Deutschen Bundestag und beklagen gravierende Mängel im deutschen Bildungs- und Betreuungssystem? Diejenigen unter Ihnen mit mehr Sternchen vor dem Namen im Kürschner als ich dürften sich an das eine oder andere Mal noch erinnern.
Nun haben wir es mit der etwas außergewöhnlichen Situation zu tun, dass der Bericht durch die abgewählte rot-grüne Bundesregierung in Auftrag gegeben und die vorliegende Stellungnahme ebenfalls durch die Vorgängerregierung vorgelegt wurde. Ich freue mich daher sehr, dass Frau Ministerin von der Leyen zahlreiche Einschätzungen und Empfehlungen des Berichts teilt.
Welches sind die wichtigsten Feststellungen und Forderungen des Zwölften Kinder- und Jugendberichts und welche Schlussfolgerungen sollten wir daraus ableiten? Die Berichtskommission und die Stellung nehmende Bundesregierung sind sich darüber einig, dass es gravierende Mängel im öffentlichen Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangebot gibt, und konstatieren übereinstimmend einen großen Nachholbedarf. Ich begrüße besonders das von der Bundesregierung in diesem Zusammenhang abgelegte Bekenntnis zu einem öffentlich verantworteten System von Bildung, Betreuung und Erziehung sowie zur Verantwortung von Politik für die Schaffung guter Rahmenbedingungen für das Heranwachsen der jungen Generation. Ich sehe in diesem Bekenntnis der Bundesregierung einen Anlass für einen Politikwechsel, mit dem die Interessen von Kindern und Jugendlichen wirklich in den Mittelpunkt gestellt werden und all jenen eine Absage erteilt wird, die Kinder- und Jugendpolitik für Luxus halten.
Mit einem Lächeln aufgenommen habe ich das Bedauern der Bundesregierung darüber, dass sich die Berichtskommission nur unzureichend mit dem abgestimmten System in der DDR von Bildung, Betreuung und Erziehung vom frühen Kindesalter bis zur Ausbildung als Teil deutscher Entwicklung auseinander gesetzt hat. Ich zitiere aus der Stellungnahme der Bundesregierung:
Der Bericht beansprucht, die bisherige Situation in Deutschland zu erfassen, und wird dem durch die im Schwerpunkt eingenommene westliche Perspektive nicht gerecht.
Ich hoffe, die jetzige Bundesregierung schließt sich schon allein aufgrund der Herkunft der Vorsitzenden von zwei der drei regierungsbildenden Parteien dem Standpunkt an, dass die Erfahrungen des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungssystems der DDR zur Verbesserung der jetzigen Situation beitragen können.
Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht steht unter dem Leitgedanken „Bildung, Betreuung und Erziehung vor und neben der Schule“. Bereits die kleine Abwandlung im Titel des Berichts - es sollte ja „vor und in der Schule“ heißen - zeigt, dass die Berichtskommission erkannt hat, dass sich das Leben von Kindern und Jugendlichen an unterschiedlichen Orten abspielt und auf vielfältige Weise geprägt wird. Die Verfasser des Berichts ziehen eine analytische Grenze am Ende des Besuchs der allgemeinbildenden Schule. Diese Einschränkung darf aber nicht den Blick auf eine ganzheitliche Analyse der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen verstellen.
Zu diesen Rahmenbedingungen gehören auch die immer stärker um sich greifende Prekarisierung und Verunsicherung auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Diese haben ebenso Auswirkungen auf die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen wie die Tatsache, dass Familien nach dem althergebrachten Bild „verdienender Vater, erziehende Mutter“ längst nicht mehr die dominante Lebensweise sind, in die Kinder hineingeboren werden. Immer öfter erleben Kinder und Jugendliche Brüche und Veränderungen von familiären Situationen.
Welche Folgen hat dies nun für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen? Familie und Schule haben ihren monopolartigen Anspruch auf die Organisierung und Umsetzung von Bildung, Betreuung und Erziehung verloren. Kinder und Jugendliche verbringen einen großen Teil ihrer Zeit an anderen Bildungsorten und in anderen organisatorischen Zusammenhängen. Musik- und Kunstschulen, selbst organisierte Jugendgruppen oder einfach lose Gruppen von Gleichaltrigen spielen eine immer stärker werdende Rolle. Die Berichtskommission unterstreicht zu Recht, dass diesen Lernwelten eine größere Bedeutung zukommt.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auf zwei Punkte aufmerksam machen, die man auch nachlesen kann. Erstens. Bereits 1973 stellte die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung in ihrem Bildungsgesamtplan fest:
Das Bildungswesen umfasst nach neuem Verständnis nicht nur Schule, Hochschule und berufliche Bildung, sondern auch die Elementarerziehung, eine systematisierte Weiterbildung und die außerschulische Jugendbildung.
Sie setzte sich deshalb folgendes Ziel:
Verbesserte Koordinierung der Arbeit öffentlicher und freier Träger und verstärkte Kooperation der außerschulischen Jugendbildung mit dem übrigen Bildungswesen.
Diese Forderung findet sich nun auch im Zwölften Kinder- und Jugendbericht wieder. Hier wird großer Wert auf die Förderung der Zusammenarbeit von Schule, Familie und Jugendhilfe gelegt.
Zweitens. Nun haben wir es aber gleichzeitig mit der Situation zu tun, dass wir uns morgen in diesem Saal mit der geplanten Föderalismusreform beschäftigen. Bestandteil dieses Reformvorhabens ist die teilweise Zerschlagung dieser Trias. Denn zumindest auf der Bundesebene wird der Einfluss auf Bildungsstandards und Bildungschancen aus der Hand gegeben. Nur auf die Vernunft der Kultusministerkonferenz zu setzen, wie es der Brandenburger Staatskanzleichef Clemens Appel von der SPD gestern in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ verlautbart hat, ist mir, ehrlich gesagt, zu riskant.
Ich fordere vor allem die SPD-Mitglieder im Bundestag und Bundesrat auf, diese „größte Kröte“ - Zitat Appel - nicht zu schlucken.
Ich warne in diesem Zusammenhang auch davor, das Kinder- und Jugendrecht aus der Bundeshand zu geben. Sparzwänge und das Deckmäntelchen Bürokratieabbau könnten in vielen Bundesländern schnell zu eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten der Jugendämter führen. Dies darf im Interesse der Kinder und Jugendlichen nicht geschehen.
Nach meiner Auffassung und der meiner Fraktion muss die Bundesregierung ihrer Verantwortung für den chancengerechten Zugang zu allen Lernwelten nachkommen.
Stichwort „chancengerechter Zugang“: Ein realistischer Blick offenbart, dass sich die Chancen vieler Kinder und Jugendlicher auf einen gelungenen Start in ein selbst bestimmtes Leben in den letzten Jahren massiv verschlechtert haben. Die Kinder- und Jugendarmut steigt konstant. Im Kinder- und Jugendbericht wird die Situation in angemessener Weise und mit zutreffenden Befunden geschildert. Seit den 90-er Jahren des 20. Jahrhunderts steigt die Armutsquote unter Kindern und Jugendlichen. Die Verschärfung der Sozialgesetze hat im Jahr 2005 zu einer erheblichen Verschärfung geführt. Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband errechnete für Mitte 2005, dass sich bundesweit fast jedes siebente Kind unter 15 Jahren im Sozialgeldbezug befand.
Im Osten Deutschlands ist das Armutsrisiko noch größer. In einer Schulklasse mit 28 Kindern leben durchschnittlich sieben unterhalb der Armutsgrenze. Ein ebenso hohes Armutsrisiko haben Kinder nicht deutscher Eltern oder von Alleinerziehenden.
Armut umfasst aber nicht nur einen Mangel an finanziellen Ressourcen, sondern auch an sonstigen materiellen und immateriellen Gütern, Einschränkungen in sozialen und kulturellen Belangen, einen erschwerten Zugang zu allgemeiner Infrastruktur und wirkt sich nicht zuletzt auch auf den gesundheitlichen Zustand aus. Die Bundesregierung weist in ihrer Stellungnahme zwar auf die Gefahr von „Armuts-Bildungs-Spiralen“ hin, legt aber kein Konzept gegen diese insgesamt beunruhigende Entwicklung vor.
Schon 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung
stellte der Philosoph Konfuzius fest:
Bildung soll allen zugänglich sein. Man darf keine Standesunterschiede machen.
Diese Weisheit sollte Grundlage für die künftige Kinder-, Jugend- und Bildungspolitik der Bundesregierung sein.
Für den Fall, dass Ihnen dieses Zitat zu alt oder zu weit hergeholt erscheint, hier eines aus der jüngsten Geschichte: Die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin stand unter dem Leitgedanken „Mehr Freiheit wagen“. Lassen Sie mich dazu den polnischen Friedensnobelpreisträger Lech Walesa zitieren:
Der Mensch ist nicht frei, wenn er einen leeren Geldbeutel hat.
Deshalb finden Sie in unserem Entschließungsantrag zum Kinder- und Jugendbericht unter anderem die Forderung nach Anhebung des Kindergeldes auf 250 Euro als einen ersten Schritt in Richtung einer sozialen Grundsicherung für alle Kinder.
Mit einer weiteren Forderung, und zwar der nach dem elternbeitragsfreien Zugang zu öffentlichen Kindertageseinrichtungen für alle Kinder, schließen wir uns einer Empfehlung der Berichtskommission an.
Wie im Bericht festgehalten wird, darf frühkindliche Bildung nicht nur als Vorbereitungszeit für die Schule gesehen werden. Die frühkindliche Betreuung muss darüber hinaus qualitativ verbessert werden. Die Ausbildungsstandards für Erzieherinnen und Erzieher müssen den künftigen Ansprüchen besser genügen. Ihre Ausbildung muss ein praxisorientiertes Hochschulstudium werden.
Ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher müssen außerdem kontinuierlich weitergebildet werden.
Ich betone es noch einmal: Wir fordern den elternbeitragsfreien Zugang zu öffentlichen Kindertageseinrichtungen für alle Kinder. Damit verknüpfen wir die Forderung nach der Ausweitung des Rechtsanspruchs auf einen Kinderbetreuungsplatz ab der Geburt. Diese Ansprüche sind als Rechte der Kinder und unabhängig vom sozialen Status der Eltern zu gestalten. Im Bericht wird dieser Rechtsanspruch für zweijährige Kinder ab 2008 und ab 2010 für alle Kinder mit der Geburt gefordert.
Die Bundesregierung hält diese Forderung für verfrüht. Wie verträgt sich diese Einschätzung aber mit dem in ihrer Stellungnahme erklärten Ziel - ich zitiere -, „Deutschland bis zum Jahr 2010 zu einem der kinder- und familienfreundlichsten Länder Europas zu machen“? Das Tagesbetreuungsausbaugesetz, in dem bis zum Jahr 2010 230 000 neue Betreuungsplätze versprochen werden, reicht für die Umsetzung dieses Ziels nicht aus -
schon allein deshalb nicht, weil die versprochene Entlastung der Länder und Kommunen in Höhe von jährlich 2,5 Milliarden Euro durch die Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe im Jahr 2005 nicht so eingetreten ist. Also können Länder und Kommunen davon auch nicht 1,5 Milliarden Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung für unter Dreijährige verwenden. Beispiel Land Brandenburg: Allein in diesem Bundesland stehen die Landkreise als Träger der kommunalen Kindertageseinrichtungen in diesem Jahr nach Aussage des Landkreistages mit 300 Millionen Euro in der Kreide. Das ist so viel wie noch nie.
Wenn sich also die Bundesregierung 2010 mit dem Prädikat „kinder- und familienfreundliches Land“ schmücken will, muss sie nicht nur die Rechtsansprüche ausweiten und die Qualität der Betreuung verbessern, sondern auch Länder und Kommunen verlässlich in die Lage versetzen, diese Ansprüche umzusetzen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, die im Zwölften Kinder- und Jugendbericht benannten Probleme dürfen nicht weggeredet werden. Der Bericht ist kein Anlass für Sonntagsreden, sondern für einen politischen Kurswechsel im Sinne der Kinder und Jugendlichen.
Vielen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nächste Rednerin ist die Kollegin Renate Künast, Bündnis 90/die Grünen.
Renate Künast (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Was wir brauchen, ist doch tatsächlich eine grundsätzliche Neuausrichtung der Kinder- und Jugendpolitik, und zwar in allen Bereichen.
- Ja, ich komme gleich noch zur CDU/CSU-Fraktion. Gehen Sie doch lieber in Deckung, bevor Sie jetzt schon Zwischenrufe machen!
Die Vertreter der CDU/CSU wissen ja, dass zuvörderst die Bundesländer, also im Augenblick mit Mehrheit CDU- bzw. CSU-Ministerpräsidenten, für die Kinder- und Jugendpolitik zuständig sind.
In diesem Land haben wir diesbezüglich ein Defizit. In diesem Land merkt man immer noch, aus welchen Schichten, aus welchen Familien Kinder kommen. Bildung, Lebens-, Teilhabe- und Berufschancen hängen immer noch vom Geldbeutel der Eltern ab. Ob ein Kind gesund ist oder ob es chronische Erkrankungen hat, hängt in diesem Land überproportional vom Geldbeutel der Eltern ab. Genau deshalb brauchen wir eine systematische Veränderung der Kinder- und Jugendpolitik, nicht nur auf Bundesebene, sondern vor allem in den Ländern.
Ich will Ihnen sagen, um was es an der Stelle geht: Es geht um ein kindgerechtes und gesundes Lebensumfeld. Dabei geht es nicht allein um die Punkte, die hier schon angesprochen worden sind; dabei geht es natürlich auch zum Beispiel um Umweltfragen. Auch REACH, die Chemikalienrichtlinie der EU, wäre in diesem Zusammenhang zu nennen. Das müsste man auch unter dem Gesichtspunkt angehen: Welcher Belastung sind eigentlich Kinder ausgesetzt? Um ein weiteres Beispiel zu nennen: Wann wird die Schadstoffbelastung in den Städten nicht nur auf Höhe der Nasen der Erwachsenen, sondern auch auf Höhe von Nasen der zwei- oder dreijährigen Kinder, also direkt am Auspuff des Autos, gemessen? Auch das ist damit gemeint, wenn wir sagen, das Lebensumfeld muss verändert werden.
Wir brauchen eine gute und gesunde Schule, einen guten und gesunden Kindergarten, wobei Sport, die richtige Ernährung und Verlässlichkeit dazu gehören. Wir brauchen ferner eine kinderfreundliche Stadtplanung. Es sollte nicht so sein, dass man Eintritt zahlen muss, damit sich ein Kind in der Freizeit körperlich bewegen kann. Ebenfalls brauchen wir neue Bedingungen für das Leben mit Kindern im Rahmen der Arbeitswelt. Schließlich benötigen wir auch noch Folgendes: Die öffentlichen Haushalte müssen daraufhin auf den Prüfstand gestellt werden, ob Ausgaben für Kinder wirklich in den Mittelpunkt gestellt werden oder ob an alten Subventionen und Privilegien festgehalten wird.
- Gut, dass ein Zwischenruf von der FDP gekommen ist. Das Folgende wollte ich nämlich noch zu der Rede von Frau Gruß, einer meiner Vorrednerinnen, sagen - ich wollte es nicht als Zwischenruf machen, weil es ihre erste Rede war -: Ihre Rede war schön und hörte sich gut an. Sie waren für Joint-Venture-Projekte; Sie wollten, dass wir endlich Geld in Kinder investieren. Aber Ihre Rede ist doch, noch bevor Sie sie gehalten haben, wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Wo ist denn der FDP-Antrag? Sie wollten ihn hier einbringen, aber Ihre Finanzer haben ihn zurückgezogen, weil die in ihm enthaltenen Vorschläge zu viel Geld kosten. So stellt man Kinder nicht in den Mittelpunkt seiner Politik. Das ist eben eine zentrale Gerechtigkeitsfrage.
Wenn Sie, Frau von der Leyen, sagen - auch im Kinder- und Jugendbericht steht das -, wir haben einen unübersehbaren Nachholbedarf, kann ich Ihnen nur entgegnen: Dieser Nachholbedarf ist auch ein Stück weit das Ergebnis - wie in Italien oder Spanien - einer konservativen Familienpolitik. Wir könnten längst weiter sein.
Das hat ja hier keiner vergessen: Im Jahre 2004 haben die CDU- bzw. CSU-regierten Länder nahezu hasserfüllt gegen das Tagesbetreuungsausbaugesetz gestimmt, weil sie behauptet haben, wir wollten die Frauen aus den Familien herausdrängen.
Ich sage Ihnen: Die jungen Frauen wollen beides, Erwerbstätigkeit und Kinder. Aber Sie müssen sie auch lassen und ihnen tatsächlich eine Wahlfreiheit geben; darum geht es.
Sie, Frau von der Leyen, wollen jetzt etwas ändern und setzen dabei auf Geld. Das allein genügt nicht. Denn das Modell, das Sie vorgeschlagen haben, ist ein Glücksfall für die Steuerberater. Sie und auch diejenigen, die heute schon über Privilegien verfügen, bekommen Privilegien eingeräumt.
- Stellen Sie eine Zwischenfrage; davon haben wir beide mehr.
Wenn Sie sich das Modell genauer ansehen, stellen Sie fest, dass diejenigen, die heute über wenig Einkommen verfügen, viel weniger bei den Steuern werden absetzen können. Ich sage Ihnen dagegen: Uns muss jedes Kind gleich viel wert sein; das Kind derer, die schon Geld haben, darf uns nicht mehr wert sein.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Frau Kollegin Künast, die Bestellung von Zwischenfragen ist zwar in der Geschäftsordnung nicht ausdrücklich vorgesehen, aber immer wieder beliebt. Und prompt hat sich die Kollegin Lenke auch zu einer solchen Zwischenfrage bereit gefunden. Stimmen Sie dem Begehren zu?
Renate Künast (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Bitte.
Ina Lenke (FDP):
Frau Künast, ich stimme mit Ihrer Kritik überein, dass das vermurkste Modell der Kinderbetreuungskosten der großen Koalition den Steuerberatern viel zu tun gibt. Ich sage Ihnen aber auch: Sie haben in der letzten Legislaturperiode dafür gesorgt, dass die ersten 1 500 Euro gar nicht absetzbar sind. Das ist der größte Murks gewesen, der jetzt von der großen Koalition zu einem kleineren Murks umgewandelt wird. Daher frage ich Sie: Waren Sie mit dem Modell Ihrer rot-grünen Koalition so einverstanden, dass Sie dafür in der letzten Legislaturperiode die Hand gehoben haben?
Renate Künast (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Die FDP ist sehr koalitions- und kompromisserfahren, daher kann ich Ihnen Ihren Einwand als Koalitionskompromiss zurückgeben. Ich freue mich jedoch, dass auch die FDP vorwärts will.
Vielleicht können wir - wir haben uns mit einem Antrag festgelegt - jetzt gemeinsam über für die Zukunft wichtige Fragen reden. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz war schon immer grüne Position. Wir brauchen einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Dabei geht es um eine zentrale Infrastruktur. Vielleicht können Sie dabei mitmachen und Ihren Antrag entsprechend gestalten.
Wer heute Kinder haben will, braucht Infrastruktur, Geld und Zeit. Deshalb reicht es nicht, Frau von der Leyen, nur davon zu reden, dass es auf den Anfang ankomme. Sie müssen darüber hinaus auch für die Strukturen sorgen. Schöne Worte reichen hier nicht aus. Werfen Sie sich bei der Verfassungsreform in die Bresche! Es kann doch nicht sein, dass Sie hier sagen, auf den Anfang kommt es an, und den Bund bei der Verfassungsreform aus dem gesamten Themenkomplex „Kinder und Bildung“ herauskatapultieren und ihm nicht einmal mehr die Möglichkeit einräumen, Kindern in armen Bundesländern mit Finanzmitteln hilfreich unter die Arme zu greifen. Es ist doch nötig, verschuldeten Bundesländern dabei zu helfen, die Infrastruktur, beispielsweise Ganztagsschulen, auszubauen. Ich sage Ihnen: Wir müssen jetzt etwas tun und nicht erst im Jahr 2010.
Wir wollen den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr. Frau von der Leyen, Sie haben ehrgeizige Ziele für das Jahr 2010, aber wir haben jetzt schon März 2006. Wenn Sie darauf warten, dass die Länder etwas aufbauen, werden zwei, drei Jahre vergehen und Sie haben bis dahin vielleicht ein Gesetz verabschiedet, aber im Vergleich mit anderen Ländern liegen wir noch weiter zurück. Deshalb müssen wir jetzt springen. Auf den Anfang kommt es an. Das gilt nicht nur für die Kinder, sondern auch für die CDU/CSU und diese Regierung.
Wir wollen Kinder in den Mittelpunkt unserer Politik stellen. Wir wollen deshalb die Infrastruktur für sie ausbauen. Unsere Idee ist ein Kinderbetreuungsgeld. Die Eltern sollen einen Pauschalbetrag bekommen, der den Kosten für den tatsächlich in Anspruch genommenen Betreuungsplatz entspricht. Auch hier kommt es darauf an, mutig anzufangen. Den benötigten Betrag wollen wir durch die Senkung des Ehegattensplittings gegenfinanzieren. Wir wollen wirklich Geld für die Betreuung und Förderung der Kinder und nicht für die Ehe ausgeben. Ich gratuliere jedem, der eine gute Ehe führt, aber die Ehe an sich geht uns nichts an, uns gehen die Kinder etwas an.
Ich möchte Herrn Kauder zitieren - gerade war er noch hier, doch jetzt ist er weg.
- Ach, da ist er ja. - Er hat vor kurzem gesagt: Die Realität hat sich verändert und die CDU/CSU ändert sich auch. Ich möchte Ihnen dazu sagen: Schon in den 70er- und 80er-Jahren wollten die Frauen beides, Kinder und Beruf. Realität ist darüber hinaus auch - und das schon seit Jahrzehnten -, dass Kinder aus armen Familien weniger gute Chancen haben und unsere Unterstützung brauchen. Die Gesellschaft und die Wirtschaft brauchen gut ausgebildete Kinder. Geben Sie sich einen Ruck! Herr Kauder, auf den Anfang kommt es an. Beginnen Sie jetzt! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es geht nicht darum, dass die Eltern Belege für die Steuerberater erhalten, es geht vielmehr darum, dass die Kinder in Deutschland eine gute Kinderbetreuung erhalten.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nun erhält der Kollege Thomas Dörflinger für die CDU/CSU-Fraktion das Wort.
Thomas Dörflinger (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Künast, dafür, dass Sie sich in den letzten sieben Jahren nicht zuvorderst mit Kinder-, Jugend- und Familienpolitik befasst haben,
können Sie nichts. Aber in Ihrer Rede hat man das an der einen oder anderen Stelle gemerkt.
Ich will mit Blick auf das, was wir am morgigen Tag unter dem Stichwort Föderalismusreform miteinander beraten, zunächst einmal festhalten, dass das Kinder- und Jugendhilfegesetz ein Bundesgesetz ist und bleibt. Daran ändert sich auch nichts. Das, was wir am morgigen Tag miteinander beraten, erklärt sich insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir die Finanzbeziehungen zwischen dem Bund und den Ländern entflechten wollen und keine neuen Tatbestände schaffen wollen, durch die sich die Finanzbeziehungen verflechten.
Ich habe mir Ihren Vorschlag angesehen, meine Damen und Herren vom Bündnis 90/Die Grünen, ein Kinderbetreuungsgeld einzuführen, das sich aus dem bisherigen Ehegattensplitting speist. Es ist nicht unbedingt ein Beitrag zur Vereinfachung der Finanzbeziehungen, wenn Sie den Familien, die aus dem Ehegattensplitting profitieren, das Geld wegnehmen und es ihnen anschließend über das Kinderbetreuungsgeld wiedergeben,
damit sie dann die Kindertagesstätte bezahlen können. Wo liegt da der Vereinfachungseffekt bei den Finanzbeziehungen? Das erschließt sich mir nicht.
Ich will zunächst einmal im Namen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an die Expertenkommission, die den Zwölften Kinder- und Jugendbericht für die Bundesregierung erstellt hat, ein herzliches Wort des Dankes sagen.
Insbesondere im Analyseteil liefert dieser Bericht wertvolle Erkenntnisse. Ich sage dazu: Wenn man diesen Analyseteil aufmerksam liest und die Titelgeschichte des „Spiegel“ aus dieser Woche daneben legt, dann wird man nicht nur als Politiker, sondern auch als Eltern an der einen oder anderen Stelle nachdenklich
und stellt sich die Frage, ob wir es ein Stück weit verlernt haben, richtig mit Kindern umzugehen, wie es der „Spiegel“ in seiner Titelgeschichte beschreibt.
Wir stellen fest, dass die Zahl der Eltern, die mit ihrer Erziehungsaufgabe überfordert sind, tendenziell steigt. Das provoziert die Frage: Wie gehen wir als Staat mit unserem Nachwuchs um und wie schaffen wir die Rahmenbedingungen dafür, dass sich Eltern besser als in der Vergangenheit der Aufgabe widmen können, ihre Kinder so zu erziehen, dass sie verantwortungsbewusste Staatsbürgerinnen und Staatsbürger werden?
Lassen Sie mich auf einige Empfehlungen der Kommission zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit eingehen. Die Kommission fordert, die Politik müsse die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Eltern in der Lage sind, ihren Erziehungsaufgaben im Interesse ihrer Kinder nachzukommen, insbesondere in den frühen Lebensstadien der Kinder. Ich sage: Die Bundesregierung tut dies ausweislich des Koalitionsvertrages dadurch, dass wir das Elterngeld einführen - wir sind auf dem besten Wege dorthin -, dass wir uns intensiv Gedanken darüber machen, was wir leisten können, um die Erziehungskompetenz von Eltern zu stärken - weniger im Sinne von Sanktionsmechanismen als eher im Sinne von Anreizmechanismen, im Sinne von Best-Practice-Systemen -, und dass wir als Gesetzgeber dafür sorgen - wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben in den letzten Tagen dazu einen Vorschlag gemacht -, dass die Fälle von Kindesmisshandlungen in unterschiedlichen Lebensstadien der Kinder, die uns wohl alle gleichermaßen schockiert haben, zukünftig der Vergangenheit angehören. Hier ist der Gesetzgeber in der Pflicht. Ich füge ausdrücklich hinzu: Die Einführung von Sanktionen im Rahmen des Strafgesetzbuches ist eine Möglichkeit. Aber es ist weder die einzige noch die einzig zielführende. Es braucht einen ganzen Strauß von Möglichkeiten, um Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken.
Wenn im Bericht darauf hingewiesen wird, dass Erziehung auch eine Frage der materiellen Rahmenbedingungen für Eltern ist, dann geht es nicht nur um das Elterngeld und die Abzugsfähigkeit der Kinderbetreuungskosten von der Steuer, sondern dann heißt das auch - darauf kann am heutigen Tage vor dem Hintergrund der gestern im Finanzausschuss stattgefundenen Anhörung hingewiesen werden -, dass das Gesetz zur steuerlichen Förderung von Wachstum und Beschäftigung an der einen oder anderen Stelle gezielt darauf ausgerichtet ist, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Eltern und Familien im Sinne von mehr Jobs für Eltern zu verbessern, sodass die finanziellen Rahmenbedingungen für Familien in der Zukunft stimmen.
Ich sehe allerdings den Teil des Kommissionsberichtes, der die politischen Forderungen enthält, an der einen oder anderen Stelle kritisch.
Wir befinden uns in der nachgerade klassischen Situation der Spannungsbeziehungen zwischen Bund und Ländern in den Handlungsfeldern Bildung und Erziehung. Wir sollten uns alle miteinander darauf kaprizieren, dass im Deutschen Bundestag in Berlin Entschließungsanträge mit wohlfeilen Forderungen, deren Ausführende in den Bundesländern oder Kommunen sitzen, ein für alle Mal der Vergangenheit angehören. Auch dazu leistet der morgige Tag unter dem Stichwort Föderalismusreform einen Beitrag. Es soll gelten: Wer bestellt, bezahlt. Auch in dieser Frage müssen klare Zuständigkeiten und klare Finanzbeziehungen herrschen.
Mit Blick auf das eine oder andere, was ich in diesem Zusammenhang höre - Entschließungsanträge werden dem Hohen Hause sicherlich noch vorgelegt -, sage ich: Es wäre schön, wenn sich alle Fraktionen in diesem Hohem Hause an diese Maxime halten würden und wir das, was wir an politischen Forderungen erheben, zunächst einmal im eigenen Zuständigkeitsbereich zu verwirklichen suchen und nicht anderen vor die Haustür legen.
Lassen Sie mich mit Blick auf die Forderung der Kommission nach einer Verstärkung von Ganztagsangeboten, die unsere ausdrückliche Unterstützung findet, einen letzten Punkt ansprechen. Ich will auf einen Teilaspekt hinweisen, den die Kommission in ihrem Bericht antippt und der mir als Baden-Württemberger sehr wichtig ist. Der Ausbau der Ganztagsbetreuungseinrichtungen in den Bereichen Schule und Kindergarten vollzieht sich in einem Spannungsfeld zwischen dem, was aus bildungspolitischen und erziehungspolitischen Gesichtspunkten notwendig ist, und dem, was an ehrenamtlichen Strukturen in den Ländern, in den Kommunen bereits besteht. Ich denke etwa an das, was Ehrenamtliche in der Jugendarbeit der Vereine und Verbände leisten, was gleichzeitig ein wesentlicher Beitrag zur pädagogischen Qualifikation von Jugendlichen und Kindern ist.
Deswegen stehen wir in der Pflicht, die Konzeption der Ganztagsbetreuung in den Bereichen Schule und Kindergarten bzw. Kindertagesstätte mit bestehenden ehrenamtlichen Strukturen in unseren Städten und Gemeinden abzustimmen. Wir müssen der Frage nachgehen, ob das an dem einen oder anderen Punkt eventuell intelligent miteinander verknüpft werden kann. Ich rate dazu, einen Blick nach Baden-Württemberg zu werfen, beispielsweise in meinen Wahlkreis, nach Bonndorf. Dort hat man sich dieser Frage erfolgreich gewidmet und ein Projekt auf den Weg gebracht, das als wegweisend gelten könnte und dieser Maxime entspricht.
In diesem Sinne freue ich mich auf interessante Beratungen im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zumZwölften Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung.
Herzlichen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält nun die Kollegin Ekin Deligöz, Bündnis 90/Die Grünen.
Ekin Deligöz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Debatte hat vor allem eines gezeigt, nämlich dass sich in diesem Land in den vergangenen sieben Jahren richtig viel verändert hat.
Der besondere Stellenwert der Förderung der Bildung von Kindern und Jugendlichen ist erkannt worden. Er wurde nicht nur von den Parteien und Verbänden erkannt, sondern auch von den Eltern und Familien, von den Lehrerinnen und Erzieherinnen und sogar von der CDU und der CSU. Herr Dörflinger, Sie können hier noch so oft sagen, dass man sich an alten, traditionellen Werten orientieren sollte. Selbst Frau Stewens und Herr Koch reden davon. Das sollten Sie einmal zur Kenntnis nehmen.
In diesem Land hat sich noch etwas bewegt. Die Sicht auf Kinder und auf die Kindheit hat sich verändert. Kinder sind vom ersten Tag an Persönlichkeiten. Sie sind Rechtssubjekte, sie haben eigene Rechte. Sie entwickeln frühzeitig Kompetenzen, sie wollen lernen. Unsere Aufgabe ist es, sie dabei zu fördern, indem wir die richtigen Rahmenbedingungen schaffen.
Im Rahmen dieser Debatte höre ich von allen Seiten übereinstimmend, dass dieser Kinder- und Jugendbericht, der genau das in den Mittelpunkt stellt, begrüßt wird. Das ist gut; in unserem Antrag sagen wir das ausdrücklich. Wir wissen, dass heute eigentlich niemand gegen bessere Förderung und Bildung sein kann. Dass wir dieses Projekt gemeinsam anpacken müssen, liegt auf der Hand. Das ist klar und übrigens nicht nur Aufgabe der Politik.
Jetzt kommt der entscheidende Punkt: Was tun wir dafür, dass die Empfehlungen aus dem Bericht auch tatsächlich umgesetzt werden?
In Sonntagsreden den Kommissionsvorsitzenden Professor Rauschenbach zu zitieren, ist gut. Aber das reicht nicht aus.
Für die Realisierung brauchen wir klare politische Konzepte, die meiner Meinung nach zwei Punkte beinhalten müssen: Erstens. Man muss Verantwortung übernehmen; in dieser Verantwortung steht auch der Bund.
Zweitens. Wir müssen auch in fiskalischer Hinsicht eine ganz klare Priorität zugunsten unserer Kinder setzen. Wir müssen dabei die Kinder in den Mittelpunkt rücken, statt ideologische Debatten zu führen.
Wir Grüne beachten beide Aspekte, auch die Verantwortung des Bundes. Er muss und kann - das ist im Übrigen auch seine Aufgabe - im Kinder- und Jugendhilfegesetz einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter Dreijährige verankern. Das ist der einzig mögliche Weg, um zeitnah und verbindlich das notwendige Betreuungsangebot für Kinder dieser Altersklasse zu schaffen.
Der Bund sollte sich auch aus der Finanzierung dieser Maßnahme nicht heraushalten, sondern sich daran beteiligen. Mit dem TAG haben wir den ersten Schritt in diese Richtung gemacht. Weitere Schritte müssen nun folgen. Mit dem Kinderbetreuungsgeld schlagen wir Grüne Ihnen ein Konzept vor, mit dem wir dafür sorgen können, dass das Geld genau dort ankommt, wo es gebraucht wird: bei der Inanspruchnahme von Betreuungseinrichtungen. Dadurch stärken wir die Nachfragekompetenz und die Beteiligung der Eltern und lassen die Kommunen bei der Mammutaufgabe des Ausbaus der Kinderbetreuung und -erziehung nicht allein.
Die Kinder in den Mittelpunkt stellen - das und nichts anderes hat für uns Priorität. In den Reihen der großen Koalition heißt es, man wolle sich irgendwann, womöglich im Jahre 2010, Gedanken über die Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz machen. Das ist uns zu wenig. Sie wollen sich offenkundig nicht festlegen. Vielleicht fürchten Sie auch Differenzen mit Ihren Landesfürsten. Nichtsdestotrotz, das ist zu unverbindlich und zu spät. Sie lassen die Betroffenen, die Mütter und Väter, im Stich. Das ist eine Politik, die an den tatsächlichen Erfordernissen im Alltag der Menschen komplett vorbeigeht.
Zur Prioritätensetzung möchte ich Ihnen noch etwas sagen: Seitens der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen heißt es völlig zu Recht, dass man in der falschen Reihenfolge vorgeht, wenn man zuerst das Elterngeld einführt und sich danach Gedanken über den Ausbau der Infrastruktur macht. Man muss genau umgekehrt vorgehen. Lassen Sie uns heute damit anfangen, unseren Kleinen die bestmögliche Förderung zu ermöglichen, damit sie einmal die Größten in unserem Lande werden.
Danke.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nächste Rednerin ist die Kollegin Marlene Rupprecht, SPD-Fraktion.
Marlene Rupprecht (Tuchenbach) (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Zwölfte Kinder- und Jugendbericht zum Thema „Bildung, Betreuung und Erziehung vor und neben der Schule“ ist angesichts der gesellschaftlichen und politischen Diskussion über Bildung sehr wichtig. Herzlichen Dank, dass Sie diesen Bericht vorgelegt haben! Dies können wir zum Anlass nehmen, um über dieses Thema statt in den Abend- und Spätabendstunden am heutigen Vormittag zu diskutieren. Ich danke den Fraktionen, dass sie die Bedeutung des Berichts verstanden haben und dieses Thema an den Anfang unserer heutigen Tagesordnung gesetzt haben.
Unsere Fraktionen und, wie ich an den Redebeiträgen gemerkt habe, das gesamte Parlament werden die Anregungen und Forderungen des Berichts aufgreifen und soweit wie möglich umsetzen. Ich sage „soweit wie möglich“, weil wir in unserem föderalen Staat nicht auf allen Ebenen das Zugriffs- und Wirkungsrecht haben. Deshalb ist eines dringend notwendig: die Kooperation aller Ebenen im Interesse der Kinder.
Ich danke den Kommissionsmitgliedern nicht nur für ihre umfangreiche Arbeit, sondern auch dafür, dass sie die Trias Bildung, Betreuung und Erziehung durchgängig dargestellt haben. Sie haben ihren Blick nicht auf den Bildungsbegriff verengt, sondern zur Kenntnis genommen, dass Bildung nur stattfinden kann, wenn alle drei Elemente berücksichtigt werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt dieses Berichts ist, dass man weggeht von der Diskussion über Bildungssysteme und hin zu einer Diskussion über Bildungsprozesse im Lebenslauf von Kindern und Jugendlichen. Das ist wirklich ein Paradigmenwechsel.
Anders als in vielen anderen Berichten wird in diesem Bericht endlich aus Kindersicht dargestellt, was Kinder brauchen und wie die Prozesse bei uns laufen müssen, damit Kinder die Welt annehmen können und in ihr herzlich willkommen sind; darauf kommt es nämlich an. Das ist die besondere Leistung des vorliegenden Berichts.
Ich finde es toll, dass Sie in Ihrem Bericht weggehen von dem ewigen Gejammer über Kinder und Kinder als wissbegierig, selbstständig, eigenverantwortlich, lernfähig und lernwillig darstellen. Kinder kommen als Persönlichkeiten auf dieser Welt an.
Auf die Schule komme ich noch zu sprechen.
Es ist also ein Prozess, in dem sich diese kleinen Persönlichkeiten mit der Welt auseinander setzen und sie sich aneignen. In diesem erweiterten Bildungsbegriff ist Bildung verknüpft mit vielen Lernwelten und Bildungsorten, mit vielen Gelegenheiten und Inhalten. Dies müssen wir berücksichtigen und entsprechend reagieren, damit wir Kindern die Vielfalt bieten, die sie brauchen, um sich zu entwickeln.
Ich will jetzt nicht auf die fiskalischen und materiellen Rahmenbedingungen eingehen - dies wurde von den Kolleginnen und Kollegen schon ausführlich dargestellt -, sondern als Kinderbeauftragte meiner Fraktion aus der Sicht der Kinder einige Punkte herausgreifen.
Wenn ein Kind auf dieser Welt ankommt, muss man ihm vermitteln: Herzlich willkommen!
Wir wissen aber, dass es Familien gibt, die zwar zum Zeitpunkt der Geburt noch gern Eltern sind, aber spätestens dann, wenn die ersten Probleme auftreten, an ihre Grenzen kommen und sich sagen: Wir sind als Eltern vielleicht nicht so optimal. Wir würden es gern sein, wissen uns aber nicht zu helfen. - Hier - wo notwendig, auch bereits während der Schwangerschaft - muss die Begleitung und Betreuung einsetzen, damit Kinder dieses „Herzlich willkommen!“ tatsächlich erfahren. Wir müssen die Familien unterstützen, damit Kinder diesen herzlichen Empfang bekommen.
Was wir nicht brauchen können, ist Strafe oder Druck. Druck haben die Eltern schon selber, wenn ihr Kind die Nacht durchschreit, sie vom Gefühl her eigentlich nicht mehr können und es an die Wand klatschen möchten, was man natürlich nicht tut. Es ist ein Gefühl der Hilflosigkeit, wenn ein kleiner Wurm schreit und schreit und man nicht damit fertig wird. Wenn das den ganzen Tag so geht und man bereits übermüdet ist, braucht man Hilfe und nicht noch den Druck, vor Gericht gezerrt zu werden. Diese Menschen brauchen Unterstützung.
Deswegen haben wir frühe Hilfen für Familien vorgesehen. Das kann nicht ein Einzelner leisten; das muss immer ein Konzert von Sozialarbeitern, Ärzten, und dem sozialen Umfeld sein. Wir haben schon viele Hilfsangebote. Sie richten sich aber überwiegend an die Mittelschicht; sie fragt diese Leistungen auch ab. Aber nur ganz wenige derer, die verzweifelt sind, finden den Weg zum Stadtteilzentrum, zur Krabbelgruppe. Solche Menschen brauchen aufsuchende Hilfe. Daran mangelt es uns noch. Ich denke, wir müssen die Familien in die Lage versetzen, ihren Kindern so viel Stabilität zu geben, dass sie loslassen können, dass die Kinder in Krabbelgruppen, in Gruppen mit Gleichaltrigen, in den Kindergarten gehen. Es ist notwendig, dass die Kinder neben den Schwierigkeiten, aber auch der Geborgenheit und Stabilität, die sie in der Familie erfahren, sehen, dass es auch eine Welt außerhalb der Familie gibt.
Trotz seines Wächteramts kann der Staat aber nicht ersetzen, was die Familie ist, nämlich die Insel, auf die man sich zurückziehen kann und auf der man Kraft tankt, um wieder hinauszugehen. Der Staat kann und darf die Familie hier nur unterstützen, damit sie diese Aufgabe wahrnehmen kann.
Bezüglich der Erziehung in Kindertagesstätten und Betreuungseinrichtungen ist schon vieles über Qualifizierung und Fortbildung gesagt worden. Natürlich haben wir hoch qualifizierte und gut ausgebildete Erzieherinnen. Aufgrund der wertvollen Menschen, die sie zu betreuen haben, ist aber darüber nachzudenken, ob die Bezahlung auch ihrer Leistung gerecht wird.
Damit komme ich zum Bereich Schule, in dem ich 20 Jahre lang gearbeitet habe. Ich weiß, dass das Deutsche Jugendinstitut Untersuchungen durchgeführt und herausgefunden hat, dass nur noch ein Drittel der Kinder gerne in die Schule geht. Ich frage mich, wo die anderen zwei Drittel geblieben sind, die einmal lernwillig und wissbegierig waren.
- Oh doch, das gibt es. - Die Schule muss also endlich umsteuern.
Im Kinder- und Jugendhilfegesetz steht die Verpflichtung der Kooperation aller am Kind Beteiligten. Ich frage mich, warum dies nach 15 Jahren Kinder- und Jugendhilfegesetz immer noch nicht geschieht. Ich verstehe das nicht. Die kommunale Jugendhilfeplanung schließt ein, dass sich alle am Kind Beteiligten - die Schule, in späteren Jahren die Arbeitsagentur, die Polizei, die Jugendverbände und die Jugendgruppen - gleichberechtigt als Partner mit einbringen sollen. Die Schule darf kein dominantes Element in diesem Konzert sein. Die Schule muss sich zurücknehmen und vielleicht auch zu einem neuen Denken finden. Die anderen müssen mehr Selbstbewusstsein im Umgang entwickeln.
Diese Kooperation würde dazu beitragen, dass die Welt und das Leben in die Schule hineinkommen. Vielleicht ginge das Burn-out-Syndrom bei denen, die mit Kindern umgehen, nämlich den Lehrern, zurück, wenn sie endlich mitbekämen, dass Erzieher - und nicht nur Wissensvermittler - zu sein eine ganz schöne Aufgabe ist, weil man sehr viel zurückbekommt, wenn man etwas gibt. Ich glaube, dies muss in der Ausbildung verankert und täglich gelebt werden. Hierfür brauchen wir die Unterstützung der Kinder in der Schule, aber auch derer, die unterrichten.
Das Ganze funktioniert aber nur, wenn man die Kinder in der Familie, in der Kindertagesstätte und in der Schule endlich als Heranwachsende ernst nimmt und beteiligt, und zwar nicht durch eine Mini-Playback-Show in der Politik, indem man sie einmal am Jugendparlament teilnehmen lässt und ihnen ansonsten sagt: Du bist ruhig. Beteiligen heißt, sie ernst zu nehmen und ihnen zu sagen, wo sie sich beteiligen können.
Es gibt Dinge, an denen auch ich mich nicht beteiligen kann. Da ist die Möglichkeit meiner Beteiligung schlicht und ergreifend begrenzt. Auch das gehört zum Ernstnehmen. Ich denke, wenn man die Kinder in diesem Bereich wirklich ernst nimmt, dann wird Schule auch anders gestaltet werden, dann werden sie nämlich als Teil der Schule angesehen und nicht nur als ein Element, in das Wissen hineingetrichtert wird.
Ich habe schon gesagt, dass das ein langer Weg ist. Nach 15 Jahren Kinder- und Jugendhilfegesetz stehen wir trotzdem manchmal noch am Anfang. Manche Kommunalpolitiker glauben immer noch, das sei eine freiwillige Leistung und keine Pflichtleistung.
- Ja, es ist leider so.
Ich möchte Ihnen deshalb die Schlussfolgerungen in dem Bericht gerne kurz vorlesen:
Es wird auf allen föderalen Ebenen...
- hier haben wir wieder den Föderalismus -
und unter Einbeziehung aller wichtigen gesellschaftlichen Akteure ... erheblicher Anstrengungen bedürfen, um gemäß diesen Leitlinien ein Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangebot auf- und auszubauen, so umzugestalten, dass seine Effektivität erhöht wird und dass Kinder und Jugendliche auf dem Weg des Erwachsenwerdens mit dem Wissen und Können, mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit den personalen und sozialen Kompetenzen ausgestattet werden, die sie brauchen, damit sie unter den absehbaren Bedingungen künftiger Gesellschaften über eine ausreichende Kompetenz zur eigenständigen Lebensführung verfügen.
Es wird noch ein weiter Weg sein, bis diese Anforderungen erfüllt werden. Ich hoffe, dass alle Beteiligten, ob Bundestag, ob Landtage, ob Kommunalpolitiker, an einem Strang ziehen und dies im Sinne der Kinder und unseres Landes gemeinsam umsetzen. Denn die Kinder sind nicht nur unsere Zukunft, sondern auch unsere Gegenwart.
Danke schön.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Für die CDU/CSU-Fraktion erhält jetzt das Wort der Kollege Johannes Singhammer.
Johannes Singhammer (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Kinder sind Leben. Kinder sind Liebe. Kinder sind das Kostbarste und Wichtigste, das unser Land hat. Kinder wachsen in einer intakten Familie am besten auf.
Der Bericht befasst sich mit der Situation der Kinder. Besorgniserregend ist die Entwicklung der Anzahl der Kinder generell. Die Zahl der Kinder in Deutschland nimmt immer weiter ab. Sind im Jahr 1965 - damals in beiden Teilen Deutschlands - noch 1,3 Millionen Babys geboren worden, so haben im letzten Jahr - der Präsident des Statistischen Bundesamtes hat vor wenigen Tagen die Zahlen für 2005 bekannt gegeben - nur noch 680 000 Kinder das Licht der Welt erblickt. Von den 680 000 Kindern hatten 80 000 Kinder nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Vor kurzem wurde in einer deutschen Zeitung die Frage gestellt: Was geht den Deutschen eher aus: die Kinder oder das Erdöl? Die Frage ist auch gleich beantwortet worden: die Kinder.
In dem Zwölften Kinder- und Jugendbericht wird davon gesprochen, dass die Kinder des Jahres 2006 und der darauf folgenden Jahre in einer völlig anderen Gesellschaft, nämlich in einer alternden Gesellschaft, aufwachsen, und zwar mit allen ökonomischen, aber auch emotionalen Konsequenzen für Kinder. Der „Spiegel“ hat in seinem Leitartikel, aus dem vom Kollegen Dörflinger schon zitiert worden ist, festgestellt - ich zitiere -:
Abnehmende Geburtenraten führen zur Vereinzelung der Kinder in unserer Gesellschaft. Nicht nur die finanzielle Zukunftssicherung ist davon betroffen - ohne Familie verlernt die Gesellschaft schlichtweg die Liebe.
Wenn wir aus dem Teufelskreis des Zerfalls familiärer und damit gesellschaftlicher Strukturen in unserem Land herauskommen wollen, dann brauchen wir in Deutschland zunächst eines: wieder mehr Kinder. Für diese Kinder benötigen wir dann optimale Bildung, Betreuung und Erziehung.
Für uns ist die intakte Familie durch nichts zu ersetzen. Wer Familien und Eltern unterstützt, die sich für Kinder entschieden haben, der hilft auch den Kindern. Mit dieser klaren Haltung unterscheiden wir uns von der Linken. Die Linke fordert in ihrem Antrag:
... Kinder- und Jugendpolitik darf nicht faktisch der Familienpolitik nachgeordnet werden.
Ich warne davor, einen Gegensatz zwischen Familien und ihren Kindern zu konstruieren. Wer die Familie unter dem Deckmäntelchen von Kinderinteressen durch staatliche Organisationen zurückdrängen oder gar ersetzen will, wird auf unseren entschiedenen Widerstand stoßen.
Die Familie ist kein Hort der Unterdrückung oder Triebverleugnung,
sondern der richtige Ort, um Kinder aufwachsen zu lassen. Wir wollen Elternhaus, Bildung und Betreuung miteinander verzahnen, sodass Familie und Beruf miteinander vereinbar sind, also die Möglichkeit des Lebens mit Kindern mit der des Broterwerbs.
Ich will noch auf einige Punkte des Kinder- und Jugendberichts eingehen. Wir wollen - das ist unser Anliegen -, dass vor allem die frühkindliche Entwicklung, insbesondere die Sprachkompetenz, verbessert wird. Deshalb halten wir die Einführung von Sprach- und Entwicklungstests vor der Einschulung für wichtig. Insbesondere die mangelnden Sprachkenntnisse von Familie mit ausländischem Hintergrund müssen uns besorgt stimmen. Denn wem es in der Schule an Sprachkompetenz fehlt, der läuft Gefahr, seinen Abschluss nicht zu schaffen, keinen Ausbildungsplatz zu erhalten und keine Möglichkeit einer beruflichen Karriere eröffnet zu bekommen. 19,2 Prozent der ausländischen Jugendlichen schaffen keinen Hauptschulabschluss, 40 Prozent stehen ohne berufliche Qualifikation da. Diese Zahlen geben Anlass zur Sorge.
Hinsichtlich der Empfehlungen zur Bildung, Betreuung und Erziehung im Schulalter liegt unser Hauptanliegen bei der Umsetzung eines umfassenden Bildungskonzepts im Zusammenspiel von Schule, außerschulischen Bildungsorten und Elternhaus. Ich möchte ausdrücklich denen danken, die in dem Bericht erwähnt sind. Ich möchte insbesondere den Sportvereinen danken, die ein großes Engagement einbringen,
um Kinder und Jugendliche nicht nur zu betreuen, sondern auch zu ertüchtigen.
Ich hoffe, dass es uns gelingt, die Medienkompetenz zu verstärken. Der Bericht stellt fest - damit wurde ein wichtiger Punkt angesprochen -, dass in den letzten Jahren bei den etwas älteren Kindern die Dauer des täglichen Fernsehkonsums um über eine Stunde zugenommen hat. Damit sind die Medien zunehmend zu einem weiteren Erziehungsberechtigten geworden - mit allen Problemen, die damit verbunden sind. Ich danke insbesondere dem Ministerium und der Ministerin, dass im Bericht der Bundesregierung auf alle diese Themen eingegangen worden ist und entsprechende Konzepte vorgestellt worden sind.
Manche in unserem Land empfinden Kinder als Belastung. Ein Thermalbadbetreiber in Bad Wörishofen lässt Kinder nur noch an bestimmten Tagen und zu bestimmten Uhrzeiten in sein Bad. Die Begründung: Die anderen, hauptsächlich älteren Badegäste fühlten sich durch den Kinderlärm belästigt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen keine kinderfreien Zonen in unserem Land.
Wir wollen, dass sich die Kinder willkommen und Eltern mit Kindern wohl fühlen, und zwar überall in unserem Land und zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Jürgen Kucharczyk für die SPD-Fraktion.
Jürgen Kucharczyk (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht stellt klar: In unserem Land besteht ein deutlicher Nachholbedarf bei Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangeboten. Zu lange und zu einseitig waren die Familie vorrangig für die Betreuung und Erziehung der Kinder und die Schule für die Bildung verantwortlich. Vor allem durch das Alleinernährermodell ließ sich die Halbtagsschule als Regelschule einigermaßen problemlos realisieren. Nur so konnten auch die frühkindliche Betreuung und Versorgung der Kinder privat möglich werden.
Heute stellen wir fest: Das Alleinernährermodell ist im Laufe der Jahrzehnte brüchig geworden und nicht mehr tragfähig. Unverkennbar haben sich die Rahmenbedingungen für diesen deutschen Weg folgenreich verändert. So ist die Zahl der Familien - das heißt: Eltern mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren - seit 1970 um rund ein Drittel zurückgegangen. Im selben Zeitraum ist aber die Zahl derjenigen, die Eltern sein könnten, um mehr als 10 Prozent gestiegen. Haushalte ohne Kinder ziehen schrittweise mit Mehrgenerationenhaushalten gleich. Das heißt im Klartext: Keine andere Lebensform hatte in den letzten Jahrzehnten einen so starken Bedeutungsverlust zu verzeichnen wie die Familie bzw. die Eltern-Kind-Gemeinschaften.
Vor diesem Hintergrund gilt es Folgendes zu hinterfragen: Warum kann das unserer Gesellschaft zum Verhängnis werden? Ist es richtig, dass der Kindermangel eine Gesellschaft von Egoisten schafft, wie der neue Titel des „Spiegel“ aussagt? Fakt ist - das wissen wir, auch ohne das neue, aber sicherlich sehr lesenswerte Buch von Schirrmacher zu kennen -, dass die Vermittlung von Werten ganz ohne Familie nicht funktionieren kann. Fakt ist auch, dass unsere Gesellschaft nicht dabei zuschauen darf, wie der Egoismus über den Gemeinsinn, die Solidarität siegt. Aus diesem Grund ist es logisch, dass wir handeln müssen. Wir kommen nicht umhin, eine Infrastruktur für Familien zu schaffen, zum Beispiel durch Angebote zur Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz. Weiterhin ist es unerlässlich, eine bedarfsgerechte und gebührenfreie Kinderbetreuung sicherzustellen. Bildungsprozesse müssen unter dem Motto „Bildung ist mehr als Schule, Schule ist mehr als Bildung“ gestaltet werden. Im Zwölften Kinder- und Jugendbericht wird die Situation erkannt und analysiert und werden die notwendigen Handlungsschwerpunkte benannt. Es wird darauf gedrungen, dass dieses Jahrzehnt zum Jahrzehnt der Kinder und ihrer Familien werden muss.
Daher ist der Ansatz der jetzigen Koalition richtig, die Rahmenbedingungen für unsere Kinder und Enkelkinder in den Bereichen Betreuung, Erziehung und Bildung zu verbessern und die Angebote auszubauen.
Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht macht uns aber auch deutlich, wo die Defizite in unserer Gesellschaft liegen. Nicht nur die PISA-Studie verteilt schlechte Noten an das deutsche Schulsystem. Vielmehr hat kürzlich auch der UN-Sonderbeauftragte für das Recht auf Bildung die fehlende Chancengleichheit und das verschenkte Bildungspotenzial deutlich kritisiert. Die Kommission führt in ihrem Bericht ein erweitertes Bildungsverständnis unter Einbeziehung vieler Bildungsorte und Lernwelten an. Ich sage: Richtig, die Schule muss zu einem Ort vielfältiger Anregungen werden.
Die Schule in Deutschland muss sich ändern. Nur durch die Verknüpfung unterschiedlicher Bildungsorte und Lernwelten kann uns die Erfüllung der Zielvorgabe einer umfassenden Förderung gelingen. Angefangen von der Familie über außerschulische Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, Initiativen der Wirtschaft bis hin zu Schulen müssen dabei alle beteiligten Akteure ihre vorhandenen Ressourcen zur Verfügung stellen.
Auch in dem vorliegenden Bericht finden wir gute Praxisbeispiele, die zeigen, wie es gehen kann. So werden in Rostock den Schülern nachmittags Kurse für Keramik, Jazzdance oder kreatives Schreiben angeboten. Ich bin mir sicher, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass sich in Ihren Wahlkreisen bereits die eine oder andere Form der verknüpften Bildungsförderung bewährt. Häufig nimmt hierbei der Sportbereich eine Vorreiterrolle ein. Und das ist auch gut so. Unsere Aufgabe ist, die Fördernetzwerke auszubauen und institutionell abzusichern. Wir müssen das Sozialisations- und Hilfenetz so knüpfen und flechten, dass keine Kinder und Jugendlichen durchfallen.
Das Ziel, unseren Kindern und Jugendlichen Chancengleichheit, die bestmögliche Bildung und damit Zukunft zu geben, muss dabei der Motor unserer täglichen politischen Arbeit sein. Eines müssen wir alle dabei begreifen: Betreuung, Erziehung und Bildung müssen sich an den Entwicklungsbedürfnissen der Kinder und dürfen sich nicht an den Grenzen der Institutionen orientieren. Auch wir müssen festgefahrene Denkmuster über Bord werfen und uns auf das Wagnis des Neuen einlassen. Nur so können starre Strukturen überwunden, überkommene Traditionen aufgehoben und nicht mehr zeitgemäße Konzepte und Organisationsformen verabschiedet werden. Für mich wird eines durch den vorliegenden Bericht ganz deutlich: Das Handeln nach dem Gießkannenprinzip oder der Einsatz von manchen Feuerwehrtöpfen war und ist der falsche Weg. Ineffektive und kurzfristige Maßnahmen bringen uns nicht weiter.
Eine nachhaltige Kinder- und Jugendpolitik zu betreiben, gelingt uns nur dann, wenn wir diese als gesamtgesellschaftliche Querschnittspolitik erkennen, die für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen wichtig ist. Lassen Sie mich an dieser Stelle einige Parameter benennen. Geschlechterpolitisch muss die einseitige Bindung der Frauen an Haushalt und Kindererziehung überwunden werden. Familienpolitisch muss die Balance von Beruf und Familie noch weiter verbessert werden. Arbeitsmarktpolitisch muss jedem Jugendlichen der Zugang zu Ausbildung und Beruf ermöglicht werden.
Sozialpolitisch muss der inakzeptable Teufelskreis aus Einkommensarmut, Kinderarmut und Bildungsarmut durchbrochen werden. Bildungspolitisch müssen die bislang ungenutzten Lern- und Bildungspotenziale vor und neben der herkömmlichen Halbtagsschule verstärkt einbezogen und besser ausgeschöpft werden. Kinder- und jugendpolitisch müssen Kinder und Jugendliche ein bedarfs- und sachgerechtes Angebot an Lern-, Bildungs- und Entfaltungsmöglichkeiten erhalten, das sie auf ihre berufliche und private Zukunft angemessen vorbereitet.
Umso erstaunlicher und ärgerlicher ist, wie das Land Nordrhein-Westfalen zurzeit diese Querschnittsaufgabe versteht, nämlich als Einschnittspolitik.
Einen schwarz-gelben Kahlschlag in der Kinder- und Jugendpolitik, der Eltern verunsichert, Kommunen in Zwangslagen und Jugendverbände auf die Barrikaden bringt, nenne ich unsozial und nicht zukunftsgerecht.
Die Landesregierung in Düsseldorf ist nicht auf der Höhe der Zeit. Familienminister Laschet sollte lieber den Zwölften Kinder- und Jugendbericht aufmerksam lesen. Dann wird auch er erkennen, dass seine Vorschläge keine langfristige Perspektive für unser Land sein können.
Wir müssen in den nächsten Jahren die notwendigen Entwicklungen konsequent vorantreiben.
Gut ist, dass wir dabei auf die erfolgreiche Kinder- und Jugendpolitik der Vorgängerregierung bauen können. Sie hat mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz den Grundstein für eine gute und bedarfsgerechte Kinderbetreuung für die unter Dreijährigen gelegt. Das Ganztagsschulprogramm sorgt für gleiche Zukunftschancen für jedes Kind. Unter dem Dach der „Allianz für Familie“ hat die alte Bundesregierung Initiativen gebündelt, damit eine gute Balance von Familie und Beruf gelingen kann. Es gibt noch etliche Punkte, die ich hier nennen könnte.
Die neue Bundesregierung setzt den erfolgreich eingeschlagenen Weg fort. Die Anträge des Bündnisses 90/Die Grünen und der Linkspartei bestätigen dies. Der Ausbau einer quantitativ und qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung wird vorangebracht. Von der Regelung zur steuerlichen Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten profitieren vor allem
Alleinerziehende und Geringverdiener. Wir werden unser langfristiges Ziel, die Gebührenfreiheit von Kinderbetreuungsplätzen, intensiv weiter verfolgen. Dies können wir jedoch nur im Zusammenspiel mit Ländern und Kommunen erreichen. Bringen wir gemeinsam die notwendigen Maßnahmen und Prozesse auf den Weg! Lassen wir uns dabei von dem Nationalen Aktionsplan „Für ein kindergerechtes Deutschland“ und von den Empfehlungen des Zwölften Kinder- und Jugendberichts leiten!
Vielen Dank.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 15/6014 und 16/817 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Der Entschließungsantrag auf der Drucksache 16/827 soll an dieselben Ausschüsse wie die Vorlage auf der Drucksache 15/6014 überwiesen werden. - Damit sind Sie einverstanden. Dann ist die Überweisung so beschlossen.
Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 sowie die Zusatzpunkte 2 und 3 auf:
4. Beratung des Antrags der Abgeordneten Irmingard Schewe-Gerigk, Renate Künast, Matthias Berninger, weiterer Abgeordneter und der Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN
Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt verwirklichen - Innovationshemmnis Männerdominanz beenden
- Drucksache 16/712 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f)
Innenausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung
ZP 2 Beratung des Antrags der Abgeordneten Ina Lenke, Sibylle Laurischk, Miriam Gruß, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
Frauenpolitik - Gesellschaftlicher Erfolgsfaktor
- Drucksache 16/832 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f)
Innenausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung
ZP 3 Beratung des Antrags der Abgeordneten Karin Binder, Dr. Lothar Bisky, Diana Golze, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der LINKEN
Gleichstellungsgebot des Grundgesetzes auf dem Arbeitsmarkt durchsetzen
- Drucksache 16/833 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f)
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Interfraktionell wurde verabredet, darüber eineinhalb Stunden zu debattieren. - Dazu höre ich keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.
Ich eröffne die Aussprache und gebe das Wort der Kollegin Irmingard Schewe-Gerigk, Bündnis 90/Die Grünen.
Irmingard Schewe-Gerigk (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Internationale Frauentag ist nach wie vor hochaktuell. So feierte ihn gestern sogar die größte Boulevardzeitung mit einer blanke-Busen-freien Ausgabe und ohne Telefonsexanzeigen. Selbst „Bild“ wollte gestern eine Frau sein.
Aber weg vom Boulevard. Der 8. März bietet in der Tat einen guten Anlass, um über den Stand der Gleichberechtigung zu sprechen. Da gibt es viel Licht, aber auch viel Schatten. Auf der einen Seite haben junge Frauen in allen Altersstufen und Schulformen bessere Abschlüsse als Männer, mehr junge Frauen als Männer legen das Abitur ab, Frauen bilden die Mehrheit der Studierenden; aber auf der anderen Seite spiegeln sich diese hervorragenden Qualifikationen der Frauen im Arbeitsleben nicht wider. Nehmen wir zum Beispiel die Bezahlung. Hier spielt das weibliche Geschlecht immer noch eine entscheidende, nämlich negative Rolle. Frauen verdienen in Deutschland durchschnittlich 23 Prozent weniger als Männer.
Größer ist der Lohnunterschied EU-weit nur noch in Estland und in der Slowakei, Frau Kollegin Lenke.
Dass im 21. Jahrhundert ein Rechtsberater fast 1 000 Euro mehr verdient als eine Rechtsberaterin, ist ein Armutszeugnis für unsere Demokratie.
Was die Anzahl von Frauen in Führungspositionen betrifft, gehört Deutschland ebenfalls zu den Schlusslichtern im Vergleich mit anderen Industrienationen. Führungspositionen in großen deutschen Unternehmen sind gerade einmal zu 4 Prozent mit Frauen besetzt. Das ist einfach zu wenig für eine moderne Wirtschaftsnation.
Das, was mich wütend macht - leider ist Frau von der Leyen nicht da -, ist, dass Frau von der Leyen hier immer nur ein Vereinbarkeitsproblem sieht. Sie wünscht sich - ich zitiere aus ihrer Pressemitteilung - „dass künftig deutlich mehr Frauen mit Kindern der Sprung ins Topmanagement gelingt“. Wohl wahr, allerdings scheint mir diese Ansicht doch das eigentliche Problem auszublenden; denn in den 30 DAX-Unternehmen finden wir nahezu keine Frau unter den 200 Vorstandsmitgliedern, weder mit Kindern noch ohne Kinder. Eine oder auch einmal zwei Frauen werden als großer Erfolg gefeiert. So werden 70 Prozent aller Betriebe ausschließlich von Männern geführt. Frauen gelangen in Deutschland gerade einmal in die Vorzimmer der Macht. Die Männerdominanz in den Spitzenpositionen ist nicht nur ein Gerechtigkeitsproblem, sondern sie stellt auch - ich schaue zur FDP - den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes infrage.
Wieso kann sich eigentlich nur die deutsche Wirtschaft leisten, auf die Potenziale und Fähigkeiten von Frauen, vor allem was Entscheidungspositionen angeht, zu verzichten? Warum werden Frauen erst hoch qualifiziert, ohne dass sie danach adäquate Arbeitsplätze finden? In anderen Ländern weiß man, dass eine große Anzahl erwerbstätiger Frauen auch zu vielen neuen Jobs, zum Beispiel im Dienstleistungsbereich, führt. Das sollte eigentlich den Wirtschaftsminister und die Frauenministerin auf den Plan rufen. Vom Wirtschaftsminister haben wir nichts gehört. Die Frauenministerin ist ganz gelassen. Sie sagt: Frauen rücken doch auf; jede Vierte ist schon in einer Führungsposition. Sie verschweigt allerdings, dass sie sich auf eine Studie bezieht, in der auch Kleinstbetriebe untersucht wurden. Nach dieser Studie gilt die Filialleiterin einer chemischen Reinigung mit einer Angestellten als Führungskraft. So kann Frau sich die Welt wirklich schönreden.
Ministerin von der Leyen, die sich für Frauen nur dann zuständig fühlt, sofern sie Mütter sind, sagt aber auch: Eine Kanzlerin reicht; wir brauchen keine Gleichstellungsgesetze. Sie hält sie sogar für kontraproduktiv. Dabei sollte ihr das Beispiel Norwegen zu denken geben. 2003 hat Norwegen versucht, mit einer freiwilligen Vereinbarung mehr Frauen in Aufsichtsräte von Aktiengesellschaften zu bringen. Das war ein Flop - ebenso wie die freiwillige Vereinbarung in Deutschland mit den Spitzenverbänden und der Bundesregierung. Nun gibt es seit Januar in Norwegen ein Gesetz, das vorsieht, dass der Frauenanteil bis Ende 2007 bei 40 Prozent liegen muss; anderenfalls droht die Auflösung der Aufsichtsräte. So viel Mut würde ich uns auch einmal wünschen.
- Sehr gut, jetzt klatscht sogar die SPD. Das ist toll.
Dabei ist eines interessant: Dieses Gesetz wurde nicht von einer Feministin eingebracht, sondern vom konservativen Wirtschaftsminister Gabrielsen, der kritisierte, dass zu viel Wissenspotenzial und Innovation verloren ginge, wenn Frauen ausgeschlossen werden.
Im Übrigen ist der Minister zutiefst davon überzeugt, dass viele der internationalen Firmenskandale der letzten Jahre nicht passiert wären, wenn in den Aufsichtsräten statt der - jetzt zitiere ich den Minister - „Raffgier der Männer in den 50ern vielfältigere Interessen dominiert hätten“.
- Ja, das kann man eigentlich gar nicht mehr kommentieren. - In der Tat stellt auch in Deutschland die Männerdominanz in den Führungsetagen ein unglaubliches Innovationshemmnis dar.
Ich wage die Behauptung, dass es einen Zusammenhang zwischen der schlechten wirtschaftlichen Entwicklung, der hohen Arbeitslosigkeit und der Männerdominanz in den Spitzengremien der Wirtschaft gibt. Bei der Frage, warum Frauen trotz bester Qualifikation nicht in die Toppositionen kommen, stößt man auf sehr provokative Thesen, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte.
Die erste These ist: Männer haben Angst vor mächtigen Frauen. Salman Rushdie geht sogar so weit, die Angst islamischer Männer vor der weiblichen Sexualität als eine Ursache für den Terrorismus anzusehen.
Zweite These. Männer wollen unter sich bleiben. Gleichberechtigte Frauen sind da eher Fremdkörper oder auch Spielverderberinnen. VW mit seinem reinen Männervorstand ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Was da vor einigen Monaten öffentlich wurde, war sicherlich nur die Spitze des Eisberges.
Nach gelungenen Abschlüssen gönnten sich die Herren sexuelle Dienstleistungen auf Firmenkosten. Klar, da würden Vorstandsfrauen nur stören. Herr Hartz hatte bei seinen Vorschlägen zur Arbeitsmarktreform die Halbierung der Zahl der Arbeitslosen angekündigt. Das ist ihm nicht gelungen. Um den Erhalt der Arbeitsplätze in der Sexindustrie hat er sich aber offensichtlich verdient gemacht.
Die Sammelklage der sechs US-Managerinnen gegen eine zum Allianzkonzern gehörende Bank wegen systematischer Diskriminierung zeigt den richtigen Weg auf: Frauen brauchen Rechte. Darum ist es dringend notwendig, dass das Antidiskriminierungsgesetz schleunigst verabschiedet wird.
Aber das reicht nicht aus. Es gibt nicht die eine Maßnahme oder das eine Gesetz, wodurch die Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt erreicht werden kann. Hier müssen viele Maßnahmen zusammenwirken. Aus dem umfangreichen Forderungskatalog unseres Antrages stelle ich Ihnen einige wesentliche Forderungen vor:
Die Bundesregierung muss aufgrund der Analysen, die sie ja teilt, endlich ein Programm zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt auflegen. Wir brauchen endlich gesetzliche Regelungen zur Umsetzung der Chancengleichheit in der Wirtschaft. Aber daneben wollen wir auch Anreize geben. Die öffentliche Auftragsvergabe soll daran gekoppelt werden, dass Unternehmen Maßnahmen zur Gleichstellung ergreifen. Ein gutes Vorbild für Frauenförderung in der Wirtschaft sind die USA. Auch dort hat nicht der Gleichheitssatz der Verfassung die Frauen vorangebracht. Es waren vielmehr zum einen die zur Ausführung der Verfassung verabschiedeten Anreizsysteme und zum anderen der Mut, auch vor gesetzlichen Regelungen und Sanktionen nicht zurückzuschrecken.
Aber zurück zu Deutschland. Damit Frauen endlich den gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit erhalten, müssen alle Tarifverträge untersucht und neu bewertet werden.
Die Tarifverträge für den öffentlichen Dienst sollten hierbei ein erster Ansatzpunkt sein.
Das Ehegattensplitting hat sich vielfach als Hindernis für Ehefrauen erwiesen, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Da sagt der Ehemann: Das lohnt sich eigentlich gar nicht. Ich bekomme doch 9 000 Euro Steuervergünstigung.
Wir wollen daher eine Individualbesteuerung, damit Frauen auf ihrer Gehaltsabrechnung sehen, was sie wirklich verdienen.
Viele erwerbslose Frauen werden durch die Hartz-IV-Regelungen nach wie vor benachteiligt. Auch dies ist nicht neu. Das haben wir als Grüne schon während unserer Regierungszeit immer wieder mahnend angemerkt. Diese Frauen haben aufgrund der Anrechnung des Partnereinkommens nicht nur keine Einnahmen, sondern auch keinen Anspruch auf Fördermaßnahmen der Arbeitsagentur. An dieser Stelle muss eine Klarstellung im SGB II vorgenommen werden.
Die Bundesregierung muss diese Maßnahmen zügig umsetzen. Es ist wirklich schade, dass die Ministerin nicht hier ist. Ich hätte sie gern selbst angesprochen. Die Ministerin sollte die Frauenfrage nicht auf die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf reduzieren; denn es geht um viel mehr. Es geht um eine grundlegende Veränderung der Geschlechterverhältnisse und damit um die Veränderung eines wesentlichen Grundprinzips unserer Gesellschaft. Die Frauen haben einen langen Veränderungsprozess hinter sich. Nun sind die Männer am Zug. Die gesetzlichen Voraussetzungen - ich nenne nur die Elternzeit - haben wir unter Rot-Grün geschaffen. Inzwischen gibt es auch viele verbal aufgeschlossene Männer, aber den Worten müssen jetzt auch Taten folgen.
Sowohl die Linke als auch die FDP haben Anträge in die Debatte eingebracht. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linksfraktion, ich freue mich darüber, dass unser Antrag Sie so inspiriert hat. Viele Analysen und Forderungen sind wortwörtlich mit denen unseres Antrags identisch.
Was von der FDP kommt, finde ich immer sehr überraschend. Sie stehen wie so oft vor einem Problem. Sie sehen zwar die Diskriminierung der Frauen, meinen aber, dass Leistung allein reicht, um sich durchzusetzen.
- Natürlich, so steht es in Ihrem Antrag! - Ich habe vorhin gesagt - Sie haben es gehört -, wie qualifiziert die Frauen sind. Demnach müssten sie an der Spitze sein. Das ist aber nicht so. Sie scheuen gesetzliche Regelungen wie die Teufelin das Weihwasser. Diesen Widerspruch versuchen Sie zu verdecken, indem Sie sagen, dass die Regelungsdichte am Arbeitsmarkt abgebaut werden müsste. Von Ihnen wird immer wieder behauptet, eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes würde ausreichen.
Ich stelle Ihnen einmal die Frage: Wie soll sich denn eine Frau in einem völlig ungesicherten Arbeitsverhältnis beispielsweise für ein Kind entscheiden?
Sie sehen, Frau Kollegin Lenke: Ideologie hilft hier nicht weiter.
Ich hätte mich gern mit den Vorstellungen der großen Koalition auseinander gesetzt. Aber offensichtlich sehen Sie, verehrte Kollegen und Kolleginnen der CDU/CSU und der SPD, überhaupt keinen Handlungsbedarf.
Ich finde, das sollten die Frauen in diesem Land wissen. Sie sollten wissen, dass von Ihnen keine Vorschläge gemacht werden und dass Ihres Erachtens keine Regelungen notwendig sind, um die desaströse Situation von Frauen, die sehr gut ausgebildet sind, dann aber nicht auf entsprechende Arbeitsplätze kommen, zu verbessern.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich hätte von Ihnen wirklich mehr erwartet. Ich finde schon, dass das ein Armutszeugnis ist. Vielleicht wird die Debatte in den Ausschüssen das Ganze noch etwas mehr aufhellen.
Da sich die Union vollauf damit beschäftigt, unter großen Querelen ihr Familienbild zu entstauben, sehe ich ein, dass von da nichts zu erwarten ist, wobei eine Ministerin, die einen kompletten Teil ihres ja nicht sonderlich großen Ressorts einfach vernachlässigt, im besten Fall als ignorant zu bezeichnen wäre.
Meine Damen und Herren, wir brauchen in diesem Land deutlich mehr Anstrengungen, um Antworten auf die Geschlechterfrage im 21. Jahrhundert zu finden.
Ich danke Ihnen.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Bevor ich der nächsten Rednerin das Wort gebe, erteile ich das Wort zur Geschäftsordnung. Herr Beck, bitte.
Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Bei dieser Debatte über die Frauenpolitik ist merkwürdigerweise die Frauenministerin nicht anwesend. Ich beantrage namens der Fraktion des Bündnisses 90/Die Grünen die Herbeizitierung der Frauenministerin. Ich finde, es zeugt von Respektlosigkeit gegenüber dem Parlament, dass sie draußen Interviews gibt, während hier eine Debatte zu einem wichtigen Bereich ihres Ressorts stattfindet.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Wird zu diesem Antrag das Wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen.
Wer tritt dem Antrag der Fraktion des Bündnisses 90/Die Grünen bei? - Gegenstimmen? - Enthaltungen? -
Wir sind uns hier nicht einig. Deshalb wiederhole ich die Abstimmung.
Wer dem Antrag der Fraktion des Bündnisses 90/Die Grünen beitreten will, den bitte ich um das Handzeichen. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Die Mehrheit stimmt eindeutig für den Antrag. Damit ist die Ministerin herbeizuzitieren.
Die Sitzung ist unterbrochen, bis die Ministerin eintrifft.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Wir setzen die Debatte fort.
Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, sich zu ihren Plätzen zu begeben, und gebe das Wort der Kollegin Dr. Eva Möllring, CDU/CSU-Fraktion.
Dr. Eva Möllring (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die Fraktion des Bündnisses 90/Die Grünen erfreut uns heute mit einer besonders kämpferischen Zeile, die irgendwie nostalgische Erinnerungen an ihre frühen Jahre weckt. Sie heißt: „Innovationshemmnis Männerdominanz beenden.“
Als ich Ihre Fraktion vorhin bei dem Beitrag Ihrer Kollegin gesehen habe, konnte ich feststellen, dass sie gerade einmal zwei Männer bei dieser Debatte aufzuweisen hatte.
Jetzt, Herr Beck, nachdem es um Sieg oder Niederlage bei der Abstimmung ging, sind natürlich - ganz zufällig - mehr Männer Ihrer Fraktion im Saal anwesend.
- Ich provoziere überhaupt nicht, Herr Beck. Ich gehe auf die Fakten ein, die Sie selber geschaffen haben.
Ob Sie aber Ihre Innovationskraft nun gerade dadurch beweisen, indem Sie heute gesetzliche Gleichstellungsregelungen für die Privatwirtschaft fordern, wage ich zu bezweifeln. Denn Ihre Forderung stammt aus dem Koalitionsvertrag von 1998.
Diese haben Sie heute aufgewärmt. Im Laufe der sieben Folgejahre haben Sie dann 2001 diese Forderung in eine freiwillige Vereinbarung umgewandelt.
Seitdem ruht still der See.
Kämpferisch Extremforderungen zu stellen ist einfacher in der Opposition. Aber dieses Problem ist zu ernst, als dass man es durch martialische Forderungen noch ins Lächerliche ziehen sollte.
Verschiedene Studien belegen auch für das Jahr 2005, dass Frauen im Erwerbsleben ein deutlich geringeres Einkommen und weniger Chancen haben als Männer. Es muss uns alle aufschrecken, wenn Frauen, die Vollzeit arbeiten, in Westdeutschland durchschnittlich 23 Prozent - dies ist der Spitzenwert - weniger verdienen als Männer. Als Gesetzgeber sind wir allein schon aufgrund der Maßgabe unseres Grundgesetzes, aber auch aus innerem Gerechtigkeitsempfinden aufgerufen, die Ursachen für diesen Befund festzustellen und gegenzusteuern.
Die Problematik hat ja Geschichte. Man muss der Ehrlichkeit halber darauf hinweisen, dass in den letzten Jahren viele Maßnahmen und Initiativen gestartet wurden, um hier voranzukommen. Das hat dazu geführt, dass sich der Abstand zwischen dem Einkommen von Frauen und demjenigen von Männern um einige Prozentpunkte verringert hat, aber eben nicht in dem Maße, dass wir uns zufrieden zurücklehnen könnten.
Manch einer sagt vielleicht auch heute noch - oder er denkt es -: Muss das denn überhaupt sein? Meine Frau ist ganz zufrieden, ohne groß Geld zu verdienen, und das können doch auch andere sein.
Was es bedeutet, auf Unterhalt angewiesen zu sein, keine vernünftige eigene Rente zu erwarten und in der Arbeitswelt an untergeordneter Stelle hängen zu bleiben, kann man wohl nur beurteilen, wenn man es persönlich erlebt. Wenige protestieren laut; aber viele Frauen erleben es. Deswegen setzen wir als CDU/CSU uns dafür ein, hier im Sinne der Frauen Fortschritte zu machen. Wir haben das im Koalitionsvertrag in mehreren Kapiteln festgelegt.
Dazu gehört: Wir brauchen heute - und morgen noch viel mehr - gut ausgebildete Frauen auf dem Arbeitsmarkt als Fachkräfte. Nur die Nutzung von männlicher und weiblicher Qualifikation wird uns optimal nach vorne bringen. Deshalb werden wir uns dafür einsetzen, dass Frauen die gleichen Chancen und Rechte auf dem Arbeitsmarkt erhalten wie Männer.
Die Frage ist nun: Was sind die Ursachen für diese eklatanten Einkommensunterschiede und wie kann man dem am besten entgegenwirken? Neben vielen einzelnen Gründen springen besonders zwei ins Auge:
Erstens, die Konzentration der jungen Frauen auf Berufe, die geringes Ansehen haben und in denen eine schlechtere Bezahlung erfolgt als in anderen, oder, anders gesagt, die schlechte Bezahlung in Berufen, die vor allem von Frauen gewählt werden. Da brauchen wir den gezielten Einsatz der Tarifparteien. Der Girls? Day war ein Anfang und ist wohl die bekannteste von zahlreichen Maßnahmen, um Frauen für lukrativere Berufe in anderen Feldern zu öffnen. Dieses Ziel müssen wir konsequent weiterverfolgen, während wir gleichzeitig Jungen für all das fit machen sollten, was nicht so in ihrem Blickfeld liegt. Da sind sich wohl alle Parteien einig.
Zweitens. Der entscheidende Grund für das geringere Einkommen der Frauen ist zweifellos die Familienarbeit. Andersherum gesagt: Männer verdienen mehr als Frauen, weil sie eben meist keine Familienarbeit leisten. Dabei ist noch gar nicht berücksichtigt, dass Frauen oft aus dem Beruf aussteigen, sondern nur, dass sie sich nicht in gleicher Weise beruflich fortentwickeln können wie ihre männlichen Kollegen. Bis zum 30. Lebensjahr sind Frauen nämlich zu 43 Prozent an Führungspositionen beteiligt. Danach bricht der Anteil auf 30 Prozent ein und sinkt kontinuierlich auf 20 Prozent ab. Bei zwei Dritteln der Frauen in Führungspositionen leben keine Kinder unter 18 Jahren im Haushalt. Nur 9 Prozent dieser Frauen haben überhaupt mehrere Kinder.
Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt: Dieses Problem werden wir nur überwinden, wenn wir unsere Denkschemata völlig ausplündern und umstellen. Das ist kein Spruch; denn das ist das Schwierigste an der ganzen Sache. Das Wichtigste ist, erst einmal zu erkennen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf uns alle angeht und der Konflikt von uns allen zu lösen ist und nicht speziell allein von der Frau, die gerade betroffen ist.
Dazu muss erst einmal zugelassen sein, dass man am Arbeitsplatz das Thema Familie überhaupt offen ansprechen kann. Bislang ist das ja ein Tabu. Zugelassen sind Fotos auf dem Schreibtisch und die Erwähnung guter Schulabschlüsse der Kinder. Aber die Änderung der Arbeitszeit, um zu Hause Kindergeburtstag zu feiern, gilt als albern und unprofessionell.
Das liegt auch nicht zuletzt daran, dass Väter diesen Teil des Lebens oft von sich weisen. Die Empörung darüber, dass Väter gegen gutes Entgelt ganze zwei Monate ihres Lebens ihr Kind erziehen könnten, zeigt deutlich, dass Familienarbeit ein erschreckend geringes Ansehen hat.
Deshalb müssen wir jetzt diejenigen Väter stärken und unterstützen, die bereit sind, sich partnerschaftlich und familienbewusst zu entwickeln. Wir werden ohne aktive Väter nicht weiterkommen. Davon bin ich überzeugt.
Wir machen also mit dem Elterngeld einen mutigen, doppelten Schritt nach vorn, indem wir Anreize für Frauen und gleichzeitig für Männer schaffen, sich für Kinder und Beruf zu entscheiden. Die Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Deutschland müssen erweitert werden. Es gibt jetzt hoffnungsvolle Modelle flexibler Betreuung, die wir auf allen politischen Ebenen positiv begleiten und stärken müssen.
Das ist einfacher gesagt als getan. Ich war lange Jahre in der Kommunalpolitik und weiß, was das in Bezug auf die Räte und Kreistage bedeutet.
Als Nächstes werden wir ein anteiliges Steuersystem einführen, das wir im Koalitionsvertrag vorgesehen haben. Damit soll erreicht werden, dass auch verheiratete Frauen Berufstätigkeit nicht als unattraktiv empfinden.
Übrigens, Frau Schewe-Gerigk, die Elternzeit ist nicht von Rot-Grün, sondern unter einer CDU-geführten Regierung eingeführt worden. Das möchte ich nur in Erinnerung rufen.
Fort- und Weiterbildung ist nach meiner Überzeugung ein ganz wichtiger Schlüssel. Deswegen möchte ich den unter Nr. 7 des Antrages der Grünen formulierten Vorschlag gern aufgreifen, dem ich durchaus zustimmen kann. Er ist aber etwas zu kurz gegriffen. Der Förderanspruch muss vielmehr für alle Frauen gelten, die keinen Arbeitsplatz haben und gleichwohl keine Leistungen der BA beziehen. Darauf könnten wir uns einigen.
Vor allem ist es notwendig, immer wieder auf Betriebe und Unternehmen zuzugehen, damit sie alle Möglichkeiten schaffen, mit denen sie die besonderen Qualitäten von Frauen erkennen und fördern und gleichzeitig Familienarbeit anerkennen können. Viele Betriebe haben ja schon hervorragende Initiativen gestartet, die ich hier gar nicht aufzählen kann. Diese müssen wir weiter tragen. Ich glaube, es ist ein guter und erfolgreicher Weg, wenn Frauen in Betrieben, zum Beispiel durch Coaching, persönlich gefördert werden und wenn der Betrieb davon überzeugt ist, dass das eine gute Sache ist. Daneben erwarte ich von der Offensive „Familienfreundliche Arbeitswelt“, die wir beschlossen haben, zusätzliche Impulse. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass ein Unternehmen anbieten könnte, bei Verzicht auf einen Dienstwagen eine Haushaltshilfe zu engagieren. So viel zu den Denkschemata.
Statt Verpflichtungen und Sanktionen, die die Frauen womöglich noch Arbeitsplätze kosten, brauchen wir Einsichten und zahlreiche unterschiedliche Strategien, um voranzukommen. Die Frauen laufen nicht mit Transparenten und Flüstertüten durch die Straßen. Sie entscheiden sich leise: Jede Dritte arbeitet in einem Betrieb, der Frauen ausdrücklich fördert - oder die Frauen verzichten eben auf Kinder.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Das Wort hat die Kollegin Ina Lenke, FDP-Fraktion.
Ina Lenke (FDP):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe Kollegen und Kolleginnen! „Weiblich, qualifiziert, benachteiligt“ - so lautete der Titel einer überregionalen Tageszeitung, der die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt treffend beschreibt. Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz verpflichtet den Staat, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung zu fördern und aktiv auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. Die hohe Arbeitslosigkeit - über 5 Millionen Menschen sind arbeitslos - hat die strukturell schlechte Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt verstärkt. Mit den rot-grünen Hartz-Gesetzen ist das klassische Modell des männlichen Familienernährers und einer von ihm finanziell abhängigen Ehefrau oder Partnerin verfestigt worden, und zwar mit tatkräftiger Unterstützung der Grünen.
Besonders Frauen aus den neuen Bundesländern empfinden das als starke Diskriminierung. Immer wenn ich in die neuen Bundesländer komme, gibt man mir es als Auftrag mit auf den Weg, dies im Bundestag anzusprechen.
Nun haben die Grünen heute einen Antrag mit dem Titel „Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt verwirklichen“ eingebracht, und das nach sieben Jahren Regierungstätigkeit. Sie hatten doch Gelegenheit, in der rot-grünen Koalition Politik zugunsten von Frauen zu gestalten.
Stattdessen ist in Ihrer Regierungszeit die Arbeitslosigkeit gestiegen, auch die Arbeitslosigkeit von Frauen.
- Diese Zahlen können Sie doch nicht in Abrede stellen.
Wenn Sie jetzt in Ihrem Antrag wieder die Keule eines Gleichstellungsgesetzes für die Wirtschaft herausholen,
wenn Sie wieder Ihre Idee der Bevorzugung von Unternehmen bei öffentlichen Aufträgen als Forderung an die Regierung richten, dann sage ich Ihnen: Mit diesen alten Rezepten, Herr Beck, wird der Arbeitsmarkt nicht gesunden.
Dieser Meinung sind wir. Wir haben andere Rezepte.
Auf demselben Holzweg ist die große Koalition. Sie wird die Mehrwertsteuer erhöhen und die Konjunktur abwürgen. Auch die Konzepte der CDU/CSU, die das konservative Familienbild
des allein verdienenden Ehemannes pflegt, tragen nicht dazu bei, Frauen zu ermutigen, ihre berufliche Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt anzubieten.
Herr Dr. Kues, Sie mögen vielleicht ein anderes Familienbild haben, aber einer Pressemitteilung der Jungen Gruppe der CDU/CSU-Fraktion konnte ich entnehmen, dass man dort dafür ist, das traditionelle Familienbild weiter zu pflegen. Deshalb führe ich das hier aus. Wenn Sie eine Einzelmeinung in der CDU/CSU vertreten, dann sollten Sie als Staatssekretär dafür sorgen, dass es in Ihrer Fraktion besser wird.
Wir alle wissen, dass Frauen durch Familienpflichten im Wettbewerb um einen Arbeitsplatz besonders benachteiligt sind. Allein der Verdacht, die Bewerberin könnte Mutter werden, reicht aus, um einen Job nicht zu bekommen. Diese Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt - darüber sind wir uns Gott sei Dank über alle Fraktionsgrenzen hinweg einig - kann nur durch verlässliche Angebote für eine bedarfsgerechte hochwertige Kinderbetreuung beseitigt werden.
Ich komme noch einmal auf Sachsen-Anhalt zurück, das wir letzte Woche besucht haben. In Sachsen-Anhalt hat die Regierung, an der die FDP beteiligt ist, etwas ganz Besonderes geleistet. Dort gibt es einen Rechtsanspruch für berufstätige Alleinerziehende und berufstätige Eltern auf Kinderbetreuung vor der Einschulung von bis zu zehn Stunden täglich. Das finde ich sehr vorbildlich.
- Ihren Einwurf kann ich aus Zeitgründen nicht weiter beachten. Stellen Sie eine Frage, dann können wir uns darüber unterhalten.
Auch die Arbeitgeber sind nicht ganz unschuldig. Viele Arbeitgeber haben bei Bewerbungen von Männern und Frauen nicht die Qualifikation als Erstes im Auge, sondern treffen die Auswahl nach Geschlecht.
Das ist nicht in Ordnung. Noch heute werden junge Väter, wenn sie Elternzeit in Anspruch nehmen, nicht ernst genommen. Eine Kollegin von der CDU hat gerade den Paradigmenwechsel bei den Vätern angesprochen. Dieser Paradigmenwechsel hat bei den jungen Vätern bereits stattgefunden. Ihn müssen wir politisch unterstützen.
Deshalb erwartet die FDP von Ihnen als Bundesministerin, Frau von der Leyen, ein umfassendes und nachhaltiges Konzept zur Unterstützung berufstätiger Mütter und Väter. Unsere Forderung an Sie ist - wie schon seinerzeit an die Familienministerin der rot-grünen Koalition -: Wir wollen keine leeren Schlagworte! Das Elterngeld, das Sie versprechen und über das Sie landauf, landab diskutieren, ist bisher nur eine leere Hülle.
Auf Nachfrage der FDP musste die Bundesregierung - Sie können gern die Antwort der Bundesregierung nachlesen - kleinlaut einräumen, dass sie beim Elterngeld bisher kein Konzept, sondern nur Eckpunkte hat.
Auch jetzt noch fehlt es in den Firmen und im öffentlichen Dienst an Einsicht, dass zum Beispiel Gender Mainstreaming Teil einer modernen Personalpolitik und Innovations- und Erfolgsfaktor einer Organisation ist. Dass die traditionelle Frauenförderung vom Gender Mainstreaming abgelöst wurde, ist in der Wirtschaft wie in der Politik bei den Führungsebenen noch nicht angekommen.
Die Wirtschaft handelt meines Erachtens sehr kurzsichtig, wenn sie Frauen vor der Tür stehen lässt.
Die Bertelsmann-Stiftung hat diese Woche eine Studie veröffentlicht, die deutlich aufzeigt, dass deutsche Unternehmen das Leistungs- und Kreativpotenzial von Frauen noch nicht erkannt haben. Durch die demographische Entwicklung unserer Gesellschaft - das wissen wir - werden die Unternehmen die Nase vorn haben, die jetzt Männer und Frauen einstellen.
Wir Liberale bringen heute einen Antrag ein, in dem die Bundesregierung unter anderem aufgefordert wird, Fehlanreize im Steuer- und Transfersystem, wie zum Beispiel die Steuerklasse V, zu beseitigen, Schwächen in der Arbeitsvermittlung und in der Arbeitsmarktpolitik zu beheben, die hohe Regulierungsdichte am Arbeitsmarkt abzubauen und die Existenzgründungsförderung für Frauen konsequent fortzusetzen und im Rahmen bestehender Programme zielgruppengerecht auszugestalten. Wer Existenzgründerinnen besucht, der hört stets die Klage, dass Sparkassen und Banken keine Kredite geben wollen. Dabei wird gerade dort das Hohelied auf Existenzgründungsförderung für Frauen gesungen. Insofern gibt es also eine große Diskrepanz.
Wir wollen, dass die Bundesregierung zusammen mit den Ländern in den Schulen und im Berufsbildungssystem unternehmerisches Denken bei Mädchen und Frauen stärker fördert. Die Berufswahl von jungen Frauen soll in den Fokus gestellt werden. Wir brauchen mehr Frauen in männerdominierten Tätigkeiten. Denn diese sind besser vergütet. Über 55 Prozent aller erwerbstätigen Frauen arbeiten in nur 20 Berufen. Das sollte uns zu denken geben. Deshalb sollten wir im Bundestag auch die Eigenverantwortung und Eigeninitiative von Frauen ansprechen. Ich finde, dass das sehr wichtig ist. Wir sollten Frauen nicht immer nur beschützen, sondern wir sollten sie auffordern, in ihrem eigenen Bereich Stellung zu beziehen.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss.
Ina Lenke (FDP):
Ich komme zum Schluss.
In einer liberalen Bürgergesellschaft brauchen wir Menschen, die bereit zu Veränderungen sind. Frauenpolitik muss vorangetrieben werden im Bewusstsein, dass Frauen mehrheitlich besser qualifiziert sind und dass sie neue Perspektiven, Wissen und Erfahrungen in die Gesellschaft einbringen. „Weiblich, qualifiziert, benachteiligt“ darf es nicht länger geben. Chancengleichheit muss endlich selbstverständlich werden. Aber nicht nur das. „Weiblich, qualifiziert, benachteiligt“ kann sich unsere Gesellschaft nicht mehr leisten.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Das Wort hat die Kollegin Christel Humme, SPD-Fraktion.
Christel Humme (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kollegen! Liebe Kolleginnen! Frau Lenke, Sie haben gerade in Ihrer Rede die Wirtschaft heftig dafür kritisiert, wie sie auf Frauen reagiert.
Aber ich entdecke in Ihrem Antrag leider keine einzige Lösung für dieses Problem. An dieser Stelle wird der Freiheitsbegriff für mich leider auch ein Begriff der Beliebigkeit.
Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, „Tun Sie mehr dafür, dass Frauen ihren Wunsch nach einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf verwirklichen können!“. Das war ein Appell beim 150-jährigen Jubiläum der IHK in meinem Wahlreis am letzten Freitag. Dieser Appell kam nicht etwa von Renate Schmidt oder Alice Schwarzer, sondern von Ludwig Georg Braun, dem Vorsitzenden des Industrie- und Handelskammertages selbst. Er wandte sich dabei an ein Auditorium, das zu 95 Prozent aus Männern bestand. Das war völlig neu. Denn das Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ stand vor sechs Jahren nicht zur Debatte, als Herr Braun an gleicher Stelle über Innovation und Zukunft sprach. Ist das schon gleichstellungspolitischer Fortschritt? Ist das unser frauenpolitischer Erfolg?
Eines ist sicher: Die SPD und allen voran die Ministerinnen Christine Bergmann und Renate Schmidt haben das Thema Gleichstellungspolitik immer wieder bei den Wirtschaftsverbänden und Unternehmen in den Vordergrund gestellt.
- Ja, das darf man ruhig einmal wohlwollend zur Kenntnis nehmen. - Mit beiden Frauen und der SPD-geführten Regierung verbinden wir heute wesentliche gleichstellungspolitische Fortschritte.
Ich nenne nur das Gender-Mainstreaming-Prinzip als durchgängiges Prinzip, das Gleichstellungsgesetz für den öffentlichen Dienst, das Gleichstellungsgesetz für die Soldatinnen, die Reform der Elternzeit und - das ist ganz wichtig - den Ausbau der Infrastruktur, das heißt, mehr Ganztagsschulen und mehr Betreuung für unter Dreijährige. Das alles sind wichtige Schritte hin zum Ziel der Gleichstellung der Geschlechter.
Nach fast 100 Jahren Internationalem Frauentag und nach fast 60 Jahren Grundgesetz und Art. 3 würde ich mir jetzt allerdings noch schnellere Fortschritte wünschen. Denn es gilt immer noch - das haben wir in den Reden gerade gehört -: Gerade auf dem Arbeitsmarkt werden traditionelle Rollenbilder verfestigt. Anders lässt sich nicht erklären, warum Frauen, die noch nie so gut ausgebildet waren wie heute, keine entsprechenden Karrierechancen haben, warum Frauen selbst dann ein geringeres Gehalt erhalten, wenn sie im gleichen Büro arbeiten wie ihre männlichen Kollegen und die gleiche Tätigkeit ausüben, warum Frauen nach einer Familienphase oder Kündigung länger arbeitslos sind als Männer, warum Frauen mehrheitlich in geringfügiger Beschäftigung zu finden sind und die Frauenerwerbsquote weit unter der Männererwerbsquote liegt.
Diese Analyse wird von ganz vielen unterschiedlichen Untersuchungen mit Daten belegt. Darum ist es vielleicht auch zu erklären - das sage ich der Ministerin Frau von der Leyen -, dass die „Zweite Bilanz der Vereinbarung der Bundesregierung mit den Spitzenverbänden der Deutschen Wirtschaft zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft“ - so lautet der lange Titel - ohne großen Paukenschlag in der Presse veröffentlicht wurde. Die Bilanz bestätigt, die so genannte freiwillige Vereinbarung war nicht wirkungsvoll.
- Das darf man ruhig feststellen. Die Frauen werden es feststellen.
2004 waren in den 100 größten Unternehmen neben 685 Männern nur vier Frauen in Vorstandspositionen. Eine Steigerung der Anzahl von Frauen in Spitzenpositionen um durchschnittlich 2 Prozent innerhalb von vier Jahren ist wirklich kein Ruhmesblatt. Bei diesem Schneckentempo würde es noch ein weiteres halbes Jahrhundert dauern, bis in Führungspositionen Geschlechterproporz hergestellt ist. Auf weitere 50 Jahre Trippelschritte - das sage ich Ihnen ganz deutlich - können und wollen wir Frauen nicht warten.
Wenn die freiwilligen Vereinbarungen nicht zu einem Erfolg führen, muss ein Gleichstellungsgesetz her.
Ich betone an dieser Stelle ganz bewusst, dass das die Forderung der SPD-Frauenpolitikerinnen war und ist. Das ist gar keine Frage.
Norwegen - Frau Schewe-Gerigk hat das vorhin gesagt - macht es uns vor: Seit Beginn dieses Jahres ist gesetzlich geregelt, dass im Vorstand von Aktiengesellschaften mindestens 40 Prozent Frauen vertreten sein müssen. Eine zweijährige Phase der freiwilligen Selbstverpflichtung hatte zuvor nicht zu dem angestrebten Erfolg geführt.
Wir Frauen - auch das sage ich an dieser Stelle - haben auf das Antidiskriminierungsgesetz und die damit verbundene Gleichstellungsstelle gehofft. Beides hätte den Frauen geholfen, ihre Rechte besser durchzusetzen. Aber die gleichen Männer aus den Wirtschaftsverbänden, die an die Unternehmer appellieren, mehr dafür zu tun, dass Frauen Familie und Beruf vereinbaren können, bekämpfen das Antidiskriminierungsgesetz. Es sei zu bürokratisch und wettbewerbsfeindlich. Das legt die Vermutung nahe, dass die Chancengleichheit von Frauen und Männern zwar in Sonntagsreden als innovatives Thema angekommen ist, in der Realität aber noch nicht.
Deshalb appelliere ich an Herrn Braun und die Wirtschaftsverbände: Machen Sie sich die Erkenntnis zu Eigen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur ein Problem der Frauen ist. Tatsächliche Gleichstellung bedeutet, dass Männer und Frauen gleichermaßen und gleichberechtigt am Arbeitsmarkt vertreten sein müssen.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung fordert neben familiengerechten Arbeitsbedingungen bessere Möglichkeiten der Kinderbetreuung zur Verbesserung der Karrierechancen von Frauen. Der Ausbau von Kinderbetreuung bleibt auf unserer Agenda. Dafür stellen wir den Kommunen jährlich 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung.
- Frau Lenke, hören Sie weiter zu, es wird noch spannender. Wenn wir traditionelles Rollenverhalten aufbrechen wollen, brauchen wir zusätzliche Instrumente. Im Koalitionsvertrag haben wir uns tatsächlich - das ist vorhin schon erwähnt worden - auf das Elterngeld festgelegt. Bei einer 67-prozentigen Lohnersatzleistung bis zu einer maximalen Höhe von 1 800 Euro wird es den Vätern zukünftig schwer fallen, nach der Geburt eines Kindes zu sagen: „Schatz, bleib du doch zu Hause. Bei meinem hohen Einkommen lohnt sich Elternzeit nicht.“
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Humme, die Kollegin Lenke würde gerne eine Zwischenfrage stellen.
Christel Humme (SPD):
Nein, das möchte ich jetzt nicht - gleich!
Vielen jungen Männern kommt diese Regelung sogar entgegen. Sie möchten nach der Geburt ihres Kindes kein Feierabend- und Wochenendpapi sein, sondern sich mehr und stärker der Erziehungsarbeit widmen. Darum ist es mir - bis zum heutigen Tag - überaus unverständlich, dass ein Aufschrei durch den Blätterwald und durch manche männliche Politikerwelt ging, weil mindestens zwei Monate der Elternzeit den Vätern vorbehalten sein sollen, ähnlich, wie es uns Schweden und Island erfolgreich vormachen. Haben wir etwa die Männer erwischt, die sich ihr eigenes Lebensmodell geschaffen haben, die Hausfrau im Rücken, von der sie gerne als Familienmanagerin schwärmen, während sie selbst erfolgreich im modernen Ambiente leben und arbeiten? Rasten sie aus, wenn ihr eigener Lebensentwurf infrage gestellt ist?
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin Humme, würden Sie jetzt eine Zwischenfrage der Kollegin Lenke zulassen?
Christel Humme (SPD):
Vielleicht kann ich diesen Gedanken noch zu Ende führen. - Ich glaube, es würde eine wesentliche Änderung unseres Politikverhaltens bedeuten, wenn wir nicht nur Maßnahmen auf dem Arbeitsmarkt ergreifen, sondern gleichzeitig auch das Ziel verfolgen würden - das ist, soweit ich Sie, Frau Lenke, kenne, unser gemeinsames Ziel -, Rollenverhalten infrage zu stellen und zu verändern. Gerade das Elterngeld soll, indem auch die Väter in den Blick genommen werden, dazu ermuntern, neue Rollenkonzepte zu leben.
Ich weiß, dass Herr Braun bei der IHK-Veranstaltung genau diese Rollenveränderung nicht unbedingt im Blick hatte. Ich glaube, ihm sind zwei Erkenntnisse wichtig: erstens, dass die Wirtschaft aufgrund des zu erwartenden Fachkräftemangels nicht auf das Know-how von Frauen verzichten kann, und zweitens, dass eine Gesellschaft ohne Kinder schrumpft, was auch ein schrumpfendes Wirtschaftswachstum zur Folge hätte.
Egal, aus welcher Perspektive wir dieses Thema betrachten: Die Förderung der Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt ist unverzichtbar. Ich teile ausdrücklich die Auffassung, dass es im Interesse der Gleichstellung eine richtige Forderung ist, die Männerdominanz im Arbeitsleben zu brechen. Aber das geht meiner Ansicht nach nur, wenn wir auch die Frauendominanz bei der Familien- und Erziehungsarbeit brechen. Daran auch in Zukunft zu arbeiten, das wird unsere Aufgabe in der großen Koalition sein.
Danke schön.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Lenke, bitte.
Ina Lenke (FDP):
Frau Humme, die Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist wirklich keine rhetorische Frage, sondern sehr ernst gemeint:
Es geht um das Erziehungsgeld, das normalerweise zwölf Monate lang bezogen werden kann.
Diese zwölf Monate können die Eltern frei untereinander aufteilen. Auch wir wollen, dass der Bezug des Elterngeldes zwischen Vätern und Müttern frei aufgeteilt werden kann.
Ich kenne zwar nur die Umrisse der von Ihnen angedachten Regelung des Elterngeldes, aber bislang kann ich eine nur zehnmonatige Alimentierung erkennen. Denn heutzutage nehmen nur 5 Prozent der Männer Erziehungsurlaub.
Das bedeutet, dass in den nächsten Jahren statt zwölf nur zehn Monate genommen werden. Meine Frage lautet nun: Wollen Sie die Frauen bestrafen, die sich in ihrer Partnerschaft nicht durchsetzen können, dass ihr Mann zwei Monate zu Hause bleibt? Denn diese Familien bekommen nicht zwölf Monate Elterngeld, sondern nur zehn Monate. Das finde ich persönlich nicht in Ordnung und an Ihrem Konzept nicht gut.
- Natürlich. Das hat Frau von der Leyen doch schon in jeder Zeitung kommuniziert.
Christel Humme (SPD):
Frau Lenke, ich gebe zu, dass ich diese Frage vielleicht von Herrn Dörflinger oder Herrn Singhammer erwartet hätte, nicht aber von Ihnen.
Wenn ich die „Süddeutsche Zeitung“ von heute lese, wundere ich mich, dass Sie als Frauenpolitikerin Ihrer Fraktion unsere Forderung, die Väter stärker in die Familienarbeit einzubeziehen und zu diesem Zweck ein Modell zu kopieren, das in Schweden und Island bereits hervorragend funktioniert, nicht unterstützen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Schweden oder Island schon einmal jemand - erst recht nicht eine Frau - eine solche Frage gestellt hat.
Schönen Dank.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Ich gebe das Wort der Kollegin Karin Binder, Die Linke.
Karin Binder (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Meine Damen und Herren! Im Jahre 1910 hat die deutsche Sozialistin und Feministin Clara Zetkin den Grundstein für den gestrigen Internationalen Frauentag gelegt. Es ging ihr und ihren Mitstreiterinnen darum, Frauenrecht als Menschenrecht durchzusetzen. Die Frauenrechtsbewegung hat seit dieser Zeit einige Erfolge und damit auch einen großen gesellschaftlichen Fortschritt erzielt. Trotzdem gibt es noch viel zu tun.
Die Gleichberechtigung von Frauen ist in vielen Bereichen noch lange nicht verwirklicht.
Die aktuellen Berichte der Europäischen Kommission, der Bundesregierung und der Hans-Böckler-Stiftung liefern sehr anschauliches, ausführliches und detailliertes Datenmaterial und ernüchternde Ergebnisse. Sie belegen eines sehr deutlich: Frauen sind im Erwerbsleben nach wie vor massiv benachteiligt. Frauen verdienen im Durchschnitt circa 20 Prozent weniger als Männer. Deutschland steht damit in der EU an drittletzter Stelle. Die Europäische Kommission stellte fest, dass die geschlechtsspezifische Lohndifferenz in Deutschland im Gegensatz zu der in anderen europäischen Staaten nicht kleiner, sondern größer wird. Wenn diese Tendenz anhält, dann bringen wir es bald zur roten Laterne in der EU.
Nach dem WSI-Frauendatenreport der Hans-Böckler-Stiftung verdienen Frauen in Westdeutschland allein aufgrund ihres Geschlechts bis zu einem Drittel weniger. Im Osten fällt der Unterschied etwas geringer aus, aber das ist keine wirklich gute Nachricht; denn dort verdienen auch die Männer einfach weniger.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier besteht eindeutig Handlungsbedarf.
Es ist nicht damit getan, dass wir § 612 Abs. 3 ins Bürgerliche Gesetzbuch geschrieben haben, der die unterschiedliche Bezahlung von Frauen und Männern verbietet. Wir brauchen zudem verbindliche Verfahrensvorschriften, zum Beispiel ein Entgeltgleichheitsgesetz wie in Schweden. Dort müssen Arbeitgeber, die mehr als zehn Beschäftigte haben, Entgeltunterschiede identifizieren und sie müssen einen Aktionsplan für die Angleichung der Arbeitsentgelte aufstellen.
Wir fordern deshalb dringend die Einführung eines Gleichstellungsgesetzes für die Privatwirtschaft.
Freiwillige Regelungen reichen nachweislich nicht aus.
Nun komme ich zur Erwerbsbeteiligung. In Deutschland arbeiten generell weniger Frauen als Männer in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. Wenn Frauen eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, dann ist das immer häufiger nur eine Teilzeitstelle oder gar ein Minijob. Über zwei Drittel der ausschließlich geringfügig Beschäftigten sind weiblich. Der Anteil der Frauen, die weniger als 15 Stunden wöchentlich arbeiten, hat sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt. Solange wir dem nicht entgegenwirken, ist vielen Frauen eine eigenständige Existenzsicherung schlicht und ergreifend nicht möglich. Das heißt in der Konsequenz, sie sind finanziell wieder verstärkt von ihrem Partner oder von staatlicher Unterstützung abhängig. Dieses staatlich geförderte Ernährermodell ist kulturell und sozialpolitisch ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert.
Abgesehen davon geht es auch gesellschaftspolitisch an den Anforderungen des 21. Jahrhunderts vorbei. Der Mann geht arbeiten, sofern er überhaupt Arbeit hat, die Frau ist wieder für Familie und Hausarbeit zuständig und verdient dazu - in Lohnsteuerklasse V.
Das Ehegattensplitting ist ein gravierendes frauenfeindliches Element in unserem Steuerrecht. Unser Steuerrecht muss deshalb dringend geändert und gegendert werden,
wenn der Staat seinem Auftrag nach Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz nachkommen will, der dem Staat vorgibt, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken.
Wir müssen in diesem Land endlich anfangen, die bezahlte und die unbezahlte Arbeit umzuverteilen: zwischen Arbeitsplatzbesitzerinnen/Arbeitsplatzbesitzern und Erwerbslosen,
aber auch - geschlechtergerecht - zwischen Frauen und Männern; Arbeit ist schließlich mehr als genug vorhanden. Aber dazu ist ein gesamtgesellschaftliches Umdenken bei der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung nötig und die Abkehr vom Ernährermodell zwingend.
Wir müssen dafür sorgen, dass Frauen - und selbstverständlich auch Männer - von ihrem Einkommen leben können. Dazu brauchen wir neue Arbeitsplatz- und Arbeitszeitmodelle und dazu ist die Ausweitung des öffentlichen Beschäftigungssektors dringend erforderlich.
Wir brauchen existenzsichernde, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze und einen staatlich festgelegten Mindestlohn statt 1-Euro-Jobs, Minijobs und Niedriglohntarife.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf dringend - und das nicht nur auf dem Papier. In Deutschland gibt es auch heute noch viele Ecken - speziell im Westen -, wo die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familienpflichten schlicht unmöglich ist. Wissen Sie, wie die Betreuungssituation in Baden-Württemberg aussieht? Für Kinder unter drei Jahren gibt es so gut wie keine Betreuungsangebote.
Auf 1 000 Kinder kommen circa 13 Betreuungsplätze. Wie soll da eine junge Mutter ihre gute Qualifikation erhalten? Die Halbwertszeit für Wissen ist heute extrem kurz. Wenn sie drei Jahre zu Hause bleibt, gilt ihr Fachwissen eventuell schon als überholt.
Dank unserer hohen Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt wohnt Oma heute leider nicht mehr um die Ecke, nein, sie wohnt am anderen Ende von Deutschland; denn die jungen Menschen müssen ihr soziales Umfeld für die Chance auf einen Arbeitsplatz häufig verlassen. Da greifen nicht mehr die gewohnten Strukturen von Familie und Freundeskreis.
Kinderbetreuung, aber auch andere Leistungen müssen heute erkauft werden. Dies geht jedoch nur, wenn das Geld dafür auch da ist. Wenn das Geld dafür fehlt, helfen auch keine Steuerbegünstigungen. Dann hat Frau die Wahl: Entweder sie bleibt ganz zu Hause und kümmert sich um Kinder, Küche und den Gemüsegarten oder sie hat nebenher noch einen so genannten 400-Euro-Job, damit wenigstens noch ein kleines Zubrot ins Haus kommt.
Aus diesem Grund fordern wir einen Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung für alle Kinder von Geburt an und ein flächendeckendes, qualifiziertes und kostenfreies Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche von null bis 14 Jahren.
Solange es in der Bundesrepublik keine ausreichende Kinderbetreuung gibt und solange in der Regel Frauen diesen Mangel auffangen müssen, kann keine Rede von Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt sein.
Damit bin ich beim Thema Arbeitszeit, das mich seit mehreren Wochen besonders beschäftigt. Wie Sie wissen, sollen Beschäftigte im öffentlichen Dienst wieder länger arbeiten. Dabei geht es nicht nur um 18 Minuten Mehrarbeit am Tag, sondern es geht auch um Zigtausend Arbeitsplätze im Land - bis zu 250 000 -, die abgebaut werden sollen.
Damit geht es auch um einen erneuten Angriff auf die Gleichstellung von Männern und Frauen.
Die Erhöhung der Arbeitszeit - noch dazu ohne Lohnausgleich, wie es die Arbeitgeber fordern - bedeutet für die Beschäftigten nicht nur Einkommenseinbußen und niedrigere Stundenlöhne, längere Arbeitszeiten sorgen auch für weniger Freizeit, weniger Zeit für Familie, weniger Zeit für Kinder, weniger Zeit für Angehörige, weniger Zeit für das soziale Umfeld und persönliche Beziehungen
und auch weniger Zeit für das wichtige und oft geforderte bürgerschaftliche Engagement.
In der Regel werden die Männer diese Arbeitszeitverlängerung auf sich nehmen. Das zwingt aber die in Teilzeit arbeitenden Frauen meist, ihre Erwerbstätigkeit weiter zu reduzieren, da sie in der Regel die soziale Hauptverantwortung im privaten Bereich tragen und dort die Hauptarbeit leisten. Dies hat für die Frauen wiederum Einkommensverluste und, was noch schwerer wiegt, weitere Einbußen bei der Altersrente zur Folge.
Sie, die öffentliche Hand als Arbeitgeber, führen unsere Gesellschaft zurück in eine vermeintlich vergangene Zeit und zementieren längst überholte Rollenverteilungen der Geschlechter. Einmal abgesehen davon, dass ein Zurück zur 40-Stunden-Woche angesichts der Erwerbslosenzahlen in Deutschland schlicht und ergreifend rückschrittlich und kontraproduktiv ist: Längere Wochenarbeitszeiten ohne Lohnausgleich sind aus frauenpolitischer Sicht und unter dem Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit ein kompletter Unsinn und der völlig falsche Weg.
Deshalb sollten nicht nur meine Fraktion und ich, sondern wir alle die Streikenden in ihrem Bemühen um die Beibehaltung der bisherigen Arbeitszeit unterstützen.
Unser Staat muss laut Verfassung die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung fördern und dafür sorgen, bestehende Nachteile zu beseitigen. Dazu muss er gegebenenfalls gesetzliche Regelungen abschaffen oder zumindest ändern, wenn sich herausstellt, dass sie in ihrer Wirkung Frauen benachteiligen.
Damit komme ich zum Schluss auf Hartz IV zu sprechen. Durch die Bedarfsgemeinschaft à la Hartz IV und die Anrechnung des Partnereinkommens werden überwiegend Frauen vom Bezug staatlicher Leistungen ausgeschlossen. Sie werden finanziell in die Abhängigkeit ihres Partners gedrängt. Außerdem verlieren sie Rentenansprüche und das Recht auf Vermittlung und Weiterbildung durch die Bundesagentur. Auch damit wird das überkommene Ernährermodell und die ganz konkrete Benachteiligung von Frauen zementiert.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss.
Karin Binder (DIE LINKE):
Mein letzter Satz. - Das Konstrukt der Bedarfsgemeinschaft ist unsozial, ungerecht und frauenfeindlich und muss schleunigst abgeschafft werden.
Es muss durch den Individualanspruch auf eine existenzsichernde Grundsicherung für Frauen und Männer ersetzt werden.
Ich danke.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin, das war Ihre erste Rede hier. Dazu gratuliere ich Ihnen im Namen des ganzen Hauses und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit.
Als Nächstes hat das Wort die Kollegin Rita Pawelski, CDU/CSU-Fraktion.
Rita Pawelski (CDU/CSU):
Verehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Frau Schewe-Gerigk - - Wo ist sie jetzt?
- Ich sehe, sie kommt gerade. Setzen Sie sich wieder hin und hören Sie zu. - Als ich Ihren Antrag gelesen habe, habe ich gedacht: Donnerwetter, die Grünen haben aber Mut! Gerade einmal gut 100 Tage aus der Regierungsverantwortung und in der Opposition verfassen sie einen Antrag, in dem Deutschland als eine frauenpolitische Wüste dargestellt wird.
Da muss man sich schon fragen: Was haben denn die Grünen sieben Jahre lang in der Regierungsverantwortung getan? Eine Ihrer Kolleginnen war doch sogar Staatssekretärin im Frauenministerium.
Ich erinnere mich an viele Reden von Ihnen, Frau Schewe-Gerigk, die Sie im Ausschuss und auch hier gehalten haben. Auf unsere Fragen, ob man nicht mehr machen könne, haben Sie immer wieder versichert: Alles ist in bester Ordnung, wir haben alles im Griff, es ist wunderbar.
Geschmunzelt habe ich über Ihren klassenkämpferischen Ausdruck „Innovationshemmnis Männerdominanz beseitigen“.
Ich hatte schon den Eindruck, als hätten die Frauen bei den Grünen die „Fischer-Ära“ noch nicht ganz verarbeitet. Dass Sie unter der Dominanz von Herrn Fischer gelitten haben, glaube ich Ihnen schon.
Wir sind auf dem Wege zur Gleichstellung von Mann und Frau schon viele Schritte vorangekommen. Aber ganz ehrlich: Wir sind noch lange nicht am Ziel. Es stimmt: Noch immer sind Frauen in den Führungsetagen von Unternehmen unterrepräsentiert. Der Frauenanteil in Managerpositionen beträgt bei uns nur 28 Prozent, in Litauen 41 Prozent, in Irland 39 Prozent und in Lettland 38 Prozent. In den 200 DAX-30-Vorständen ist nur eine einzige Frau vertreten.
Das ist nicht gut; das muss man so deutlich sagen.
Ich habe nicht immer den Eindruck, dass in den Vorständen der DAX-30-Unternehmen alles in Ordnung ist und dort die besten Männer vertreten sind. Vielleicht wäre dort mit einem höheren Frauenanteil mehr los. Hier muss noch etwas getan werden. Dass Frauen auf Führungsebenen mehr können, beweisen wir doch im Bundestag mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Diese Frau ist top. Sie zeigt den Regierungschefs in Europa, wo es langgeht. Frauen können es also.
Leider muss ich auch sagen: Es stimmt, dass Frauen noch immer geringere Einkommen als ihre männlichen Kollegen haben. Von gleichem Lohn für gleiche Arbeit kann leider keine Rede sein. Weibliche Angestellte im produzierenden Gewerbe, im Handel, im Kredit- und Versicherungswesen verdienten im Jahr 2004 durchschnittlich 2 672 Euro, männliche Angestellte dagegen bei gleicher Arbeit 29 Prozent mehr.
Das ist auch in technischen Berufen so. Der Bruttojahresverdienst einer Technikerin zum Beispiel beträgt im Durchschnitt 31 400 Euro, der eines Technikers 45 400 Euro. Das ist nicht in Ordnung, zumal Frauen heute höhere und bessere Schulabschlüsse als Männer erreichen. Der Frauenanteil bei den Abiturienten lag 2004 bei 56 Prozent; 49 Prozent der Studienanfänger und Absolventen waren weiblich.
Ich frage mich deshalb, warum Frauen ihre Qualifikationen nicht in Führungspositionen und ein angemessenes Gehalt umsetzen können. Warum gelingt uns das nicht? Dafür gibt es mehrere Gründe. Das Karrierehindernis Nummer eins sind Vorurteile. Viele karriere- und familieorientierte Frauen werden im Job oft mit überholten gesellschaftlichen Rollenbildern konfrontiert. Ihr Verhalten wird mit ganz anderen Augen gesehen als das der männlichen Kollegen. Ein Familienfoto auf seinem Schreibtisch: Er ist ein solider, treu sorgender Ehemann. Ein Familienfoto auf ihrem Schreibtisch: Ihre Familie kommt vor dem Beruf. Er geht mit dem Chef zum Essen: Er macht Karriere. Sie geht mit dem Chef zum Essen: Sie haben wohl was miteinander. Bei ihm gibt es Nachwuchs: Grund für eine Lohnerhöhung. Bei ihr gibt es Nachwuchs: Sie fällt aus - die Firma zahlt.
Ein weiteres Karrierehindernis ist die Studien- und Berufswahl. Weibliche Studenten sind in zukunftsträchtigen technischen und naturwissenschaftlichen Studiengängen deutlich unterrepräsentiert. Man trifft sie vor allem in den Sprach-, Kultur- und Geisteswissenschaften sowie in gesundheitlichen und medizinischen Studiengängen.
54 Prozent - also mehr als die Hälfte - der weiblichen Auszubildenden wählen lediglich zehn der 360 anerkannten Ausbildungsberufe. Trotz Girls’ Day, Beratung, Flyern und Hinweisen geht immer noch über die Hälfte der jungen Frauen in zehn Ausbildungsberufe. Das sind Berufe wie Büro- und Einzelhandelskauffrau, Friseurin, Arzthelferin, Verkäuferin und Hotelfachfrau, die als frauentypische Berufe angesehen werden. Eigentlich wollen wir das doch nicht. Warum aber machen das die jungen Frauen immer noch so, obwohl sie wissen, dass das oft eine Sackgasse für ihre Karriere ist?
Das dritte und wohl größte Hindernis sind die Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das bestätigen auch Studien: 2003 waren nur 60 Prozent der Frauen mit Kindern unter zwölf Jahren erwerbstätig. Bei den kinderlosen Frauen waren es 79,5 Prozent. Das ist ein gravierender Unterschied. Frauen wollen aber beides: Sie wollen Beruf und Familie vereinbaren.
Familie darf kein Karrierehemmnis sein. Mütter bringen viele wichtige Kompetenzen mit, um die Produktivität von Unternehmen zu steigern. Sie sind gut organisiert, führungsstark und beherrschen das Zeitmanagement hervorragend. Sie sind ein Gewinn für Unternehmen.
Das müssen die Unternehmen auch langsam anerkennen.
Unsere Familienministerin Ursula von der Leyen engagiert sich in vorbildlicher Weise, um Hindernisse abzubauen. Sie kämpft für Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit und sensibilisiert Unternehmen für den Erfolgsfaktor Frau. Mit ihr sind wir auf dem richtigen Weg.
Denn eines muss klar sein: Wir müssen die Benachteiligungen von Frauen im Erwerbsleben beseitigen.
Aber dazu brauchen wir meines Erachtens keine neuen gesetzlichen Keulen. Die von den Grünen erhobene Forderung, öffentliche Aufträge nur an Unternehmen zu vergeben, die sich für Gleichberechtigung einsetzen, hilft nicht weiter.
Gesetze haben wir genug. Es gibt schon so viele Vorschriften und Gesetze. Was wir brauchen, sind Taten und Leute, die die Gesetze endlich umsetzen. Wir brauchen mehr Frauen, die den Mut haben, in Männerdomänen einzudringen, und wir brauchen mehr Männer, die den Mut haben, in Frauendomänen einzubrechen. Dort sind sie herzlich willkommen.
Wir brauchen mehr Männer, die sich auch der Kindererziehung und Kinderbetreuung widmen.
Sie fordern, den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im Bereich des Bundes geschlechtsneutral anzupassen.
Sehr geehrte Damen und Herren von den Grünen, warum haben Sie das in Ihrer Regierungszeit nicht getan? Ich sage noch einmal: Wir haben ein Gleichstellungsgesetz - das haben Sie mit verabschiedet - sowie Gleichstellungsbeauftragte in Bund, Ländern und Kommunen. Alle Gesetze werden heutzutage durchgegendert. Was fehlt, was wir brauchen, sind Vorgesetzte, die darauf achten, dass die bestehenden Gesetze eingehalten werden.
Völlig kontraproduktiv ist der Vorschlag, Unternehmen zu bestrafen, die nicht für Chancengleichheit sorgen. Welche Sanktionen wollen Sie hier eigentlich verhängen? Was ist mit Firmen, in denen körperlich schwere und gefährliche Arbeit vor allem von Männern verrichtet wird, zum Beispiel im Straßenbau? Frauen wollen hier gar nicht arbeiten. Aber gerade Straßenbaufirmen leben von öffentlichen Aufträgen. Daher ist Ihr Vorschlag nicht in Ordnung. Sie haben außerdem Norwegen als Beispiel genannt. Dazu kann ich nur sagen: Wir werden das Ganze sehr genau beobachten.
Wir brauchen aber kein neues Gesetz zur Herstellung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft. Ein solches Gesetz hat schon Exbundeskanzler Gerhard Schröder nicht gewollt. Er hat das von Ihnen geforderte Gesetz 2001 beerdigt mit der Begründung: „Nicht für jedes gesellschaftliche Problem muss ein Gesetz gemacht werden.“ Sie, meine Damen und Herren von den Grünen, waren damals Regierungspartner. Statt eines Gesetzes gab es eine freiwillige Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft. Sie haben jahrelang Zeit gehabt, bei jedem Firmenbesuch und in jedem Gespräch mit Unternehmern auf diese Vereinbarung hinzuweisen.
Wir wissen, dass die erzielten Erfolge verbesserungsfähig sind. Wir sind sicherlich nicht zufrieden. Aber wir haben etwas erreicht, und zwar auch aufgrund Ihrer Arbeit. Daher verstehe ich gar nicht, warum Sie das alles so wegwischen.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin, möchten Sie eine Zwischenfrage von Frau Haßelmann zulassen?
Rita Pawelski (CDU/CSU):
Nein. Meine Redezeit ist leider gleich zu Ende. Frau Haßelmann, bitte stellen Sie Ihre Frage anschließend.
Es gibt eine Zunahme bei der Zahl der weiblichen Führungskräfte um 2 Prozent. Das ist sicherlich nicht genug. Kluge Chefs brauchen keine gesetzliche Gängelung; denn sie erkennen das Potenzial gut ausgebildeter und hoch motivierter Frauen und werben rechtzeitig um sie. Schon allein mit Blick auf den demografischen Wandel müssen sie es tun; denn sonst bleiben ihre Unternehmen nicht wettbewerbsfähig. Es gibt bereits positive Beispiele, wenn auch nicht genug. Wir brauchen jedenfalls mehr kluge Chefs.
Auch bei den Existenzgründungen berufen Sie sich auf etwas, was wir eigentlich schon haben. Es gibt bereits Existenzgründerinnenzentren und Beratungsstellen für Frauen in fast jeder großen Stadt.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen.
Rita Pawelski (CDU/CSU):
Ja. - Bei den Industrie- und Handelskammern sowie bei den Handwerkskammern gibt es gute Beratungsstellen, für die sicherlich noch mehr Werbung gemacht werden müsste.
Wir sind auf einem guten Weg. Wir wollen keine neuen Gesetze, sondern, dass die bestehenden Gesetze eingehalten werden.
Vielen Dank.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Zu einer Kurzintervention erteile ich das Wort der Kollegin Britta Haßelmann.
Britta Haßelmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Sehr geehrte Kollegin, schade, dass Sie meine Zwischenfrage nicht zugelassen haben. Dabei wäre das doch gar nicht auf Ihre Redezeit angerechnet worden. Ich nutze deshalb die Gelegenheit, eine Kurzintervention bzw. eine Kurzmitteilung zu machen.
Wir haben von Ihnen erfahren, was Sie alles nicht wollen, nämlich eine klare Aussage dazu, dass das Antidiskriminierungsgesetz eigentlich keinen Beitrag zur Gleichstellung leistet, und eine Antwort auf die Frage, wie wir es hinbekommen, dass die Wirtschaft ihren Beitrag zur Gleichstellung leistet. Zuletzt haben Sie gesagt, es gebe keine Notwendigkeit, gesetzliche Regelungen zu beschließen. Ich habe Ihren Koalitionsvertrag anders verstanden. Aber ich gehöre Gott sei Dank nicht zu denjenigen, die mit Ihnen darüber zu verhandeln haben. Mein Eindruck ist jedenfalls, dass sich SPD und Union über den Bereich der Gleichstellung eigentlich verständigen wollen.
Da Sie Ihre Redezeit ausschließlich dazu genutzt haben, zu sagen, was Sie alles nicht wollen, interessiert mich nun, was die Union vorschlägt, damit wir bei den Themen „Frauenförderung“ und „Gleichstellung“ vorankommen. Damit haben Sie deutlich unter Beweis gestellt, dass Sie keine Antworten zu geben haben.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin Pawelski.
Rita Pawelski (CDU/CSU):
Verehrte Frau Kollegin, zuerst einmal muss ich sagen: Sie haben nicht richtig zugehört;
denn ich habe sehr wohl gesagt, was wir wollen. Ich habe gesagt: Wir haben so viele Gesetze, dass sie mittlerweile ganze Bibliotheken füllen. Wir wollen, dass diese Gesetze endlich von den Behörden und den Unternehmen umgesetzt werden. Sie waren sieben Jahre in der Regierungsverantwortung. Sie hätten jahrelang Zeit gehabt, bei jedem Besuch in einer Behörde oder in einem Unternehmen darauf hinzuweisen, dass die Chancengleichheit für Frauen durchgesetzt werden soll. Sie hätten ständig die Vereinbarung vom Juli 2001, die der damalige Bundeskanzler mit den Unternehmen geschlossen hat, in der Tasche haben müssen, hätten sie jedem Unternehmen zeigen und sagen müssen: Das haben Ihre Funktionäre unterschrieben. Bitte, richten Sie sich danach! - Das haben Sie nicht ausreichend getan. Die Folge davon ist Ihr Antrag.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Das Wort hat die Kollegin Renate Gradistanac von der SPD-Fraktion.
Renate Gradistanac (SPD):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der gestrige 95. Frauentag ist der erste Frauentag in Deutschland mit einer Frau an der Spitze der Regierung, Frau Bundeskanzlerin Merkel.
Schade, dass sie nicht da ist. Ich freue mich aber, dass unser Vizekanzler die ganze Zeit so aufmerksam zuhört. Herzlichen Dank!
Frauen kämpfen noch immer gegen Vorurteile und traditionelle Frauenbilder in den Köpfen von Männern. Aber auch viele Frauen haben ein konservatives Rollenbild. Konservative Männer und Frauen erschweren den Anstieg der Zahl weiblicher Vorbilder. Wir brauchen mehr Frauen, an denen sich Frauen orientieren können. Wir heißt es so schön? Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
Wo sind denn Frauen in Gremien oder an der Spitze von Organisationen gleichberechtigt vertreten? Nicht im Deutschen Bundestag. Von 33 CDU-Abgeordneten aus Baden-Württemberg sind gerade einmal zwei Frauen. Bei der SPD sind von 23 Abgeordneten zehn Frauen.
Nicht beim DIHK. Bei der Spitzenorganisation der Industrie- und Handelskammern ist nicht eine Frau im Vorstand. Nicht beim Handwerk. Im Präsidium des ZDH ist eine Frau vertreten. Nicht bei den Arbeitgeberverbänden. Unter den 89 Mitgliedern im BDA-Vorstand befinden sich vier Frauen. Nicht bei den Banken. Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Banken: Fehlanzeige. Vorstand des Bundesverbands Öffentlicher Banken: Fehlanzeige. Vorstand der Deutschen Bundesbank: Fehlanzeige. Im Vorstand der KfW-Bankengruppe sitzt eine Frau, Ingrid Matthäus-Maier.
Übrigens auch nicht bei den Gewerkschaften. Keine Frau ist Vorsitzende einer der acht DGB-Gewerkschaften. Von den 13 Mitgliedern im Bundesvorstand des DGB sind zwei Frauen.
Da, wo Macht und Geld verteilt werden - das ist ein alter Hut; umso trauriger -, muss frau schon ganz genau hinschauen, um überhaupt eine Frau zu finden und um Fortschritte zu erkennen. In den obersten Leitungsebenen von Betrieben und im Topmanagement findet Gleichstellung leider nur Schritt für Schritt statt. Wir kritisieren das, wir bedauern das und wir hoffen, dass sich die Schritte ein bisschen beschleunigen.
Der Antrag der Grünen stößt bei mir auf viel Sympathie.
Mir gefällt die Überschrift „Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt verwirklichen - Innovationshemmnis Männerdominanz beenden“. Ich finde das toll. Diese Überschrift provoziert - ich merke das -, aber ich finde auch, dass es eine unerträgliche Provokation ist, dass Frauen in Deutschland im Durchschnitt immer noch 23 Prozent weniger verdienen als Männer. Darüber sollten wir uns aufregen.
Im Antrag der Grünen wird darauf hingewiesen, dass die Unterschiede nicht durch strukturelle Differenzen zu erklären sind, sondern allein durch die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.
Ich erwarte von den Tarifpartnern, dass sie sich endlich einmal mit dem Thema Gleichstellungspolitik beschäftigen. Sie sollten dieses Thema nicht nebenbei behandeln wie in der Vergangenheit, sondern entschlossen und prioritär. Hierbei sind die Arbeitgeberseite und die Gewerkschaftsvertreter gefordert. Ich denke an die Herren Hundt, Sommer, Braun und wie sie alle heißen. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit! Wie lange sollen gut und bestausgebildete Frauen aller Einkommensstufen Lohndiskriminierung eigentlich noch hinnehmen?
Das rot-grüne Antidiskriminierungsgesetz war in der letzten Legislaturperiode - leider, leider! - nicht durchsetzbar.
- Es war nicht durchsetzbar, und wir wissen, warum. - Dieses Gesetz bietet gute Möglichkeiten. Die geforderte nationale Stelle - mein Wunsch ist, dass sie beim Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend angesiedelt wird - halte ich für ein hilfreiches Instrument, um bestehende Diskriminierung abzubauen. Voraussetzung hierfür sind allerdings die Unabhängigkeit dieser Stelle und eine ausreichende finanzielle und personelle Ausstattung.
Ich will, dass wir den Diskriminierungsschutz sowohl im Zivilrecht als auch im Arbeits- und Sozialrecht für Frauen jeden Alters, für Migrantinnen, für Lesben und für Frauen mit Behinderungen umsetzen. Gerade Frauen mit Behinderungen erzielen - das zeigt der Zweite Armuts- und Reichtumsbericht - deutlich niedrigere Einkommen als Männer mit Behinderungen.
Ich bedauere - das ist meine persönliche Meinung -, dass es während der rot-grünen Regierungszeit nicht gelungen ist, ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft durchzusetzen.
Die Bilanz der freiwilligen Vereinbarung von Spitzenverbänden der Wirtschaft und der Bundesregierung ist wahrlich kein Grund zum Jubeln. Es gibt Bewegung beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir SPD-Frauen wollen aber nicht nur Familienförderung, sondern auch eine gezielte Frauenförderung.
Auffallend ist - das haben wir mittlerweile schon mehrmals gehört -, dass kleine Betriebe häufiger von Frauen geführt werden und dass große Betriebe eher von Männern geführt werden. Weibliche Führungskräfte sind überwiegend in Betrieben des Gesundheitswesens, des Sozialwesens, im Groß- und Einzelhandel sowie in den Bereichen Gastronomie und Kosmetik anzutreffen. Deshalb ist die EU-Dienstleistungsrichtlinie für uns Frauen von großer Bedeutung. Der Kompromiss, den wir maßgeblich der SPD-Europaabgeordneten Evelyne Gebhardt zu verdanken haben, bietet eine gute Arbeitsgrundlage für EU-Kommission und Rat. Ich plädiere dafür, die Dienstleistungsrichtlinie vom Gender-Kompetenz-Zentrum evaluieren zu lassen.
Die Gleichstellung der Geschlechter ist im Rahmen der Lissabonstrategie ein Instrument für Wachstum und Beschäftigung. Mehr Arbeitsplätze für Frauen ist eines der Ziele, deren Erreichung ich von dieser Bundesregierung erwarte. Mit „mehr Arbeitsplätze“ meine ich Arbeitsplätze für Frauen mit existenzsichernden Löhnen.
Wir in Deutschland können den Wettbewerb nur gewinnen, wenn die Kinderbetreuung uneingeschränkt gesichert ist. Väter und Mütter müssen darauf bauen können, dass die Infrastruktur in jedem Kindesalter verlässlich ist. Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz und dem Ganztagsschulprogramm haben wir in der letzten Legislaturperiode eine gute Grundlage gelegt.
- Ich warte darauf, dass mehr klatschen. -
Mit der Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten und dem zukünftigen Elterngeld gehen wir diesen Weg weiter.
Die Dienstleistungsverbände in Baden-Württemberg haben in einem Positionspapier zur dortigen Landtagswahl zu Recht einen Betreuungsplatz für jedes Kind bis zum Schulalter und bedarfsgerechte Öffnungszeiten von Betreuungseinrichtungen gefordert, und zwar - das ist für berufstätige Menschen wichtig - ganzjährig und über 16 Uhr hinaus.
Letztes Thema. Deutschland ist bereits Fußballweltmeister; das gilt jedenfalls für die Frauenmannschaft.
Jetzt wollen wir einmal schauen, was die Männer so können! Klaus Wowereit und Theo Zwanziger sind Schirmherren der Kampagne „Abpfiff - Schluss mit Zwangsprostitution“, die der Deutsche Frauenrat anlässlich der Fußballweltmeisterschaft gestartet hat. Frauenhandel und Zwangsprostitution sind kriminell und verletzen die Menschenwürde. Von den Männern, die zu Prostituierten gehen - wir wissen, dass das sehr viele sind -, wünsche ich mir, dass sie bei Verdacht auf Zwang und Gewalt Meldung erstatten. Es wird eine Telefonnummer geben, an die sie sich anonym wenden können. Den Frauen, die legal und selbstbestimmt der Prostitution nachgehen, wünsche ich gute Geschäfte.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen.
Renate Gradistanac (SPD):
Ja, letzter Satz. - Ich hoffe, dass wir in Kürze weitere gesetzliche Verbesserungen für Prostituierte erreichen werden.
Ich wünsche der Bundeskanzlerin und der Ministerin Ursula von der Leyen viel Freude und Erfolg bei der Gleichstellungspolitik.
Vielen Dank.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Das Wort hat die Kollegin Sibylle Laurischk, FDP-Fraktion.
Sibylle Laurischk (FDP):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Frau Ministerin, es freut mich, dass Sie den Weg zu uns noch gefunden haben. Einer frauenpolitischen Diskussion zuzuhören, ist für eine Ministerin, gerade wenn sie frisch im Amt ist, sicherlich wichtig und richtig. Ich bin sicher, dass Sie uns in Zukunft bei frauenpolitischen Diskussionen ganz besonders begleiten.
Mit dem Thema Männerdominanz ist ein Tag nach dem Internationalen Frauentag, gewissermaßen am „Day after“, hier im Deutschen Bundestag ein interessantes Thema aufgesetzt worden. Die Männerdominanz ist in Familien und Communities hier lebender Migrantinnen und Migranten präsent. Gerade auf dieses Thema möchte ich Ihr besonderes Augenmerk lenken.
Uns ist es noch nicht gelungen, Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund in unsere westliche und freiheitlich orientierte Gesellschaft zu integrieren. Tagtäglich ist die Diskriminierung von Frauen und Mädchen in der patriarchialen Gesellschaft, in der sie aufwachsen, präsent.
Das große Potenzial auch von Migrantinnen für unsere Wirtschaft und für unser Wirtschaftsleben gilt es zu erschließen. Ohne Wenn und Aber muss die Schulpflicht zur Bildungschance werden. Das ist eine Aufgabe, der wir uns verstärkt annehmen müssen.
Nur so erhält eine offene Zuwanderungspolitik auch ihre innere Bestätigung.
Wichtigste Instrumente zur Vorbereitung auf die Teilnahme am Arbeitsmarkt sind hierbei die verbindliche und verbindende Deutschpflicht in der Schule und auf den Schulhöfen sowie die obligatorische Teilnahme am Sport- und Biologieunterricht und an den für eine Gruppenbildung wichtigen Klassen- oder Wandertagsfahrten.
Eine von den Familien diktierte Ausgrenzung der Mädchen im Kindes- und jugendlichen Alter darf es nicht geben.
Die Bereitschaft von Migrantinnen, selbstständig oder als Unternehmerinnen tätig zu werden, ist besonders zu fördern. Frauen mit Migrationshintergrund, die zwei Sprachen sprechen, können als Mittlerinnen fungieren. Ihnen kommt eine besondere Bedeutung zu, da sie Integration authentisch vorleben, auch mit der Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit ihres Lebens, losgelöst von der Dominanz von Vätern, Brüdern oder Cousins.
Soziale Gettos müssen aufgebrochen und Parallelwelten geöffnet werden. Gleichberechtigung der Geschlechter muss als Wertgerüst Europas und der westlichen Welt vorgelebt und mit den hier lebenden Migranten entwickelt werden.
In Anbetracht des Gender Mainstreaming müssen wir uns auch die Situation von Männern vor Augen führen. Gerade Männern mit Migrationshintergrund wird ein Rollenbild abverlangt, das sie in Deutschland nur noch schwer erfüllen können. Hierbei ist es wichtig, dass schon früh eine Erziehung hin zur westlichen, europäischen Lebenswelt stattfinden kann. Außerdem ist es wichtig, dass gerade Mütter in Familien mit Migrationshintergrund die deutsche Sprache lernen, damit sie ihren Söhnen die deutsche Gesellschaft erklären können. Hier gibt es ja interessante Modelle. Ich denke nur an die Beispiele, die uns gestern die Integrationsbeauftragte vorgetragen hat.
Meine Damen und Herren, Frauenpolitik ist ein Faktor, der für eine erfolgreiche Gesellschaft wichtig ist. Die Einbindung von gut ausgebildeten Frauen und Männern mit Migrationshintergrund in die deutsche Arbeitswelt stellt auch eine Möglichkeit dar, unserem demographischen Defizit auf wirtschaftlichem Gebiet zu begegnen.
Frau Humme, Sie haben ja Aussagen des Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages zitiert. Dazu möchte ich nur ergänzen: Er ist ein Liberaler.
Insofern, denke ich, war Ihre Bemerkung, mit dem Liberalismus sei eine Politik der Beliebigkeit verbunden, schlichtweg falsch; denn der Liberalismus ist eine Emanzipationsbewegung.
Somit können wir auf eine lange Tradition in diesem Politikbereich verweisen.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin, Sie müssten nun Ihre Rede beenden.
Sibylle Laurischk (FDP):
Mein letzter Satz. - Durch die besondere Förderung von Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund können wir ein positives Beispiel geben für Gleichberechtigung im doppelten Sinne: Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und zwischen den unterschiedlichen in Deutschland lebenden Ethnien.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Das Wort hat die Kollegin Elisabeth Winkelmeier-Becker, CDU/CSU-Fraktion.
Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das vor uns liegende Jahrhundert ist das Jahrhundert der Frauen. Das ist die Prognose des Zukunftsforschers Matthias Horx. Mit diesem Satz leitet auch die Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft ihre neue Studie über Mütter in Führungspositionen ein. Nicht nur in Bezug auf die demographische Entwicklung, sondern auch mit Blick auf die aktuellen ökonomischen Herausforderungen werden Frauen die entscheidende Rolle für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes spielen.
In der Analyse sind wir uns einig: Inzwischen erreichen in Deutschland mehr Frauen als Männer die Allgemeine Hochschulreife; bei den Studienanfängern ist die Bilanz noch ausgeglichen; auf dem Arbeitsmarkt wird dann aber eine Gleichstellung von Frauen und Männern bei weitem noch nicht erreicht. Vor allem in den einflussreichen und einträglichen Positionen sinkt der Anteil der Frauen hierzulande immer noch dramatisch ab und sie erzielen regelmäßig nur etwa 77 Prozent der Gehälter ihrer männlichen Kollegen, auch wenn es sich um absolut vergleichbare Positionen und Tätigkeiten handelt.
Das hat viele Ursachen, unter anderem auch die Berufswahl von Frauen, die sich vielfach für so genannte frauentypische Berufe entscheiden. Das ist meiner Ansicht nach - dieser Gedanke findet sich ja auch in den Anträgen der Opposition - ein Missstand. Wir müssen Mädchen und Frauen ermuntern, sich nicht durch einseitige Rollenbilder vom Einstieg in interessante und lukrative Berufe abhalten zu lassen.
Hierzu steht allerdings ein Punkt im Antrag der FDP im Widerspruch: Sie begründen nämlich dort die Forderung nach Abschaffung von Hemmnissen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze vor allem im Dienstleistungssektor damit, dass hier in der Regel besonders gute Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen bestünden. Damit legen Sie Frauen ja wieder auf einen frauentypischen Bereich fest, in dem sie wieder nicht den Einfluss haben und nicht das Geld verdienen können wie in anderen Positionen, die zukunftsträchtiger sind. Diese Forderung hilft uns deshalb, auch wenn sie in anderen Zusammenhängen durchaus berechtigt ist, bei dem Punkt, um den es hier geht, nämlich der Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, nicht wirklich weiter.
Mir liegt folgender Punkt besonders am Herzen, wobei dieser nicht die einzige Ursache für die Probleme darstellt: Schwierigkeiten bereitet vielen jungen Frauen vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das führt dazu, dass die Frauen, die trotz aller Hindernisse berufliche Karriere machen, mehr und mehr auf Kinder verzichten. Frauen, die es in Führungspositionen schaffen, sind häufiger kinderlos als Männer in vergleichbaren Positionen. Bei den Akademikerinnen liegt der Anteil derjenigen, die sich komplett gegen Kinder entscheiden, mittlerweile bei bis zu 40 Prozent. Mehrere Kinder sind in diesem Fall sogar noch seltener. Das macht uns an anderer Stelle, bei der demografischen Entwicklung in der Bundesrepublik mit all ihren negativen Auswirkungen auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationsfähigkeit unseres Landes, ganz erhebliche Sorgen.
Wenn sich eine qualifizierte Frau für Kinder entscheidet, dann führen alte gesellschaftliche Leitbilder, das traditionelle Rollendenken, männliche Vorurteile und Seilschaften, vor allem aber die praktischen Probleme bei der Vereinbarkeit von Kindererziehung und Karriere immer noch dazu, dass auch begabte junge Mütter aufgeben und sich länger, als sie es selbst wünschen, und mit großen Nachteilen bezüglich ihrer Chancen auf eine weitere Karriere auf dem Arbeitsmarkt aus dem Berufsleben zurückziehen.
Ich möchte hier aber auch nicht unerwähnt lassen, dass sich viele Eltern sehr gerne um ihre Kinder kümmern und dafür die Berufstätigkeit bewusst ganz oder teilweise zurückstellen. Ich habe das selber so gemacht. Ich war als Mutter von drei Kindern jahrelang als Richterin teilzeitbeschäftigt und ich bin nicht bereit, mich dafür in irgendeiner Weise zu rechtfertigen, auch wenn das die Nachteile, die damit verbunden sind, nicht gerechter macht.
Fakt ist, dass zu wenige Frauen in Fach- und Führungspositionen, ein zahlenmäßig zu kleiner qualifizierter weiblicher Nachwuchs in manchen Disziplinen und zu wenige positive weibliche Vorbilder für die nachkommende Generation vorhanden sind. Diese Benachteiligung von Frauen stellt eine Vergeudung von Ressourcen und einen Verzicht auf wichtiges Innovationspotenzial dar.
Die eingangs genannte Studie der EAF zeigt, wie sehr familienbezogene und berufliche Kompetenzen sich positiv verstärken. Für Unternehmen wertvolle Verhaltensweisen wie Gelassenheit, Organisationsfähigkeit und Pragmatismus werden durch den Alltag mit Kindern deutlich verstärkt und ausgeprägt. Müttern oder auch praktizierenden Vätern fällt es nachweislich leichter, Konflikte zu lösen, Arbeiten zu delegieren, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und sich die Zeit sinnvoll einzuteilen; es bleibt einem ja auch nichts anderes übrig. In dieser Hinsicht verschwenden wir wertvolles Know-how, wenn wir es nicht schaffen, diese Frauen, soweit sie dazu bereit sind, in den Arbeitsprozess zurückzuholen.
Die Union hat früh erkannt, dass Deutschland es sich nicht länger leisten darf, Frauen zu hoch qualifizierten Fachkräften auszubilden und sie dann auf einen Arbeitsmarkt zu entlassen, der sie - im Gegensatz zu den männlichen Kollegen - praktisch dazu zwingt, sich zwischen Kindern und Karriere zu entscheiden. Unsere Gesellschaft braucht Frauen in beiden Rollen: auf dem Arbeitsmarkt als qualifizierte Fach- und Führungskräfte und als engagierte Mütter.
Mit unserem Antrag „Tatsächliche Gleichberechtigung durchsetzen - Zehn Jahre Novellierung des Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes“ haben wir bereits in der vergangenen Wahlperiode gefordert, die Gleichstellungspolitik als zentrales Element der Gesellschafts- und der Wirtschaftspolitik zu begreifen und die Freiheit der Wahl zwischen Beruf und Familie durch geeignete Maßnahmen zu fördern. Diesen Antrag haben Sie, liebe Kollegen und Kolleginnen von den Grünen, damals abgelehnt.
Inzwischen ist die Union in der Regierungsverantwortung. Gemeinsam mit der SPD haben wir uns im Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, uns für gleiche Karrierechancen und den gleichberechtigten Zugang zu Führungspositionen in Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung für Frauen und Männer einzusetzen. Gleichzeitig haben wir umfangreiche familienpolitische Maßnahmen festgeschrieben, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mütter und Väter erleichtern sollen.
Nach nur 100 Tagen im Amt hat die Koalition es bereits geschafft, die Familien- und damit auch die Gleichstellungspolitik ganz oben auf die politische Agenda zu setzen.
Familien werden nun die Möglichkeit erhalten, Kinderbetreuungskosten in deutlich größerem Umfang von der Steuer abzusetzen. Dies erleichtert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und davon profitieren vor allem Frauen, die nach einer Kinderphase in den Beruf zurückkehren wollen.
Wir brauchen aber auch ein Umdenken bei den Arbeitgebern, vor allem in deren eigenem Interesse. Sie müssen erkennen, dass die demografische Entwicklung und der absehbare Fachkräftemangel es unverzichtbar machen, dass Frauen entsprechend ihrer Qualifikation beruflich tätig sein können. Das schließt ein, dass zum Beispiel durch flexible Arbeitszeiten, durch Verständnis für die Belange von berufstätigen Müttern und durch unkomplizierte praktische Hilfe ein familienfreundliches Umfeld geschaffen wird.
In diesem Zusammenhang ist auch die Ausgestaltung des geplanten Elterngeldes wichtig, bei der die Zahlungen für die letzten Monate, nach jetziger Planung für den elften und zwölften Monat, davon abhängen sollen, dass beide Eltern mindestens für zwei Monate die Kindererziehung übernehmen. Bislang wird das Risiko, dass ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin wegen Kindererziehung zumindest vorübergehend aus dem Beruf ausscheidet, vor allem den Frauen zugeschrieben. Dies stellt tatsächlich ein Hindernis bei der Einstellung, aber auch bei der Auswahl für Qualifizierungsmaßnahmen dar.
Wenn in Zukunft mehr Väter als bislang aufgrund des Anreizes, den diese Regelung setzt, für einige Zeit für die Kindererziehung aus dem Beruf ausscheiden - dies erhoffen wir vor allem im Interesse der Kinder und auch der Väter selbst, denen wir diese schöne und spannende Phase nicht vorenthalten wollen -,
dann wird sich auch hier ein Ausgleich zwischen den Geschlechtern einstellen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, wir haben doch alle erkannt, wie vordringlich wichtig es ist, dass Frauen gleichberechtigt in den Arbeitsmarkt integriert werden.
- Die Opposition ist in diesem Saal gut verteilt. - Wir sind als Gesetzgeber nach Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes verpflichtet, hierzu die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Das wird die Union ganz nachdrücklich auch weiterhin tun.
Die Erfahrung hat aber auch gezeigt, dass Chancengleichheit letztlich nur in geringem Maße per Gesetz verordnet werden kann. Denn vieles beruht auf den doch freiwilligen Entscheidungen der Mädchen und Frauen, um die es geht. Wichtige Änderungen in den Rahmenbedingungen sind auf den Weg gebracht. Darüber hinaus sind gesetzliche Sanktionen und Eingriffe in die Privatautonomie meiner Ansicht nach nicht wirklich zielführend.
Wir müssen ein Umdenken in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt erreichen. Konzepte wie der Girls’ Day oder das von der Bundesregierung unterstützte Mentoringprojekt TWIN sind die richtigen Ansätze. Auf diesem Weg müssen wir weitergehen, damit jede Frau in Deutschland die Chance erhält, sich nach ihren Neigungen und Fähigkeiten in diese Gesellschaft einzubringen und sie zu bereichern.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin, das war Ihre erste Rede im Deutschen Bundestag. Wir gratulieren Ihnen herzlich und wünschen für die weitere Arbeit alles Gute.
Als nächstem Redner gebe ich dem Kollegen Sönke Rix von der SPD-Fraktion das Wort.
Sönke Rix (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Wo ich herkomme, sagt man zu dieser Tageszeit, wie auch zu jeder anderen Tageszeit: Moin.
Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ...
So steht es im Grundgesetz: „Der Staat fördert ...“ Er fordert sie nicht und setzt sie nicht tatsächlich durch; er fördert sie. Das ist auch gut so.
Gleichberechtigung kann nicht befohlen werden. Sie - das sage ich an die Adresse der Grünen - beschreiben das ja auch in Ihrem Antrag. Ich zitiere:
Denn Gleichberechtigung ergibt sich nicht automatisch, sondern muss gesellschaftlich, politisch und
- ich füge ein: erst dann -
gesetzlich begleitet und gestaltet werden.
Die Gleichstellung betrifft Männer und Frauen.
Also kann auch die Überwindung der noch bestehenden „Männerdominanz“ nur gemeinsam mit den Männern gelingen, mit der gleichzeitigen Erkenntnis, dass ein Beitrag beider Geschlechter in Familie und Beruf und somit für die Gesellschaft erforderlich ist.
Hier steht die Kuh auf dem Eis. Wir brauchen ein Umdenken in den Köpfen aller Beteiligten. Ich habe nichts dagegen, wenn ein jeder nach seiner Fasson sein Familienleben gestaltet. Das ist gut und auch richtig so; so soll man es machen. Wer aber einen anderen Lebensentwurf hat, als Einzelperson oder auch als Familie, muss die Möglichkeit haben, diesen auch zu leben.
Der Mann geht zur Jagd und die Frau sitzt in der Höhle und passt auf die Kinder auf; das ist schon lange keine zeitgemäße Rollenverteilung mehr. Wenn wir dieses traditionelle Rollenmodell überwinden, haben wir nebenbei auch das von Ihnen zitierte „Innovationshemmnis Männerdominanz“ überwunden. Dies ist im Übrigen ein sehr fragwürdiger Ausdruck. Er macht nämlich deutlich, was nicht zum Erfolg führen kann: ein Gegeneinander aller Beteiligten.
Nun weiß ich ja, dass Sie mit diesem Titel nur provozieren wollen. Aber zu viel Provokation kann dazu führen, dass nur noch über den Titel geredet wird. Das wollen wir alle gemeinsam nicht.
Wir alle wollen das Gleiche, nämlich eine Verstetigung unseres gemeinsamen Ziels: die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Der gestrige Internationale Frauentag hat noch einmal verstärkt ein Augenmerk auf die Situation der Frauen in unserer Gesellschaft gerichtet. Dabei wird deutlich, dass es noch viel zu tun gibt, auch für uns Männer, wie ich an dieser Stelle sagen muss.
Wir müssen es gemeinsam schaffen, die politischen Rahmenbedingungen so zu verändern, dass die Väter nicht mehr in dem üblichen Rollenverständnis verharren müssen.
Wo wollen wir hin? Wir wollen dahin kommen, dass es für Arbeitgeber nicht mehr selbstverständlich ist, dass nach der Geburt eines Kindes automatisch die Mutter zu Hause bleibt. Wir wollen dahin kommen, dass der Vater sein Recht auf Teilzeit oder Elternzeit in Anspruch nimmt.
Wir wollen dahin kommen, dass der Arbeitgeber und die Arbeitgeberin sich nicht mehr auf der sicheren Seite wähnen, wenn sie vorwiegend Männer einstellen.
Diesen Weg wollen wir alle hier im Haus - so hoffe ich zumindest - gemeinsam beschreiten.
Die vorliegenden Anträge zielen zwar zum Teil in die richtige Richtung. Aber wir haben mit unserer Familienpolitik bereits die Weichen in die richtige Richtung gestellt. Mit dem Elterngeld sind wir zum Beispiel den richtigen Weg gegangen, Vätern das Zu-Hause-Bleiben schmackhaft zu machen. Es gibt sie, die Väter, die den Nachmittag mit dem Kinderwagen auf dem Spielplatz verbringen wollen. Viele können sich dies zurzeit aber einfach nicht leisten. Da haben wir angesetzt. Mit unseren Bemühungen um eine verstärkte Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird vielen Männern - gerade auch meiner Generation - geholfen, dem Willen auch Taten folgen zu lassen.
Zum Schluss möchte ich einen Absatz aus dem Antrag der Grünen zumindest teilweise geraderücken. Ich zitiere:
Gleichzeitig beschränken Geschlechterklischees auch Jungen in ihrer Berufswahl, die öffentliche Diskussion um Männer in Erzieherberufen spiegelt die individuellen und gesellschaftlichen Nachteile wider.
Dazu muss ich als staatlich anerkannter Erzieher sagen:
Ich konnte weder eine öffentliche Diskussion um meine Berufswahl noch irgendwelche gesellschaftlichen Nachteile feststellen.
Insofern möchte ich alle ermutigen, sich nicht auf die Rollenfestschreibungen in der Berufswelt einzulassen. Es gibt keine klassischen Männer- und Frauenberufe mehr.
Ich füge hinzu: Es gibt hoffentlich auch keine klassische Rollenverteilung innerhalb der Familie mehr.
Danke schön.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege Rix, das war Ihre erste Rede hier. Wir gratulieren herzlich und wünschen Ihnen alles Gute.
Zum Abschluss der Debatte gebe ich das Wort der Kollegin Angelika Graf, SPD-Fraktion.
Angelika Graf (Rosenheim) (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! „Frauen in Deutschland: Riesenfortschritte und hohe Hürden auf dem Lebensweg“ betitelte die Zeitschrift „Böckler Impuls“ in ihrer letzten Ausgabe einen Bericht über den Stand der Gleichstellung in Deutschland. Die heutige Gleichstellungsdebatte bietet die Möglichkeit, über beides zu sprechen. Alle Vorrednerinnen haben deutlich gemacht, dass in den letzten Jahrzehnten viel passiert ist, dass wir aber mit dem Erreichten noch nicht zufrieden sein können. Auch die Männer haben das in dieser Debatte unterstrichen. Ich erinnere an das, was Kollege Sönke Rix gesagt hat, nämlich dass auch die Männer mit dem Erreichten nicht zufrieden sind.
Ich möchte die jetzige Debatte zum Anlass nehmen, das Bild etwas abzurunden, das heute gezeichnet worden ist, und auf zwei Gruppen von Frauen aufmerksam machen, die den „Riesenfortschritten“ noch etwas hinterher hinken: Das sind auf der einen Seite die älteren Arbeitnehmerinnen und auf der anderen Seite die Migrantinnen. Beide Gruppen haben ihre spezifischen Schwierigkeiten mit unserem Arbeitsmarkt. Sie bedürfen, zum Teil im doppelten Sinne, der Integration.
Ältere Arbeitnehmerinnen - das sind Frauen etwa in meinem Alter, also solche, die kurz nach dem Krieg bzw. noch im Krieg geboren wurden. Ihre Erwerbsquote lag 2004 in den alten Bundesländern bei den 56- bis 59-Jährigen bei 59,6 Prozent, bei den 60- bis 64-Jährigen nur noch bei 21,1 Prozent. Die Quoten bei den Männern liegen in beiden Fällen um etwa 20 Prozent höher. Die Frauen dieser Generation weisen zum großen Teil noch klassische Biografien auf: Schule, kein allzu hoher Bildungsabschluss mit der Begründung: „Die heiratet ja sowieso“, Ausbildung oft in einem typischen Frauenberuf, schlechter Lohn für zum Teil schwere Arbeit, etwa als Verkäuferin oder Friseurin, Heirat und Aufgabe des Berufs wegen der Kinder. Es folgt ein später Wiedereinstieg ins Berufsleben - wenn überhaupt -, oft unterhalb der Qualifikation, in Teilzeit und mit schlechter Bezahlung oder in nicht angemeldeten bzw. prekären Jobs. Weiterbildung - meistens Fehlanzeige. Karriere machen diese Frauen selten. Ich habe Zweifel, ob das mit der Regulierungsdichte bei uns zusammenhängt, sehr verehrte Frau Lenke.
Auf eine Rentenbeitragszeit von 45 Jahren bzw. eine geschlossene Rentenbiografie kann kaum eine dieser Frauen zurückblicken. Die Folge: niedrige eigene Rentenansprüche - fast ein Drittel weniger als die Männer -, wenig gesellschaftliche Anerkennung; denn die Definition gesellschaftlicher Anerkennung erfolgt oft über den Erfolg des Ehemannes. Symptomatisch für das Ganze ist: Es gibt kaum wissenschaftliche Untersuchungen, die sich mit der Lage der Frauen dieser Generation beschäftigen. Dabei ist das Alter eindeutig weiblich.
Anmerkung am Rande: Wen wundert es, wenn unter diesen Bedingungen und aufgrund dieser Eindrücke viele Töchter von Frauen dieser Generation, die viel besser ausgebildet sind als ihre Mütter, erst Karriere machen wollen, bevor sie Kinder kriegen, bzw. Karriere und Kinder als Gegensätze auffassen?
Über die Notwendigkeit der Kinderbetreuung, das Elterngeld und andere familienpolitische Maßnahmen haben wir heute schon ausführlich gesprochen. Ich denke, wir brauchen zusätzlich ein mit Sensibilität durchgeführtes Programm im Rahmen des Beschäftigungspaktes für über 55-Jährige,
das der Situation dieser Frauen gerecht wird. Ferner brauchen wir Forschungsprojekte. Vielleicht kann die deutsche Wirtschaft ja ein solches starten. Es könnte denjenigen die Augen öffnen, die heute noch an den alten Rollenbildern festhalten.
Wissenschaftlich etwas stärker erforscht ist die Situation von Migrantinnen auf unserem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Auch Frau Laurischk ist ja darauf eingegangen. Verständlich ist es schon, dass wir uns damit mehr beschäftigen, weil wir endlich begriffen haben, dass Integration eine der gesellschaftlich notwendigsten Gegenwartsaufgaben überhaupt ist.
Der Newsletter der Arbeitsstelle „Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Integration“, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, stellte im Februar 2006 fest, die Arbeitsmarktintegration der männlichen Zuwanderer sei in Deutschland im internationalen Vergleich relativ gut - übrigens sind die Zahlen trotzdem schlecht -, bei den weiblichen Zuwanderern aus der Türkei sei sie jedoch extrem niedrig und liege, über alle Altersgruppen zwischen 15 und 64 Jahren gemessen, nur bei 35 Prozent. Das sei unter anderem ein Resultat des lange Zeit eingeschränkten Arbeitsmarktzugangs für Ehepartner.
Schauen wir auf die jungen Menschen mit Migrationshintergrund - Herr Singhammer hat das Problem schon angesprochen -: 16 Prozent der türkischstämmigen Mädchen und 23 Prozent der Jungen verlassen die Schule ohne Schulabschluss. Ich denke, das ist eine gesellschaftliche Katastrophe. Gleichzeitig machen nur 11 Prozent der jungen Frauen türkischer Herkunft Abitur; bei den Männern sind es sogar noch weniger. Von allen türkischen Jugendlichen finden nur 29 Prozent der männlichen wie weiblichen Bewerber eine Lehrstelle. Dazu kommt: Auch ein gutes Zeugnis beschert einer jungen Türkin noch lange keinen Ausbildungsplatz. Zu groß sind die Vorbehalte der Arbeitgeber - auch das ist ein weites Feld für die IHK -, ihr Bruder oder Cousin hat trotz eines schlechteren Zeugnisses immer noch bessere Chancen.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss.
Angelika Graf (Rosenheim) (SPD):
Gern. - Die Konsequenz: Auch diese junge Frau wird sich - wie ihre Mutter - nicht in unsere Gesellschaft integrieren.
Das Fazit muss lauten: Ohne Gleichstellung keine Integration und umgekehrt. Wir müssen die Chancen, die die große Koalition bietet, nutzen, um diesen Kreislauf zu durchbrechen.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Damit schließe ich die Aussprache.
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 16/712 und 16/832 sowie 16/833 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. - Damit sind Sie ganz offensichtlich einverstanden. Dann ist die Überweisung so beschlossen.
Ich rufe die Tagesordnungspunkte 19 a bis 19 g sowie die Zusatzpunkte 4 a und 4 b auf:
19. a) Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes
- Drucksache 16/735 -
Überweisungsvorschlag:
Rechtsausschuss (f)
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
b) Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu dem Internationalen Übereinkommen von 2001 über die zivilrechtliche Haftung für Bunkerölverschmutzungsschäden
- Drucksache 16/736 -
Überweisungsvorschlag:
Rechtsausschuss (f)
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
c) Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Ölschadengesetzes und anderer schifffahrtsrechtlicher Vorschriften
- Drucksache 16/737 -
Überweisungsvorschlag:
Rechtsausschuss (f)
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
d) Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu dem Übereinkommen über das Recht der nichtschifffahrtlichen Nutzung internationaler Wasserläufe
- Drucksache 16/738 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(f)
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
e) Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 17. Juni 1999 über Wasser und Gesundheit zu dem Übereinkommen von 1992 zum Schutz und zur Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe und internationaler Seen
- Drucksache 16/739 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(f)
Innenausschuss
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
f) Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften des Sozialen Entschädigungsrechts und des Gesetzes über einen Ausgleich von Dienstbeschädigungen im Beitrittsgebiet
- Drucksache 16/754 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f)
Innenausschuss
Rechtsausschuss
Finanzausschuss
Verteidigungsausschuss
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Gesundheit
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Haushaltsausschuss
g) Beratung des Berichts des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (17. Ausschuss) gemäß § 56 a der Geschäftsordnung
Technikfolgenabschätzung
Vierter Sachstandsbericht zum Monitoring "Technikakzeptanz und Kontroversen über Technik"
Partizipative Verfahren der Technikfolgenabschätzung und parlamentarische Politikberatung
- Drucksache 15/5652 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung (f)
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
ZP 4 a) Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Wachstum und Beschäftigung
- Drucksache 16/753 -
Überweisungsvorschlag:
Finanzausschuss (f)
Rechtsausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Gesundheit
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96
GO
b) Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Betriebsprämiendurchführungsgesetzes
- Drucksache 16/858 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (f)
Finanzausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Es handelt sich um Überweisungen im vereinfachten Verfahren ohne Debatte.
Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Vorlagen an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse zu überweisen. Sind Sie damit einverstanden? - Das ist der Fall. Dann sind die Überweisungen so beschlossen.
Ich rufe die Tagesordnungspunkte 20 a bis 20 i auf. Es handelt sich um die Beschlussfassung zu Vorlagen, zu denen keine Aussprache vorgesehen ist.
Tagesordnungspunkt 20 a:
Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Siebenten Gesetzes zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes
- Drucksache 16/635 -
aa) Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses (7. Ausschuss)
- Drucksache 16/835 -
Berichterstattung:
Abgeordnete Antje Tillmann
bb) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) gemäß § 96 der Geschäftsordnung
- Drucksache 16/852 -
Berichterstattung:
Abgeordnete Jochen-Konrad Fromme
Carsten Schneider (Erfurt)
Otto Fricke
Dr. Gesine Lötzsch
Anja Hajduk
Der Finanzausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 16/835, den Gesetzentwurf anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. - Wer stimmt dagegen? - Enthaltungen? - Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung mit den Stimmen des ganzen Hauses angenommen.
Wir kommen zur
dritten Beratung
und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist der Gesetzentwurf in dritter Beratung einstimmig angenommen.
Tagesordnungspunkt 20 b:
Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU/CSU, der SPD, der FDP, der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN
Erneute Überweisung von Vorlagen aus früheren Wahlperioden
- Drucksache 16/820 -
Wer stimmt für diesen Antrag? - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist dieser Antrag mit den Stimmen des ganzen Hauses angenommen.
Wir kommen nun zu den Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses, zunächst zu Tagesordnungspunkt 20 c:
Beratung der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 14 zu Petitionen
- Drucksache 16/662 -
Wer stimmt dafür? - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Die Sammelübersicht 14 ist einstimmig angenommen.
Tagesordnungspunkt 20 d:
Beratung der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 15 zu Petitionen
- Drucksache 16/663 -
Wer stimmt dafür? - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Auch diese Sammelübersicht ist einstimmig angenommen.
Tagesordnungspunkt 20 e:
Beratung der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 16 zu Petitionen
- Drucksache 16/664 -
Wer stimmt dafür? - Wer stimmt dagegen? - Enthaltungen? - Damit ist die Sammelübersicht 16 mit den Stimmen der Koalition, von Bündnis 90/Die Grünen und FDP bei Gegenstimmen der Linksfraktion angenommen.
Tagesordnungspunkt 20 f:
Beratung der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 17 zu Petitionen
- Drucksache 16/665 -
Wer stimmt dafür? - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Diese Sammelübersicht ist mit den Stimmen der Koalition gegen die Stimmen der Opposition angenommen.
Tagesordnungspunkt 20 g:
Beratung der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 18 zu Petitionen
- Drucksache 16/666 -
Wer stimmt dafür? - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Diese Sammelübersicht ist mit den Stimmen der großen Koalition und der FDP gegen die Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen und Linksfraktion angenommen.
Tagesordnungspunkt 20 Beratung der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 19 zu Petitionen
- Drucksache 16/667 -
Wer stimmt dafür? - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Diese Sammelübersicht ist angenommen mit den Stimmen der Koalition und der Linksfraktion gegen die Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen und der FDP.
Tagesordnungspunkt 20 i:
Beratung der Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 20 zu Petitionen
- Drucksache 16/668 -
Wer stimmt dafür? - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Die Sammelübersicht 20 ist angenommen mit den Stimmen der Koalition bei Gegenstimmen von Grünen und Linksfraktion und Enthaltung der FDP.
Ich rufe den Zusatzpunkt 5 auf:
Aktuelle Stunde
auf Verlangen der Fraktion der LINKEN
Die Zukunft der Rente
Ich eröffne die Aussprache und gebe das Wort dem Kollegen Dr. Gregor Gysi.
[Der folgende Berichtsteil - und damit der gesamte Stenografische Bericht der 22. Sitzung - wird morgen,
Freitag, den 10. März 2006,
an dieser Stelle veröffentlicht.]