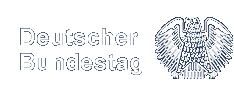DEUTSCHER BUNDESTAG Protokoll-Nr. 14/93
Ausschuss für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft
14. Wahlperiode
22 38- 24 50
Wortprotokoll
der
93. Sitzung
des Ausschusses für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft
(10. Ausschuss)
am Montag, 29. April 2002, 11.00 Uhr
(Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.700)
Öffentliche Anhörung
zum Thema
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Verbraucherinformationsgesetzes
(VerbIG)
Vorsitz: Peter Harry Carstensen (Nordstrand), MdB
SEITE
Einziger Punkt der Tagesordnung
8 - 114
Öffentliche Anhörung zum Thema
Entwurf eines Verbraucherinformationsgesetzes
(VerbIG)
- Drucksache 14/8738 -
dazu: Stellungnahmen der
Sachverständigen
14/678 Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde
e.V.
14/684 Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände
14/687 Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.
V.
14/688 Markenverband
14/700 Peter Knitsch, Ministerium f. Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft
und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
14/701 Dr: Karin Klaffke - Institut f. Markt-Umwelt-Gesellschaft
e.V. an der
Universität Hannover
14/705 PD Dr. Josef Falke, Zentr. f. Europ.Rechtspolitik an der
Universität Bremen
Der Vorsitzende: Meine Damen und Herren, ich
eröffne die 93. Sitzung des Ausschusses für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft zur
öffentlichen Anhörung zu dem Entwurf der Bundesregierung
für ein Verbraucherinformationsgesetz (VerbIG).
Ich darf Sie jedoch zunächst bitten, sich aus gegebenem Anlass
von Ihren Plätzen zu erheben. Mit Entsetzen und
Fassungslosigkeit haben wir am Freitag von dem Amoklauf in Erfurt
Kenntnis genommen. Wir trauern und denken an die Hinterbliebenen,
an die Opfer, an die Bürgerinnen und Bürger in Erfurt.
Wir denken auch an manche Unzulänglichkeiten unserer eigenen
Entscheidungen. Ich darf Sie nun bitten, den Opfern ein stilles
Gebet zu widmen. Ich danke Ihnen.
Ich begrüße die Mitglieder unseres Ausschusses und vom
BMVEL Frau Dr. Wollersheim, die PSt Dr. Thalheim vertritt, der sich
verspäten wird, aber sein Kommen zugesagt hat. Ich
begrüße weitere interessierte Gäste zu dieser
öffentlichen Anhörung und insbesondere die Damen und
Herren Sachverständige in unserer Mitte. Herzlich willkommen
und ein herzliches Dankeschön, dass Sie es wahr machen
konnten, der kurzfristigen Einladung zu folgen. Dieses
Gesetzesvorhaben der Bundesregierung hat schon zu vielerlei
Reaktionen und Diskussionen unter den Beteiligten, aber auch in der
Öffentlichkeit geführt. Uns, den Mitgliedern des
Ausschusses, dient diese Anhörung zur Vorbereitung auf die
bevorstehende Beratung im Ausschuss, um sich ein genaueres Bild
über Nutzen, Schwachstellen und Auswirkungen des
Gesetzentwurfes machen zu können. Dies interessiert
natürlich auch alle direkt und indirekt Beteiligten, von denen
nur eine begrenzte Zahl als Sachverständige geladen werden
konnten, insbesondere interessiert dies aber die große Zahl
der Verbraucherinnen und Verbraucher, weshalb wir die Anhörung
öffentlich durchführen. Von den Sachverständigen
sind zum Teil vorab Antworten auf den Fragenkatalog eingegangen,
die als Ausschuss-Drucksachen ausliegen, wofür ich angesichts
der kurzfristigen Terminierung sehr danken möchte. Diese sind
den Abgeordneten per E-Mail übermittelt worden und liegen hier
im Sitzungssaal aus. Außerdem liegen Stellungnahmen von
Verbänden zum Gesetzesvorhaben aus, die unabhängig von
der Anhörung im Ausschuss-Sekretariat eingegangen waren.
Hinsichtlich des zeitlichen Rahmens rechne ich mit einer Dauer von
ca. drei Stunden. Ich möchte nunmehr die Sachverständigen
bitten, mit einem kurzen Statement zu beginnen, um im Anschluss
daran in die Fragen- und Antwortrunden einzutreten.
Burghard von Hausen, Bundesvereinigung der kommunalen
Spitzenverbände: Sehr geehrte Damen und Herren, ich
bedanke mich zunächst, dass wir heute zu dem Gesetzentwurf
Stellung nehmen dürfen. Unsere schriftliche Stellungnahme ist
Ihnen zugegangen, bevor wir den Fragebogen am letzten Mittwoch
erhalten haben. Eine Beantwortung dieser Fragen war uns daher nicht
mehr möglich. Wir werden diese nachreichen, soweit dies
gewünscht wird. Grundsätzlich kann man den dem
Gesetzentwurf zugrunde liegenden Gedanken, den Verbraucher besser
zu informieren, gutheißen. Eine möglichst weitgehende
Information der Verbraucher über die von Ihnen gekauften
Produkte fördert nicht nur den Schutz der Verbraucher, sondern
würde auch die Erzeuger von Produkten zwingen, die
größtmögliche Sorgfalt bei der Entwicklung und
Produktion und im Vertrieb walten zu lassen. Die Frage, ob dieser
Gesetzentwurf dazu angetan ist, diese Voraussetzung zu
erfüllen, mag ich nicht uneingeschränkt befürworten.
Leider haben die Entwurfsverfasser darauf verzichtet, rechtzeitig
den Rat von Praktikern vor Ort einzuholen. Das wird auch aus der
Frage fünf der FDP-Fraktion deutlich. Wir sind von der
Bundesministerin darüber informiert worden, dass der
Gesetzentwurf derart unter Zeitdruck stand, dass es nicht
möglich war, uns rechtzeitig zu beteiligen, obwohl andere
Verbände, die weitaus weniger betroffen waren, durchaus
beteiligt worden sind. Wir hätten den Vertreter des
Ministeriums eingeladen, sich einmal in einer Kommune ein
Lebensmittelamt anzuschauen und zu sehen, wie die
Lebensmittelüberwachung vor Ort funktioniert. Wir hätten
dann sicherlich die eine oder andere Formulierung im Gesetz anders
vorgefunden, als sie heute zu finden ist.
Lassen Sie mich deshalb schon in diesem Zusammenhang auf zwei
Fragen eingehen, die im Fragenkatalog sind. Es geht um die Fragen
fünf und sechs im Katalog der SPD-Fraktion. Da heißt es
z. B., ob wir eine Notwendigkeit sehen, dass Behörden erstmals
öffentlich auch von sich aus über bestimmte Vorkommnisse
warnen können. Bei Gefahr im Verzuge, insbesondere bei
Gesundheitsgefahren, müssen wir das sogar schon heute.
Insofern ist hier eine Erweiterung nur teilweise vorgegeben. Das
Problem besteht nur darin, dass die Behörde ein wesentliches
Risiko eingeht, wenn sie sich zum Handeln entschließt. Sie
ist ständig der Gefahr ausgesetzt, dass erhebliche
Schadensersatzforderungen auf sie zukommen. Ich erinnere hier an
den Birkel-Fall, den Sie alle kennen. Sie müssen darüber
hinaus wissen, dass die Lebensmittelbehörden immer nur
Stichprobenkontrollen vornehmen und dass sich bei Beanstandungen
sehr oft hinterher herausstellt, dass die internen
Überprüfungen der Produzenten zeigen, dass es sich hier
um einmalige Ausrutscher handelte, von daher die Maßnahmen
vor Gericht keinen Bestand haben und entsprechende
Schadensersatzforderungen vorliegen. Die Auffassung, dass bei uns
eine Fülle von Daten vorliegt, die kostengünstig ins
Internet gestellt werden können, entspricht einfach nicht den
Tatsachen.
Auch die nächste Frage zeigt, dass jedenfalls in diesem
Gesetzentwurf eigentlich nichts Neues geschaffen wird, wenn die
Behörde Hersteller und Produktbezeichnung benennen darf. Das
tun und müssen die Lebensmittelämter
selbstverständlich bei Gefahr im Verzuge.
Zugegebenermaßen sind im jetzigen Regierungsentwurf
gegenüber dem Referentenentwurf einige Verbesserungen
festzustellen.
Dennoch bleibt für uns die Frage im Raum, was mit diesem
Gesetzentwurf bezweckt wird. In der Begründung zum
Referentenentwurf wurde darauf hingewiesen, dass eine verbesserte
Unterrichtung der Bevölkerung durch die hierfür an sich
zuständigen Verbraucherschutzorganisationen schon deshalb
nicht in Frage komme, weil man dafür das Geld nicht hat.
Seinerzeit war auch noch eine Verpflichtung zur
Veröffentlichung im Internet vorgesehen. Jetzt ist es eine
Kannbestimmung, in der Begründung heißt es allerdings
wieder ?soll?. Was ?soll? im Gesetz heißt, wissen Sie. Auch
bei dieser Aussage wird deutlich, dass die Verfasser des Entwurfes
noch keinen sehr genauen Blick in ein Lebensmittelamt geworfen
haben können. Wenn man, wie im Entwurf beabsichtigt, bei den
Behörden vorhandene Informationen in allgemein
verständlicher Sprache ins Internet stellen wollte, so
wäre dafür ganz erhebliche Personalaufstockung bei
unseren Ämtern notwendig.
Ich darf z. B. den Kreis Gütersloh nennen, der über 100
EG-zugelassene Betriebe beherbergt, die Lebensmittelprodukte
für die gesamte EU herstellen und vertreiben. Wenn Sie sich
einmal überlegen wollen, was das für den Kreis
Gütersloh bedeuten würde, dann würden Sie die in der
Begründung zur Kostenfolge gemachten Ausführungen so
jedenfalls nicht befürworten können. Dazu kommt, dass die
Daten, die vorhanden sind, so überhaupt nichts aussagen. Wir
haben von einem anderen Kreis mitgeteilt bekommen, dass er alleine
über 130.000 DM pro Jahr Mehrkosten für Personal
einsetzen muss, und dies ist ein Kreis, in dem normalerweise so
viel nicht stattfindet. In Gütersloh z. B. würde sich das
entsprechend höher auswirken.
Lassen Sie mich in dieser Einleitungsrunde auch noch auf einen
anderen Umstand hinweisen. In einigen Ländern gibt es bereits
Auskunfts- und Informationsgesetze. Diese spielen nach unserer
Recherche in der Praxis bisher noch keine große Rolle. Wenn
jetzt auf Bundesebene dennoch die Notwendigkeit gesehen wird,
für den Verbraucherschutz eine besondere bundeseinheitliche
Regelung zu schaffen, und damit, wie es in der Begründung
heißt, die in Deutschland seit eh und je geltenden
Grundsätze des Aktengeheimnisses und der Vertraulichkeit der
Verwaltung jetzt umgekehrt werden sollen, dann ist es für uns
eigentlich nicht verständlich, dass ein solcher Systemwechsel
in einem beschleunigten Verfahren durchgezogen werden muss. Auf der
einen Seite beklagt man schlechte Gesetzgebung, es werden
Kommissionen eingesetzt, der Juristentag überlegt sich, wie
man Gesetzgebung verbessern könne und dann kommt immer wieder
so etwas dabei heraus. Dies ist wirklich nicht
verständlich.
Im Gegensatz zum Referentenentwurf wird jetzt in § 7 des
Gesetzentwurfes festgestellt, dass kostendeckende Gebühren
erhoben werden. Sie können mit Sicherheit davon ausgehen, dass
die Gebühren so hoch sein müssen, dass der einzelne
Bürger von der Anfrage Abstand nimmt. Wenn aber heute z. B.
Verbände oder die Medien an die Lebensmittelämter Fragen
stellen, dann kann es sich heute kein Lebensmittelamt leisten,
diese Fragen nicht zufriedenstellend zu beantworten. Sie
können sich auch vorstellen, dass Anfragen von
Rundfunkanstalten oder anderen Medien wohl kaum mit einem
Gebührenbescheid zu beantworten sein werden. Die Kommunen
werden also hier auf erheblichen Kosten sitzen bleiben, wobei ich
nochmals darauf hinweise, dass schon heute diese Unterrichtung der
Medien funktioniert. Wir würden deshalb nochmals ganz herzlich
darum bitten, von einem beschleunigten Verfahren zu diesem Gesetz
Abstand zu nehmen und noch einmal gemeinsam mit uns zu prüfen,
wie die Praxis mit einem solchen Gesetz arbeiten kann.
Prof. Dr. Matthias Horst, Bund für Lebensmittelrecht
und Lebensmittelkunde e. V.: Vielen Dank Herr
Vorsitzender, meine Damen und Herren, dieses Vorhaben ist für
die Lebensmittelwirtschaft, und darauf konzentriert sich auch der
Gesetzesansatz, von allergrößter Bedeutung, insbesondere
deshalb, weil öffentliche Äußerungen der
Behörden in negativer Hinsicht eine ganz spezifische Wirkung
auf den Lebensmittelsektor haben, denn sie sind in den meisten
Fällen als Warnung zu verstehen. Wir haben eine Reihe von
Beispielen aus der Vergangenheit, in denen diese öffentlichen
Äußerungen zu gravierenden Folgen geführt haben.
Der Birkel-Fall ist bereits erwähnt worden, ich darf
hinzufügen, der damalige Umsatzeinbruch wurde mit 43 Mio. DM
beziffert. Das Unternehmen konnte, wie Sie alle wissen, so nicht
weitergeführt werden. Grundsätzlich ist die
Lebensmittelwirtschaft der Auffassung, dass die
Verbraucherinformation und die Wege und Mittel dazu deutlich
verbessert werden müssen. Dies erfordert insbesondere eine
Änderung des komplizierten und weitgehend
unverständlichen Kennzeichnungsrechtes in Europa. Wir
hätten uns gewünscht, dass man darauf den Schwerpunkt
legt, aber man hat nun einen anderen Weg eingeschlagen. Wir als
Lebensmittelwirtschaft empfehlen unseren Mitgliedern
nachdrücklich, das eigene Informationsangebot ständig zu
verbessern und auszufeilen, und ich glaube, dass dort auch schon
einige Verbesserungen erzielt worden sind.
In dem Gesetzentwurf vermissen wir eine angemessene
Güterabwägung zwischen dem Informationsinteresse der
Verbraucher einerseits und den schutzwürdigen Belangen der
Unternehmen andererseits. Wir sehen nach wie vor, dass dieses
Gesetz dem Missbrauch durch Mitbewerber Tür und Tor
öffnet. Ebenso den Missbrauch durch die Presse, aber auch den
Missbrauch durch die Politik. Wir befürchten, dass mit diesem
Gesetz die Möglichkeit einer öffentlichen Vorverurteilung
eröffnet wird, statt dem Verbraucher alles an die Hand zu
geben, damit er eine eigenverantwortliche Kaufentscheidung treffen
kann. Dieses Gesetz muss dringend insoweit überarbeitet
werden, als weitere Sicherungen im Interesse der berechtigten
Belange der Unternehmen eingebaut werden müssen.
Zunächst einmal ist für uns absolut unverständlich,
dass es nicht ausnahmslos die Regel sein muss, dass Daten
aufbereitet werden. Der Verbraucher hat keinen Vorteil, wenn er mit
irgendwelchen Rückstandszahlen konfrontiert wird. Es muss ihm
vielmehr auch gesagt werden, welche Bedeutung eine solche Zahl hat.
Wenn eine solche Aufbereitung aber nicht möglich ist, weil,
wie bereits gesagt wurde, der Aufwand hierfür zu hoch ist,
dann hat eben der Verbraucher keinen Anspruch auf eine solche
Information. Im niedersächsischen Entwurf war ein solcher
Anspruch tatsächlich ausgeschlossen. Die Modalitäten der
zur Verfügungstellung von Daten durch die Behörden
müssen deshalb wirklich noch überarbeitet werden. Hierzu
gehört beispielsweise auch die Festlegung, wie lange solche
Daten im Internet stehen sollen.
Des Weiteren ist es unbedingt erforderlich, dass auch ein laufendes
Verwaltungsverfahren den Informationsanspruch ausschließt.
Beanstandungen, die in einem laufenden Verwaltungsverfahren
ausgesprochen werden, sind oft nicht mehr als
Meinungsäußerungen einer Behörde und die
überwiegende Anzahl der Beanstandungen führt zu
überhaupt nichts, jedenfalls keineswegs zu einer Verurteilung
eines Unternehmens. Es ist also dringend erforderlich,
zunächst den Abschluss eines Verwaltungsverfahrens abzuwarten.
So sieht es im Übrigen auch die amtliche Begründung vor.
Nur im Gesetzestext ist das leider nicht zu finden. Ferner muss
jedes Unternehmen vor der Offenbarung seiner Daten angehört
werden, und es muss ein Recht auf Gegendarstellung verankert
werden.
Was das Informationsverhalten der Behörden selbst, also die
öffentlichen Äußerungen und Mitteilungen betrifft,
so muss aus unserer Sicht der Grundsatz der Subsidiarität
verankert werden, d. h., wenn ein Unternehmen selbst informieren
will, dazu bereit und in der Lage ist, dann steht die
Informationsmöglichkeit der Behörden zurück. Auch
muss eine Korrektur der behördlichen Verlautbarung auf
Verlangen der Unternehmen vorgesehen werden.
Lassen Sie mich jetzt zu einem Punkt kommen, der im Gesetzentwurf
der Bundesregierung nicht steht, der aber offensichtlich vom
Bundesrat beschlossen worden ist, nämlich ein weitgehender
Haftungsausschluss für Behörden. Behörden sollen
nicht einmal verpflichtet sein, die inhaltliche Richtigkeit der
Daten zu überprüfen und sie haften nur bei Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit. Das würde bedeuteten, dass das
ganze Risiko dieser neuen Informationskultur beim Unternehmen
liegen würde. Das ist, abgesehen davon, dass es
verfassungsrechtlich gar nicht haltbar ist, wirklich politisch der
absolut verfehlte Weg. Das hieße, Behördenschlamperei
wie im Fall Birkel würde sanktioniert. Das kann es wohl im
Ernst nicht sein. Wenn Informationen aus dem Bereich der
Behörden gegeben werden, dann nur nach bestem Wissen und
Gewissen.
Im Übrigen kann aus unserer Sicht nur eine europäische
Regelung und nicht ein nationaler Alleingang in Frage kommen, denn
dadurch würden unsere Unternehmen insoweit diskriminiert, als
über sie sehr viel mehr Informationen angeboten würden,
als über Unternehmen aus dem Ausland. All diese Punkte zeigen
auf, dass dieses Gesetzgebungsvorhaben wirklich noch einer
äußerst sorgfältigen Prüfung bedarf.
Information darf nicht um des Informierens willen zur
Verfügung gestellt werden. Hierzu gibt es eine Vielzahl von
Negativ-Beispielen. Das letzte hat uns in der vergangenen Woche
erreicht, nämlich die Berichte über Acrylamidfunde in
Grundnahrungsmitteln in Schweden. Nichts ist gesichert, die Werte
sind ins Internet gestellt worden, eine weltweite Verunsicherung,
die weder dem Verbraucher noch dem Gesetzgeber nützt, ist
eingetreten und die Schweden sagen selbst, es müsse alles noch
wissenschaftlich abgesichert werden. Solche Informationspolitik
hat, wenn Sie den Mehrwert für den Verbraucherschutz
betrachten, absolut keinen Sinn. Vielen Dank.
Dietrich Klein, Deutscher Bauernverband: Vielen
Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie
haben den Fragenkatalog angesprochen, der uns zugesandt worden ist.
In meinem Statement möchte ich auf einige Kernpunkte eingehen,
die sich wie ein roter Faden durch die Fragen aller Fraktionen
ziehen. Das ist die Frage, brauchen wir eine umfassende
kohärentere Verbraucherinformationspolitik. Dazu sagen wir
ganz klar: Ja!
Wir bedauern allerdings, dass die Bundesregierung diesem Anspruch
mit diesem Gesetzentwurf nicht gerecht wird. Deshalb lehnen wir
diesen Entwurf in der vorliegenden Form auch ab, denn in dem
Gesetzentwurf wird zu Lasten einer umfassenden
Verbraucherinformation einem ordnungsbehördlichen
Auskunftsverfahren der Vorzug gegeben und darunter verstehen wir
nicht eine umfassende Verbraucherinformation. Wir lehnen diesen
beschränkten Ansatz als verfehlt ab und fordern, mehr aktive
Verbraucherinformationspolitik von Staat und Wirtschaft. Wir
fordern dies jedoch nicht nur, sondern wir machen auch unsere
Schulaufgaben. Wir haben mit allen Partnern in der
Lebensmittelkette das Qualitäts- und Sicherheitssystem
aufgebaut und der Erfolg dieses Systems, die starke, positive
Resonanz, beweist uns, dass wir mit diesem System, das ja letztlich
darauf abzielt, dass der Verbraucher am Point of Sale, also im
Laden, Informationen erfragen und bekommen kann.
Entscheidend ist, dass der Entwurf, was die Ordnungsbehörden
angeht, aus unserer Sicht nur insoweit ein diskussionsfähiger
Ansatz ist, als es um die Kommunikation konkreter gesundheitlicher
Gefährdungen bei Lebensmitteln geht, also um öffentliche
Warnungen. Hier sind klare und tragfähige Regelungen
erforderlich, damit hier die Ordnungsbehörden, wenn es
notwendig ist, eingreifen können, allerdings unter
Berücksichtigung der von den Unternehmen freiwillig gegebenen
bzw. vom Markt erzwungenen Informationen. Ich glaube aber, in der
Vergangenheit haben wir gesehen, und dies wird aller Voraussicht
nach auch in der Zukunft so sein, dass es sich um
Ausnahmefälle handelt, die allerdings abgedeckt werden
müssen.
Insofern sehen wir hier einen diskussionsfähigen Ansatz.
Ich möchte allerdings hier auch in aller Deutlichkeit sagen,
dass durch die Vorschläge des Bundesrates zur
Haftungsfreistellung der Behörden, nach der diese nicht
verpflichtet sein sollen, richtig zu recherchieren und für
ihre Auskünfte nicht haften, eine Situation entstanden ist,
die so nicht bleiben kann. Das ist keine Basis für ein
Informationssystem, das sich das Vertrauen der Verbraucher erst
erwerben muss. Nach unserer Auffassung müssen Behörden,
genauso wie Unternehmen, für eventuelle Pflichtverletzungen
einstehen.
Zum Thema Zielgruppeninformation, nach der bestimmte Zielgruppen
und auch einzelne Verbraucher die Möglichkeit haben
müssen, sich zu informieren, halten wir es für
unabdingbar, dass diese Informationen auch wissenschaftlich und
fachlich abgesichert werden müssen. Wir können es uns
nicht erlauben, die Verbraucher "aus der Hüfte
schießend" zu informieren. Das wäre keine seriöse
Verbraucherinformation und deswegen sagen wir, es ist aus unserer
Sicht unverzichtbar, vorhandenen Informationsmedien und auch
Quellen, wie z.B. die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung, oder auch eine allgemeine Information aus dem
Deutschen Lebensmittelbuch, in wesentlich stärkerem Maße
zu fördern, um die Informationen für die Verbraucher zu
verbessern. Wir sind auch der Auffassung, dass die individuelle
Verbraucherberatung vor Ort stärker gefördert werden
sollte. Wir bieten hierzu unsere Mitarbeit an.
Alle Maßnahmen zur Verbraucherinformation, die ergriffen
werden, müssen effizient sein. Sie müssen beim
Verbraucher ankommen und ihn erreichen. Hier habe ich aber, ehrlich
gesagt, alle größte Zweifel, ob der von der
Bundesregierung gewählte Ansatz tragfähig ist und wenn
ich mir diesen genau ansehe, dann scheint die Bundesregierung
selber auch daran Zweifel zu haben, nämlich bei den
Vollzugskosten. Hier sagt die Bundesregierung selber, dass aufgrund
der niedrigen Inanspruchnahme der bestehenden Regelungen in
Nordrhein-Westfalen und Berlin nicht davon auszugehen ist, dass
erhebliche Vollzugskosten entstehen werden. Vielen Dank!
Christopher Scholz, Markenverband e. V.: Sehr
geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren,
der Markenverband vertritt die Interessen der Markenartikel
herstellenden Industrie.
Der Markenverband fühlt sich von dem
Verbraucherinformationsgesetz, wie es die Bundesregierung plant, in
besonderem Maße betroffen, denn die Marke ist ein besonders
sensibles, hohes Gut, und wenn es um Information geht, ist der
Markenartikler auf das Vertrauen des Verbrauchers in seine Produkte
eben auch in besonderem Maße angewiesen. Deswegen ist der
Markenverband trotz der Verbesserungen gegenüber dem jetzt
vorliegenden Entwurf weiter sehr kritisch, denn durch das
Verbraucherinformationsgesetz des BMVEL wird u. E. die Kultur des
Misstrauens festgeschrieben, die u. a. auch in dem
niedersächsischen Entwurf ausdrücklich kritisiert worden
ist, ohne dass hierdurch wirklich eine bessere Information für
Verbraucher und das Ziel einer selbst bestimmten
Verbraucherentscheidung verwirklicht werden. Dabei entstehen
erhebliche Gefährdungen insbesondere für
Markenartikel-Hersteller, die von ihrem Namen und dem Vertrauen des
Verbrauchers leben. Wir fordern zu dem Gesetzentwurf eine
Beschränkung auf Gesundheit und Sicherheit, und wir halten es
nicht für sachgerecht, die wirtschaftlichen Interessen des
Verbrauchers mit zu berücksichtigen.
Insbesondere ist es nicht Aufgabe der Politik, Kaufempfehlungen,
die auch in den ethischen Bereich hineingehen, zu geben. Aktive
Verbraucherinformation, auch durch Verbraucherverbände,
trägt ihren Teil dazu bei, dass auch ethische Elemente
für die Kaufentscheidung für Bedeutung sind.
Markenartikler und andere Hersteller werden dem Rechnung tragen,
das regelt der Markt.
Auch für das angesprochene Feld der Datenaufbereitung sehen
wir das zwingende Erfordernis, dass Behörden als
Normadressaten auch die Verantwortung für die von Ihnen
veröffentlichten Daten übernehmen. Wenn eine solche
Aufbereitung unterbleibt, besteht schon aus dem Gesetzeszweck keine
Notwendigkeit mehr für eine Veröffentlichung, weil das
Ziel der Verbraucherinformation bei unaufbereiteten Daten nicht
verwirklicht wird und auch das Gefährdungspotenzial für
die betroffenen Hersteller erheblich steigt.
Wir sehen daran anschließend bei einer aktiven
Veröffentlichtung, wie sie im Gesetzentwurf vorgesehen ist,
das Bedürfnis nach einer Abwendungsbefugnis, also den Vorrang
des Herstellers für eine Information der Öffentlichkeit,
denn es ist auch hier verschiedentlich richtig gesagt worden, dass
Informationen durch Behörden öffentlich als Warnung
wahrgenommen werden, weswegen der Frage eine besondere Bedeutung
zukommt, wer warnt.
Die bereits angesprochene Revokationspflicht bei irrtümlicher
oder falscher Information würden wir als Revokationsanspruch
ausgestaltet sehen wollen, weil gerade für Markenartikler
gilt, ?no news is good news?, wenn es sich um negative Schlagzeilen
handelt. Auch wenn diese unberechtigt waren, sollte es den
betroffenen Unternehmen überlassen bleiben, ob man das Thema
ruhen lassen möchte, weil man sich über eine neuerliche
Negativ-Berichterstattung mehr Schaden als Nutzen verspricht.
Generell wünschen wir uns, dass nur im Falle von
Erheblichkeit, auch bei den sonst verbliebenen Tatbeständen
informiert werden sollte und ferner möchte ich zur Frage acht
im Fragenkatalog der SPD-Fraktion Stellung nehmen, die auch im
Themenkomplex, den der Bundesrat behandelt hat, anklingt. Hier
halten wir einen Schadensersatzanspruch der öffentlich Hand
bei unberechtigten Warnhinweisen für unbedingt erforderlich,
obwohl in der Regel insbesondere für Markenartikelhersteller
der Schaden nur schwer bezifferbar und häufig nicht wieder
gutzumachen ist. Wir können uns nur der Stellungnahme des
Bundesrates anschließen, in der es heißt, für die
bestehenden Unsicherheiten kann nicht der Staat haftbar gemacht
werden, weil das Risiko so groß ist, dass man in diesen
Fällen besser von einer Information absehen muss. Das Risiko
kann aber auch nicht beim Unternehmen bleiben, denn dieses kann den
Schaden noch viel weniger tragen.
Noch ein Wort zur Aktion ?Nachgefragt? des VZBV. Auch wir sind der
Überzeugung, dass Informationen an Verbraucher wichtig sind,
auch durch Unternehmen, die sachgerecht erfolgen müssen.
Auch Behörden könnten in die Fallen tappen, in die
vielleicht auch schlecht geschultes Personal bei dem einen oder
anderen Unternehmen getappt ist. Der Markenverband als Vertretung
der Markenartikelindustrie bemüht sich seit längerem
darum, auch in den aktiven Dialog zu treten, wie hier
Verbesserungen herbeigeführt werden können.
Klaus Schmitz, Zentralverband des Deutschen
Handwerks: Wir schließen uns im Grundsatz dem an was
schon bisher gesagt worden ist. Ich will nur nochmal einige Punkte
herausgreifen und betonen. Es ist durch die bisher gehörten
Beiträge klar geworden, dass die Verbandsseite nicht in eine
Blockadehaltung verfällt, sondern wir den Verbraucherschutz
und die Verbraucherinformationen durchaus sehr ernst nehmen. Ich
kann betonen, was auch vom Bauernverband schon gesagt worden ist,
wir sind bestrebt, unsere Hausaufgaben zu machen. Das findet aber
in der direkten Kommunikation mit dem Verbraucher statt und da
gehört es auch hin. Deswegen finden wir die hier angesprochene
Idee der Subsidiarität unterstützenswert.
Man sollte zunächst abwarten, was die Parteien untereinander
regeln können und erst danach soll der Verbraucher, wenn
überhaupt, zur Behörde gehen können. Wenn dies aber
der Fall ist, sind die Behörden es dem besonderen
Vertrauenstatbestand schuldig, der auch im Verwaltungsverfahren
zwischen den Unternehmen und den Behörden vorhanden ist, dass
hier sorgfältig recherchiert wird und erst dann die
Öffentlichkeit bei Gefahr im Verzug informiert wird.
Dafür ist es aber nach wie vor notwendig, dass ein
Haftungstatbestand besteht. Eine vorschnelle Verunsicherung der
Öffentlichkeit und in der Folge große wirtschaftliche
Schäden bei den Unternehmen müssen vermieden werden,
zumal, wenn sich am Ende alles als gegenstandslos herausstellt. Den
Behörden hier einen Freibrief zu geben, wäre das falsche
Signal.
Prof. Dr. Josef Falke, Zentrum für Europäische
Rechtspolitik an der Universität Bremen: Das
Verbraucherinformationsgesetz erfüllt in der vorliegenden
Fassung nicht den Anspruch, den es an sich selbst stellt. Danach
sollen die Verbraucher nicht nur passiv konsumieren und am
Marktgeschehen teilnehmen, sondern aktiv gestaltend als
mündige Verbraucher handeln. Dabei nehmen sie nicht nur zur
Wahrung ihrer Rechtsinteressen und Vermögenspositionen,
sondern auch für allgemein anerkannte Schutzgüter
Initiativen. Ein derart ausgerichtetes
Verbraucherinformationsgesetz bezweckt, die Verantwortung der
Verbraucher als politische und Wirtschaftsbürger zu
erschließen. Im Sinne einer kohärenten
Verbraucherpolitik darf ein Verbraucherinformationsgesetz nicht als
bloße Reaktion auf Lebensmittelskandale verstanden werden,
sondern muss über den Bereich der Lebensmittel und
Bedarfsgegenstände hinaus auch auf andere für den
Verbraucher angebotene Produkte und Dienstleistungen erstreckt
werden. Außerdem sollte das Verbraucherinformationsgesetz
nicht allein einen behördlichen Ansatz verfolgen, sondern die
Information bei den Adressaten abrufen, bei denen sie in
orginärer Form vorhanden sind. Die Unternehmen, die Produkte
und Dienstleistungen anbieten, wissen über die
Produkteigenschaften und die Ausrichtung ihrer Dienstleistungen,
Vorvertriebsstufen und dergleichen sehr viel genauer Bescheid und
können auch über die eingerichteten
Qualitätssicherungssysteme genauer und spezifischer Auskunft
geben, als den Behörden dies möglich ist. Vielfach
reichen die vorhandenen Informationsquellen nicht aus. Soweit sie
auf Etikettierungsregelungen beruhen, sind sie nur sehr
schwerfällig änderbar, weil sie unmittelbar
Binnenmarktrelevanz haben und dann auf europäischer Ebene
Einigungen hergestellt werden müssen. Deshalb wird über
eine sehr wichtige Regelung zur Kennzeichnung von allergenen
Stoffen verhandelt. Das zeigt gleichzeitig, dass diese
Kennzeichnungsregeln durch allgemeine Auffangregeln ergänzt
werden müssen, weil in dieser Regelung nur die wichtigsten
allergenen Stoffe erfasst werden können.
Der Versuch der Bundesregierung über die Offenlegung von
Informationen bei BehördenTransparenz und Offenheit des
behördlichen Handelns herzustellen, verdient im Prinzip
Zustimmung. Er ist allerdings im europäischen und
internationalen Vergleich sehr zögerlich und
eingeschränkt ausgefallen. Wenn man die
Informationsfreiheitsgesetze im Vergleich ansieht, dann stellt man
fest, dass neben der Bundesrepublik nur Luxemburg und
Österreich keinen allgemeinen Informationszugangsanspruch
haben, selbst von den mittel- und osteuropäischen
Beitrittskandidaten hat nur Slowenien einen solchen Anspruch nicht
geregelt. Der Referentenentwurf für ein
Informationsfreiheitsgesetz ruht seit Dezember in den
Schubläden des Innenministeriums und bleibt selbst hinter den
Informationsregelungen des europäischen und internationalen
Umfeldes und gegenüber den
Informationsfreiheitsansprüchen, die die Bundesländer neu
geregelt haben, zurück.
Zur europäischen Rechtsintegration ist zu sagen, dass für
unsere Überlegungen einschlägig sind vor allem die
Neufassung der allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie und die im
Januar verabschiedete Regelung über die Einführung einer
europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde und die
allgemeinen Grundsätze für die Lebensmittelsicherheit.
Für die Unternehmen werden diese mit Wirkung ab 1. Januar 2005
Ansprüche festlegen, die dafür sorgen, dass
tatsächlich umfassend über die Vorproduktionsstufen und
die weiteren Vertriebswege informiert wird und darüber auf
Verlangen auch die Behörden zu informieren sind.
Dieses Gesetz, das uns hier zur Beratung vorliegt, ist mit den
Regelungen, die in der Verordnung vorgesehen sind, im Grundsatz
vereinbar. Sie ist aber nicht geeignet für die Umsetzung der
allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie zu sorgen. Selbst für
eine angemessene Umsetzung des Artikels 16 der
Produktsicherheitsrichtlinie scheint mir dieses Vorhaben ungeeignet
zu sein, weil es keinen Sinn macht, aus einem in sich
kohärenten Richtlinienkontext eine Einzelregelung
herauszuziehen und sie in einem anderen Gesetz isoliert zu regeln
als in dem Gesetz, in dem es geregelt gehört, nämlich in
einem neu gefassten Produktsicherheitsgesetz.
Eine Schadensersatzpflicht der öffentlichen Hand ist unbedingt
erforderlich, weil sie die notwendigen Sorgfaltsanreize bietet
für die Aufbereitung der Informationen und weil sie die
Behörden nachträglich dazu anhält, sich mit den
Herstellern oder Vertreibern von Produkten ins Benehmen zu
setzen.
Die Erstreckung der Auskunftspflicht auf die Wirtschaft wird im
Grunde genommen von dieser weitgehend schon erfüllt. Die
Argumente, die dagegen vorgetragen werden, sind in sich
widersprüchlich. Zum einen wird gesagt, wir informieren doch
ganz breit, zum anderen wird Klage dagegen geführt, welche
umfangreichen Informationsansprüche neu auf die Wirtschaft
zukommen. Ich meine, dass die Informationsansprüche mit Fug
und Recht auf europäischer Ebene geregelt werden sollten. Sie
sind aber, jedenfalls was die behördliche Ausrichtung der
Informationsverpflichtung der Unternehmen angeht, durch die neue
Rahmenregelung für die Lebensmittelsicherheit in der EG auch
auf dieser Ebene geregelt.
Die Behörden tun gut daran, tatsächlich aufbereitete
Informationen über das Internet zugänglich zu machen,
denn es erfolgt dadurch ein Anreiz, nicht auf der untersten
Verwaltungsebene die Informationen zu belassen, sondern sie auf
Landesebene zusammenzuziehen. Wenn aktiv über das Internet
informiert wird, dürften auch die einzelnen Bescheide von
passiv abgewarteten Informationsansprüchen tatsächlich
zahlenmäßig gering bleiben und die erhoffte
Breitenwirkung, die sich auch Verbraucherverbände zu Nutze
machen können, erreicht werden.
MR Dr. Christian Grugel, Niedersächsisches Ministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten:
Vielen Dank Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und
Herren. Ein Verbraucherinformationsgesetz ist eine notwendige
Ergänzung der Information, die Verbraucher auf anderen Wegen
erhalten können. Die Lebensmittelkennzeichnung oder auch die
Werbung für Produkte sind zwangsläufig zu schmal, um
Transparenz herzustellen, die Verbrauchern ermöglicht,
selbstbestimmt zu handeln. Das ist einer der Ansätze. Der
zweite notwendige Ansatz ist der, dass wir in der Vergangenheit
gelernt haben, dass alle Lebensmittelkrisen immer ganze Branchen
getroffen haben und dass es sehr schwer war, im Krisenmanagement
mit diesen Situationen umzugehen. Von daher muss die Kultur des
Misstrauens von einer Kultur des Vertrauens ersetzt werden. Das
setzt voraus, dass Transparenz hergestellt wird, damit Verbraucher
differenzieren können. Denn wenn sie nicht differenzieren
können, werden sie nicht abgewogen und rational handeln. Dies
zunächst als allgemeine Aussage zur Notwendigkeit eines
Verbraucherinformationsgesetzes.
Wenn man sich den Regierungsentwurf im Einzelnen ansieht,
lässt sich zum Geltungsbereich sagen, dass man natürlich
dieses Verbraucherinformationsgesetz auch breiter anlegen kann,
also für alle Produkte und Dienstleistungen auslegen
könnte, dass aber die Begrenzung auf Lebensmittel und
Bedarfsgegenstände ein sehr vernünftiger Einstieg ist.
Sie müssen bedenken, dass in den Ländern sehr
unterschiedliche Verwaltungen betroffen sind und der jetzige
Zuschnitt eine spezifische Verwaltung trifft, von der ich annehme,
dass sie mit diesen Problemen weitgehend zurecht kommen wird. Im
übrigen ist der Informationszugang, der bei den Behörden
vorgesehen ist einer, der den Verbrauchern nur zum Teil für
sie nützliche Informationen gibt. Behörden prüfen,
ob Gesetze eingehalten werden, d. h., die Mehrzahl der
Informationen, die in der Überwachung anfallen, sind für
den Verbraucher sicherlich nicht besonders interessant. Was in dem
Gesetzentwurf nicht vorgesehen ist, was aber in der
niedersächsischen Gesetzesinitiative vorgesehen war, das war
ein Zugang zu bestimmten Informationen, die bei Unternehmen
vorhanden sind. Man kann dies sicherlich nicht in der ganzen Breite
herstellen, aber zu spezifischen Informationen, die immer wieder
nachgefragt werden, kann man einen solchen Informationsanspruch
nach meiner Einschätzung schon schaffen.
Wir würden mit einer solchen Regelung mehr erreichen als nur
eine andere Politik im Umgang mit Informationen, denn wir
hätten auch einen Impuls in der Wirtschaftspolitik. Bei weiten
Teilen der Lebensmittelwirtschaft handelt es sich nämlich um
?lemmon markets? im Sinne der Definition des amerikanischen
Ökonomen Akerhof. Diese lemmon markets zeichnen sich dadurch
aus, dass den Verbrauchern Qualitätsmerkmale wegen fehlender
Transparenz des Angebots nicht ausreichend vermittelt werden
können. Höherwertige Produkte können unter diesen
Umständen keine besseren Preise erzielen. Für den
Verbraucher ist die Differenzierung nicht in der Weise
möglich, wie es tatsächlich möglich wäre.
Ich will dies an einem einfachen Beispiel erläutern. Wenn man
sich das Angebot im Tee-Bereich anschaut, dann hat man dort die
Chance, unterschiedliche Qualitäten zu unterschiedlichen
Preisen anzubieten und durch die Ausdifferenzierung der Produkte
ist der Markt gegenüber Turbulenzen sehr stabil. Wenn Sie sich
dagegen den Markt für Kaffee anschauen, findet hier gerade ein
Umbruch statt. Wir haben dort einen Markt, der, wenn der
Gesamtmarkt sich verändert, zurückgeht, aber die fehlende
Ausdifferenzierung und Transparenz nach Anbaugebieten, nach
Qualitäten, macht diesen Markt anfällig. Und deshalb ist
Transparenz und die Entwicklung von Märkten etwas, das
zwingend miteinander verbunden ist. Insofern kommt diesem, in dem
Gesetzentwurf der Bundesregierung noch fehlenden Zugang sicherlich
eine Bedeutung zu, die man auch unter diesem wirtschaftspolitischen
Aspekt sehen muss.
Im Übrigen gibt es einige Einzelpunkte, von denen ich glaube,
dass man im Regierungsentwurf darüber nachdenken sollte, sie
zu ergänzen. So halte ich es für zweckmäßig,
Verwaltungsverfahren in den Ausschluss-Tatbestand aufzunehmen, weil
ich nicht verstehen kann, dass man ein
Ordnungswidrigkeitenverfahren, in das ein Verwaltungsverfahren
hineinführen kann, ausnimmt, aber das Verwaltungsverfahren,
das im Vorfeld dazu läuft, eben nicht. Insofern können
Informationen zu einem sehr frühen Zeitpunkt breit gestreut
sein, so dass das Verfahren in sich nicht mehr unabhängig
wäre. Das gilt im Übrigen auch für Ausnahmen, die
auf Grund des Lebensmittelbedarfsgegenständegesetzes
möglich wären.
Für genauso notwendig halte ich es, dass man Informationen
erläutert. Wenn Informationen von Behörden abgegeben
werden, müssen die Menschen sie verstehen. Es sollte auch in
jedem Fall dem betroffenen Unternehmen selbst eingeräumt
werden, diese Informationen selbst in die Öffentlichkeit zu
bringen, da ein Verbraucherinformationsgesetz ein Gesetz zur
Herstellung von Transparenz sein sollte, und nicht zur
Sanktionierung. Ein Warngesetz haben wir bereits im
Produktsicherheitsgesetz und ich habe den vorliegenden
Gesetzentwurf so verstanden, dass es hier um Transparenz und nicht
um Warnung geht.
Gestatten Sie mir noch einen letzten Hinweis auf die
voraussichtlichen Nutzer dieses Gesetzes. Dies werden in begrenztem
Umfang Allergiker und Personen mit
Nahrungsmittelunverträglichkeiten sein. Im Übrigen wird
dieses Gesetz natürlich von den Medien benutzt werden, denn
Medien stellen auch in allen übrigen Bereichen der
Gesellschaft Transparenz her. Schließlich muss nach meiner
Überzeugung dieses Gesetz notifiziert werden, da man so ein
Gesetz nicht ausschließlich auf deutsche Produkte oder hier
ansässige Unternehmen beschränken kann. Ich glaube, dass
es im Übrigen nicht sinnvoll ist, die Anwendung dieses
Gesetzes in den Ländern so zu organisieren, dass jede
Einzelbehörde befragt wird, sondern dass man dies
vernünftigerweise bündelt. Der Gesetzentwurf lässt
diese Möglichkeit. In Niedersachsen wird zur Zeit daran
gedacht, dass das Dezernat Öffentlichkeitsarbeit im Landesamt
für Verbraucherschutz der Ansprechpartner wäre. Ich danke
Ihnen.
Elke Heidemann-Peuser, Verbraucherzentrale
Bundesverband: Herzlichen Dank Herr Vorsitzender, meine
Damen und Herren, der Bundesverband der Verbraucherzentralen und
Verbraucherverbände begrüßt ausdrücklich den
Vorschlag der Bundesregierung zur Schaffung eines
Verbraucherinformationsgesetzes. Bereits in seinem eigenen
Eckpunktepapier vom November letzten Jahres hatte der
Verbraucherzentrale Bundesverband eine Stärkung der
Informationsrechte der Verbraucher durch ein umfassendes
Verbraucherinformationsgesetz gefordert. Die Forderung geht davon
aus, dass nur ein informierter Verbraucher eine
eigenverantwortliche Entscheidung treffen und sich, da ein
Verbraucher auch stets Staatsbürger ist, auch
sozial-verantwortlich verhalten kann. Ein umfassender
Verbraucherinformationsanspruch folgt bereits aus dem allgemeinen
Persönlichkeitsrecht.
Ohne die Möglichkeit eines Zugangs zu relevanten Daten bleibt
überdies die in einer modernen Volkswirtschaft einzigartig
adäquate Rolle des Verbrauchers als Partner der Wirtschaft und
notwendige Kontrollinstanz bloße Theorie. Ein umfassendes
Verbraucherinformationsgesetz ist erforderlich, weil die
gegenwärtigen Informationsrechte und Möglichkeiten nicht
ausreichen. Zwar bestehen insbesondere im Bereich der Lebensmittel
und Bedarfsgegenstände umfangreiche Kennzeichnungspflichten,
diese vermitteln aber nicht alle für die Verbraucher
relevanten Informationen. Oftmals können die Verbraucher z. B.
nicht erkennen, ob ein Produkt bzw. dessen Rohstoffe oder Zutaten
mit gentechnisch veränderten Organismen hergestellt wurden. Im
Hinblick auf das gestiegene Gesundheitsbewusstsein der
Bevölkerung ist dies aber für viele Verbraucher eine
relevante Information. Laut Umfragen lehnen immerhin 70 % der
europäischen Verbraucher Gentechnik in Lebensmitteln ab. Nicht
zufriedenstellend ist derzeit auch bei Lebensmitteln die allgemein
zugängliche Information über die Herkunft und den
Herstellungsverlauf. Auch insoweit besteht Handlungsbedarf. Es muss
eine lückenlose Kontrolle und Dokumentation der gesamten
Produktionskette sichergestellt werden, um das durch
Lebensmittelskandale verlorene Verbrauchervertrauen wieder zu
gewinnen. In diesem Zusammenhang begrüßen wir sowohl den
vorgesehenen erleichterten Zugang zu den bei den Behörden
vorhandenen Informationen, als auch die Möglichkeit der
Behörden zu einer aktiven Information der Verbraucher bei
Vorliegen eines besonderen Interesses, ohne dass die
Voraussetzungen einer behördlichen Warnung bei Gefahr im
Verzug erfüllt sein müssen. Behörden müssen das
Recht haben, z. B. über Ergebnisse von
Überwachungsmaßnahmen ohne Furcht vor
Schadensersatzansprüchen, natürlich mit der gebotenen
Sorgfalt, die Verbraucher in geeigneter Form zu informieren.
Wir begrüßen außerdem die in § 9 des Entwurfs
vorgesehene regelmäßige Veröffentlichung des
verbraucherpolitischen Berichts der Bundesregierung. Dieser kann
sowohl der Wirtschaft als auch den Verbraucherverbänden
wichtige Aufschlüsse liefern. Nach den Vorstellungen der
Verbraucherverbände geht der Regierungsentwurf zwar in
wesentlichen Schritten in die richtige Richtung, er bleibt jedoch
hinsichtlich des Gegenstandes des Informationsanspruchs,
Lebensmittel und Bedarfsgegenstände, als auch hinsichtlich
seiner Beschränkung auf den Anspruch gegenüber
Behörden, hinter einer dringend notwendigen weitergehenden
Reform zurück. Das Informationsbedürfnis der Verbraucher
erstreckt sich auch auf andere Produkte als Lebensmittel und
Bedarfsgegenstände, die zur privaten Nutzung bestimmt sind,
sowie auf Dienstleistungen. Die Verbraucher möchten auch
wissen, ob von einem Handy eine gesundheitsgefährdende
Strahlenbelastung ausgeht, oder ob ihre Haushaltsgeräte
hinreichend sicher sind. Der Produktbegriff aus der EG-Richtlinie
für die allgemeine Produktsicherheit definiert den Begriff
Produkt als jedes Produkt, das auch im Rahmen der Erbringung einer
Dienstleistung für Verbraucher bestimmt ist oder unter
vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen von Verbrauchern
benutzt werden könnte. Ein Verbraucherinformationsgesetz
sollte sich an diesem Produktbegriff orientieren.
Der Verbraucherzentrale Bundesverband vertritt die Auffassung, dass
der auf die Behörden beschränkte Informationsanspruch oft
nicht ausreicht, um das erklärte Ziel zu erreichen, die
Verbraucher in ihrer wirtschaftlichen Rolle als Marktteilnehmer
selbstbestimmt handeln zu lassen, da ansonsten die Information der
Verbraucher zwangsläufig lückenhaft bleibt und den
Verbrauchern weiterhin wesentliche für ihre Kaufentscheidung
maßgebliche Tatsachen verborgen bleiben. Folgende Gründe
sprechen dafür, den Informationsanspruch auf Unternehmen
auszuweiten. Die Forderung nach mehr Verbraucherinformation steht
im Einklang mit Artikel 153 des Vertrages von Amsterdam, der das
Recht der Verbraucher und deren Anspruch auf Information
ausdrücklich hervorhebt. Das Ende letzten Jahres von der
Kommission vorgelegte Grünbuch zum Verbraucherschutz
bezeichnet es unter Bezugnahme auf dieses Recht als in jedem Falle
unerlässlich, eine allgemeine Pflicht zur Offenlegung und
Information vorzusehen. Eine Schlüsselfunktion käme
einmal dem Unternehmen aufzuerlegenden Verpflichtung zu, den
Verbrauchern alle wesentlichen Informationen eindeutig und
rechtzeitig offenzulegen. Der Europäische Gerichtshof geht
seit einigen Jahren bei der Frage, wie eine Werbeangabe aufzufassen
ist, von dem durchschnittlich informierten aufmerksamen und
verständigen Durchschnittsverbraucher aus, der auf Grund
ausreichender Informationen in der Lage sein muss, seine
Entscheidung auf dem Markt zu treffen. Maßgeblich ist also
nicht länger der flüchtige und unkritische Verbraucher.
Anspruch und Wirklichkeit weichen aber deutlich voneinander ab. Die
Anwendbarkeit dieses Leitbildes setzt voraus, dass der Verbraucher
eine reelle Chance hat, sich ohne erschwerten Aufwand und
unzumutbarer Kosten alle für seine Kaufentscheidung
maßgeblichen Informationen zu beschaffen. Demgegenüber
sehen sich die Verbraucher einer massiven, immer subtileren Werbung
gegenüber, die häufig eher von Sachinformation ablenkt.
Dem Recht zur verschönernden, selektiven und
übertriebenen Präsentation von Produkten bis an die
wettbewerbsrechtlichen Grenzen der Irreführung oder
Sittenwidrigkeit muss eine Pflicht zur umfangreichen
wahrheitsgemäßen Information gegenüberstehen. Die
Verbraucher selbst haben unter Umständen keine andere
Möglichkeit, an die für sie wichtigen Informationen zu
gelangen, als über die Unternehmen.
Mehrstufige Verarbeitungsprozesse, Produktionsstandorte im Ausland
und Zulieferungen aus unterschiedlichen Quellen in einer
industrialisierten Arbeitswelt machen es dem Verbraucher
unmöglich, an einem fertigen Produkt zu erkennen, wie dieses
zustande gekommen ist. Selbst bei Einhaltung aller
Kennzeichnungsvorschriften erfährt der Verbraucher
gegenwärtig nicht, unter welchen Arbeitsbedingungen, oder bei
der Verwendung von Rohstoffen, unter welchen Umweltbedingungen die
Herstellung erfolgt ist. Gerade solchen Aspekten, wie der Beachtung
ethischer und sozialer Grundsätze und Nachhaltigkeit kommen in
einer globalisierten Weltwirtschaft immer größere
Bedeutung zu. Verbraucher haben ein berechtigtes Interesse zu
erfahren, wie der Strom gewonnen wird, mit dem sie beliefert werden
und woher das Holz für ihre Gartenmöbel stammt. Aber auch
im Bereich der Dienstleistungen wächst das Interesse der
Verbraucher an Informationen, die über den unmittelbaren
Nutzen hinausgehen. So etwa bei Geldanlagegeschäften. Die
Sparer möchten erfahren, in welche Programme das Geld, das sie
der Bank überlassen, investiert wird. Das grundsätzliche
Interesse der Verbraucher an Informationen über
ökologische Aspekte der Altersvorsorge wird durch eine
repräsentative Umfrage von Emnid bestätigt. Danach wird
von 84,3 % der Befragten eine umweltbezogene
Publizitätspflicht gewünscht. 80 % der Befragten sind der
Auffassung, dass eine Berücksichtigung von Umweltaspekten, in
die konkrete Einzahlung in ihre private Altersversorgung
wünschenswert wären.
Ein letztes Wort zur Selbstverpflichtung. Wir sind der Meinung,
dass Selbstverpflichtungen der Wirtschaft kein Äquivalent zu
einem durchsetzbaren Rechtsanspruch darstellen und würden
befürworten, dass auch hier ein klarer Rechtsanspruch in das
Gesetz aufgenommen wird. Dies zeigen auch die Erfahrungen
hinsichtlich solcher Selbstverpflichtungen. Wir haben gerade vor
zwei Wochen eine Untersuchung, die zwar nicht repräsentativ
ist, vorgestellt, in der das Auskunftsverhalten der Firmen doch
immer noch als sehr unzureichend erkannt worden ist.
Nach all dem möchte ich zusammenfassen, dass unser Anspruch an
ein umfassendes Verbraucherinformationsgesetz weitergeht, wenn dies
in einem ersten Schritt nicht erreicht werden können sollte,
dann sind wir doch der Auffassung, das zumindest eine spätere
Erweiterung möglich bleiben muss, z. B. durch eine
entsprechende Formulierung des Gesetzes, das im Moment aber noch
sehr abschließend formuliert ist.
Dr. Karin Klaffke, Institut für Markt-,
Umwelt-Gesellschaft an der Universität Hannover: Herr
Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich möchte mich eingangs
ganz herzlich bedanken, hier vorsprechen zu dürfen. Das IMUK
ist ein privates Forschungs- und Beratungsinstitut und hat einen
Kooperationsvertrag mit der Universität Hannover und ich bin
hier, weil das IMUK vor kurzem ein Gutachten erstellt hat zum Thema
Potenziale für eine verbesserte Verbraucherinformation,
Kennzeichnung bei Nahrungsmitteln und andere Informationsangebote.
Auftraggeber war der Deutsche Bundestag bzw. das Büro für
Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Zum anderen
bin ich auch hier, weil das IMUK einen Schwerpunkt hat, der sich
sozial-ökonomische Unternehmensbewertung nennt, der gemeinsam
mit den Verbraucherverbänden Unternehmenstest durchführt,
wobei Unternehmen nach sozialen und ökologischen Kriterien
bewertet werden und ein wichtiger Punkt dabei ist die
Informationsoffenheit der Unternehmen, also wie reagieren
Unternehmen auf Beschwerden. Wir halten die Initiative und Idee,
die hinter diesem Gesetzentwurf steht, für äußerst
begrüßenswert. Ich halte es auch für machbar, dies
zunächst auf den Lebensmittelbereich zu beschränken. Dies
sollte aber zu einem späteren Zeitpunkt auch auf andere
Branchen ausgedehnt werden. Die Einschränkung, nur die
Behörden in die Pflicht zu nehmen, reicht jedoch unserer
Ansicht nach nicht aus. Wir haben in dem Gutachten deutlich
gemacht, dass die bisherigen Informationsinstrumente, die den
Verbrauchern vorliegen um sich zu informieren, nämlich die
Kennzeichnung und die Informationspolitik von Unternehmen und
anderen Informationsquellen nicht ausreichen, um den Verbraucher
umfassend zu informieren. Die Kennzeichnung weist, kurz gefasst, u.
a. folgende Schwachpunkte auf: Das Kennzeichnungsrecht ist zu
kompliziert und lückenhaft. Was das Zutatenverzeichnis angeht,
werden gerade Allergiker nicht ausreichend geschützt und es
gibt wenig Information über die Prozessqualität.
Darüber hinaus stößt die Kennzeichnung an Grenzen,
weil man nicht alles auf die Verpackung schreiben kann, und deshalb
muss man sich überlegen, wo man zukünftig vielleicht
Informationen unterbringt. Wir haben auch die Informationspolitik
von Unternehmen im Rahmen des Gutachtens untersucht und uns dabei
z. B. das Internet-Angebot der Lebensmittelindustrie angesehen. Wir
haben des Weiteren mit sog. mystery E-Mails, das sind versteckte
Anfragen, die Unternehmen befragt. Dort ging es um allergene Stoffe
in den Lebensmitteln. Danach gibt es in der Informationsoffenheit
der Unternehmen durchaus noch Verbesserungspotenziale. Zwar haben
viele Hersteller relativ zügig geantwortet und haben uns
Tabellen geschickt, aus denen hervorgeht, welches Produkt man unter
Berücksichtigung seiner Allergie noch essen darf. Dagegen
findet sich im Internet-Angebot bisher überhaupt nichts, was
die Herkunft und Zusammensetzung von Nahrungsmitteln oder
gentechnisch veränderte Organismen in den Lebensmitteln
angeht. Auch aus der Untersuchung Unternehmenstest wissen wir, dass
die Informationsoffenheit der Unternehmen verbesserungswürdig
ist. Zwar gibt es auch hier Unternehmen die sich vorbildlich
verhalten, aber es gibt auch einige schwarze Schafe. Als andere
Informationsquellen stehen den Verbrauchern z. B. die
Broschüren der Verbraucherzentralen oder das Internet-Angebot
verschiedener Organisationen zur Verfügung. Diese sind sicher
wichtig, können aber bestimmte Fragen auch nicht beantworten,
z. B. was die Zusammensetzung und Herstellung von Lebensmitteln
angeht. Wir haben aus den Gutachten die Schlussfolgerung gezogen,
dass warenbegleitende Kennzeichnung nach wie vor wichtig ist, die
aber ergänzt werden muss durch andere Informationsinstrumente.
Zu denken ist auch an Bildschirme am point of sale oder ein
erweitertes Internet-Angebot, wo verbraucherspezifische
Informationen abrufbar sind. Darüber hinaus sind wir zu der
Schlussfolgerung gekommen, dass Informationsansprüche der
Verbraucher rechtlich verankert werden sollten und es sollte eine
Informationspflicht der Unternehmen eingeführt werden.
Zu dem geplanten Entwurf des Verbraucherinformationsgesetzes und
der darin enthaltenen Verpflichtung der Behörden zur
Offenlegung von Daten ist für mich die Frage, welche
Informationen bei den Behörden eigentlich vorliegen, über
was können Behörden die Verbraucher überhaupt
informieren. Hier ist in § 3 Absatz 4 aufgeführt, was bei
den Behörden für Informationen vorhanden sein sollen. Das
sind Informationen zur Herkunft, Verarbeitung, Behandlung und
Ausgangsstoffe etc. Allerdings liegen nach unserem Kenntnisstand
diese Informationen den Behörden gar nicht vor.
Da Behörden nur Stichproben nehmen, liegen ihnen Informationen
über alle am Markt befindlichen Produkte nicht vor. Diese
haben nur die Unternehmen selbst. Wenn ein solcher
Informationsanspruch im Gesetz verankert werden soll, geht dies
eben nicht ohne eine Informationspflicht der Unternehmen. Auch
stellt sich hier die Frage, wie das praktikabel zu lösen ist.
Sollen etwa Behörden Datenbanken über sämtliche
Unternehmensdaten anlegen?
Die nächste Frage, die man sich stellen muss, ist die, wie
Informationen dem Verbraucher bereitgestellt werden sollen. Dies
betrifft die Frage der Aufbereitung der Daten, über die
nochmal nachgedacht werden sollte, weil allein die
Veröffentlichung von Statistiken den Verbrauchern nicht
helfen. Ferner sollte über eine bundeseinheitliche Erfassung
der Daten nachgedacht werden. Diese Daten liegen bisher nur
länderspezifisch vor. Schließlich ist für uns von
zentraler Bedeutung, dass der Informationsanspruch gegenüber
den Unternehmen rechtlich verankert wird. Vielen Dank.
Peter Knitsch, Ministerium für Umwelt, Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen: Herr Vorsitzender, meine sehr
geehrten Damen und Herren, ich möchte aus Sicht einer obersten
Landesbehörde, die für den Gesamtbereich des
Verbraucherschutzes zuständig ist, Stellung nehmen zu diesem
Gesetzentwurf der Bundesregierung, der im Wesentlichen zwei
Elemente enthält. Zum einen eine erweiterte
Informationsmöglichkeit für Behörden über
Sachverhalte, von denen sie Kenntnis erhalten und über
Verstöße im Verbraucherschutzbereich zu informieren, und
zum anderen ein Auskunftsrecht für Verbraucherinnen und
Verbrauchern gegenüber öffentlichen Stellen. Beide
Elemente werden aus unserer Sicht ausdrücklich
begrüßt. Wir halten es für dringend notwendig, dass
entsprechende Regelungen geschaffen werden. In der Tat ist es ganz
dringend notwendig, Informationsmöglichkeiten für
Behörden über Sachverhalte, die sie im Rahmen ihrer
Tätigkeit, insbesondere ihrer Kontrolltätigkeit,
erfahren, auf gesicherter rechtlicher Grundlage zu schaffen. Im
Moment ist es so, dass Behörden nur dann legitimiert sind
über Sachverhalte zu informieren, wenn sie von
gesundheitlichen Gefährdungslagen Kenntnis erhalten. Das
heißt nur dann, wenn wir im Rahmen unserer behördlichen
Lebensmitteluntersuchung feststellen, dass ein Lebensmittel
gesundheitliche Gefährdungen aufweist, sind wir nach einem
relativ komplizierten Verfahren berechtigt und unter bestimmten
Voraussetzungen auch verpflichtet, zu informieren. Immer dann, wenn
eine solche gesundheitliche Gefährdungslage nicht vorliegt, d.
h. wenn es sich z. B. um Fälle von Täuschung handelt,
selbst bei grober Täuschung, sind wir dazu nicht legitimiert.
Zwei Beispiele aus der Vergangenheit: Als unmittelbar nach der
BSE-Krise viele Wurstprodukte auf dem Markt auftauchten, die auf
einmal als - zum Teil unzutreffend - rindfleischfrei gekennzeichnet
waren, waren wir zwar befugt, insgesamt über diesen
Sachverhalt zu informieren, wir waren aber nicht legitimiert, und
das kann man Verbrauchern, wie die Praxis zeigt, eben nicht
deutlich machen, zu sagen, welche Firmen falsch etikettiert haben.
Das gleiche Problem ist aufgetaucht, als Ende vergangenen, Anfang
dieses Jahres Schinkenprodukte auftauchten, in denen mehr Wasser
war als Schinken selbst, also sog. schnittfestes Wasser. Auch hier
waren wir als Behörde nicht legitimiert, dem Verbraucher
mitzuteilen, welche Hersteller sich hier täuschend verhalten
hatten und bei welchen Herstellern das nicht der Fall war.
Dies ist eine Gesetzeslage, die dem Verbraucher nicht zu vermitteln
ist und den schützt, der sich gegen das Gesetz verhält.
In unserer Rechtsordnung gibt es keinen anderen Bereich, in dem der
Gesetzgeber den schützt, der gegen das Gesetz
verstößt. Darüber hinaus ist dies aber auch eine
Rechtslage, die nicht im Sinne der Unternehmen ist, die
ordnungsgemäß handeln. Diese werden in die Sippenhaft
genommen durch die wenigen nicht korrekt handelnden Hersteller,
dadurch, dass die öffentliche Hand in ihrer
Informationspolitik nicht differenzieren kann. Ich sehe hier
dringenden Handlungsbedarf für den Gesetzgeber. Dies wäre
im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch im Sinne
der Wirtschaft, und zwar im wohlverstandenen Interesse der
Unternehmen, die korrekt handeln. Ein weiteres Element ist der
Auskunftsanspruch der Verbraucherinnen und Verbraucher
gegenüber Behörden. Dies begrüßen wir
nachhaltig, denn es entspricht dem Bild eines gut informieren,
selbstbestimmt handelnden und ethische Wertvorstellungen bei seiner
Kaufentscheidung berücksichtigenden Verbrauchers. Es ist aber
auch ein wirtschaftspolitisches Ordnungsinstrument, das nach
unserer Auffassung dem Bild des Grundgesetzes von einem
mündigen Verbraucher entspricht. Es ist ein Rechtsanspruch,
der in anderen Rechtsordnungen zum Teil seit Jahrzehnten verankert
ist. In den Vereinigten Staaten von Amerika würde man
über die Diskussion, die wir hier führen, nur
lächeln.
Ich hatte im Herbst vergangenen Jahres die Gelegenheit mit
verschiedenen Behörden- und Wirtschaftsvertretern dort zu
sprechen. Seit Anfang der 60er Jahre gibt der freedom of
informations act dort jedem Bürger und jeder Bürgerin das
Recht, die bei den Behörden vorhandenen Informationen zu
erhalten, und jeder Kontrollbericht über ein Restaurant oder
einen Betrieb wird ins Internet eingestellt. So hat jeder die
Möglichkeit, sich z. B. vor einem Restaurantbesuch zu
informieren, inwieweit die letzte Hygienekontrolle, die dort
stattgefunden hat, Auffälligkeiten ergeben hat oder nicht.
Nach meinen Informationen ist dies jetzt auch in Dänemark
Pflicht geworden. Dort werden solche Ergebnisse neben der
Speisekarte ausgehangen. Entsprechend erntet man über die hier
geführten Diskussionen nur Kopfschütteln, denn es gibt
kein Verständnis dafür, dass Daten, die der Staat erhebt,
nicht öffentlich zugänglich sind.
Wir würden uns aus nordrhein-westfälischer Sicht
wünschen, dass das Gesetz möglichst von vornherein auf
alle Produkte und Dienstleistungen ausgeweitet wird, insbesondere
es auch eine Informationspflicht gegenüber Behörden gibt
und wenn das in dieser ersten Runde nicht möglich ist, ist der
von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf ein erster
wichtiger Schritt, der jetzt sofort, also noch vor der
Bundestagswahl, kommen sollte. Ansonsten werden wir immer wieder in
die Situation geraten, die ich geschildert habe und dies kann nicht
im Sinne des Gesetzgebers, erst recht nicht im Sinne der
Behörden sein. Diese werden im Übrigen nach meiner festen
Überzeugung mit dem Vollzug des Gesetzes keineswegs
überfordert sein. Im Gegenteil werden viele Behörden dies
als eine vernünftige rechtliche Grundlage für ihr Handeln
empfinden. Vielen Dank.
Brigitte Jäger, Senatsverwaltung für Gesundheit,
Soziales und Verbraucherschutz des Landes Berlin: Herr
Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, von den sog.
Skandalen um Lebens- und Futtermittel ist den Verbrauchern eine
tiefe Unsicherheit geblieben. Die diffusen Ängste vor
unerlaubten Stoffen und Herstellungsverfahren haben sich dadurch
verstärkt. Beschwichtigende Mitteilungen der Behörden
können die Verbraucher nach Erfahrungen der letzten Jahre
nicht mehr akzeptieren. Es gilt also das Vertrauen der Bürger
in die Lebensmittelherstellung und in die Überwachung
wiederzugewinnen. Dies ist nur durch eine offene Haltung und
konkrete Antworten auf die Fragen der Verbraucher möglich. Ich
möchte Ihnen hierzu ein Beispiel geben.Vergleichen Sie einmal
die Antworten zu der vielleicht durch die Medien hochgespielten
Frage, ob ein bestimmter Stoff in Lebensmitteln oder
Bedarfsgegenständen vorhanden ist. Nach jetzigem Recht sagt
die Behörde, wir überwachen diese Lebensmittel, es
besteht kein Grund zur Beunruhigung. Auf der Basis des
Verbraucherinformationsgesetzes kann die Antwort lauten: Wir haben
die zehn Produkte A bis J untersucht, der Stoff wurde lediglich in
dem Produkt B, in der Charge XY nachgewiesen. Der Hersteller hat
die Charge zurückgerufen und sie ist nicht mehr im Handel.
Andere Chargen des Herstellers sind nicht betroffen.
Im Grunde sind beide Aussagen gleich. Es ist alles in Ordnung. Die
erste Aussage, wir überwachen alles und haben alles im Griff,
erweckt den Eindruck des Vertuschens, während die zweite
Offenheit und Ehrlichkeit der Behörde signalisiert und eine
Verantwortlichkeit der Firma, die die Produkte zurückgezogen
hat. Deswegen ist ein Gesetz, das konkrete Informationen der
Verbraucher zulässt, erforderlich.
Zu der Informationspflicht der Unternehmer möchte ich nichts
mehr sagen. Vielmehr schließe ich mich hier meinen Vorrednern
an. Ich bin dringend der Ansicht, dass Unternehmen einbezogen
werden müssen, denn es gibt eine Menge von Informationen die
bei Behörden einfach nicht vorhanden sind.
Ich möchte aber kurz noch auf die Kosten eingehen. Der
Gesetzentwurf sieht vor, dass für die Beantwortung der
Verbraucherfragen kostendeckende Gebühren genommen werden, das
Bereitstellen von Daten im Internet aber kostenfrei erfolgen soll.
Wenn aber Anfragen von Verbrauchern Recherchen und Vorarbeiten
erfordern, werden die Kosten dafür sehr hoch sein. Wir wollen
aber, dass jeder Bürger, unabhängig von seinem Verdienst
Zugang zu den Informationen hat und die Gebühren kein Hemmnis
für einen Antrag sind. Deshalb werden die Gebühren
vielfach nicht in der Höhe der eigentlichen Kosten an die
Verbraucher weiterzugeben sein.
Dies bedeutet aber auch, dass die Gebühren in der
Realität nicht kostendeckend sein werden, in keinem
Bundesland. Auch die im Internet zur Verfügung zu stellenden
Dateien sind sehr kostenintensiv für die Länder, denn die
in den Untersuchungsämtern und den Kontrollbehörden vor
Ort gewonnenen Daten müssen gesammelt, geordnet und mit
Überschriften versehen werden, so dass sie verständlich
sind. Es bleibt auch nicht aus, dass kurze Erläuterungen zu
den Dateien beigefügt werden, weil Begriffe wie Chlormiquat
und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe nicht zur
Allgemeinbildung gehören. Kommentare müssen immer dann
eingefügt werden, wenn es um die Bewertung von Stoffen geht,
denn mit dem Namen allein kann schließlich niemand etwas
anfangen.
Die hierfür erforderlichen Stellen des gehobenen und
höheren Dienstes verursachen erhebliche Kosten. Es ist bisher
nicht geklärt, wer diese Kosten übernimmt. Ich
befürchte, dass die armen Länder, und hier spreche ich
insbesondere für Berlin, hierfür weder Personal noch
Sachmittel zur Verfügung stellen können. Berlin ist
deshalb der Ansicht, dass der Bund die Kosten hierfür
übernehmen muss, wo die Möglichkeiten der Länder
ausgeschöpft sind.
Der Vorsitzende: Ich bedanke mich bei Ihnen allen,
meine sehr geehrten Damen und Herren und will auch gleich in die
Fragerunde eintreten.
Abg. Helmut Lamp: Ich befürworte eine
verbesserte Verbraucherinformation, hatte ich doch im vergangenen
Jahr erhebliche Schwierigkeiten, Informationen von der Berliner
Senatsverwaltung über Arzneimittelrückstände im
Fleisch zu bekommen. Es ging um Ergebnisse für ökologisch
und konventionell produziertes Fleisch. Deswegen eine Frage an Frau
Dr. Heidemann-Preuser, hätten Sie sich nicht gewünscht,
dass die Verbraucherinformation vor Ort mit einem
größeren Gewicht in diesem
Ver-braucherinformationsgesetz verankert worden wäre, statt
dass sie in der Realität vor Ort zurückgefahren
wird.
Eine weitere Frage an Herrn Knitsch. Es hat eine ganze Reihe von
Lebensmittelskandalen gegeben, die zum Teil tatsächlich welche
waren, zum Teil aber auch Pseudoskandale. Vielleicht erinnern Sie
sich in diesem Zusammenhang noch an die Geschichte mit dem
Fuchsbandwurm vor ca. 10 Jahren. Hat sich an dieser Situation
irgendetwas geändert und wenn es denn ein Missbrauch war,
sagen Sie mir bitte, was sich an der Situation vorher und nachher
verändert hat. Kann man sich vor der Verursachung einer
solchen Hysterie schützen und hätte das nicht in diesem
Verbraucherinformationsgesetz seinen Niederschlag finden
müssen?
Abg. Ulrike Höfken: Ich möchte mich
zunächst ebenfalls bei den Sachverständigen bedanken,
verstehe allerdings die Abwehr der Wirtschaft gegenüber den
verbesserten Auskunfts- und Informationsmöglichkeiten der
Medien wie auch des einzelnen Verbrauchers und der
Verbraucherverbände überhaupt nicht. Nicht auf Grund der
Ausführungen die Herr Dr. Grugel gemacht hat im Hinblick auf
die europäischen Verbindlichkeiten und Leitbilder die genannt
worden sind, aber auch nicht im Hinblick auf die Sippenhaft, die
Herr Knitsch und andere angesprochen haben. Ich kann nicht
nachvollziehen, dass Sie hier kein eigenes Interesse haben, diesen
ersten Schritt, der mit diesem Gesetz gemacht wird, mit Nachdruck
zu unterstützen.
Hierzu ein Beispiel: Ich hatte kürzlich Besuch aus den USA,
der wissen wollte, wie denn das Restaurant, in das wir gehen
wollten, hygienisch zu beurteilen sei. Mein Hinweis, dass ich dies
nicht wisse, stieß auf völliges Unverständnis.
Für meine Gäste war nicht nachvollziehbar, dass keine
Möglichkeit besteht, sich hierüber zu informieren. Die
hier im Vergleich zu anderen Ländern fehlende Transparenz
könnte in der Tat ein Nährboden für die beklagte
Misstrauenskultur sein. Deswegen möchte ich Herrn Knitsch,
Frau Jäger und Herrn Grugel nochmals bitten auszuführen,
in wieweit sie die Möglichkeit sehen, die Sorgfaltspflicht und
den Schutz der Wirtschaft vor Missbrauch dieser Daten
tatsächlich auszuüben.
Ferner bitte ich um Stellungnahme, inwiefern Sie tatsächlich
eine Wettbewerbsverzerrung der deutschen Unternehmen gegenüber
anderen EU-Mitgliedsländern oder anderen Drittländern
sehen, oder im Gegenteil eine Wettbewerbsverbesserung.
Abg. Annette Widmann-Mauz: Meine erste Frage
richtet sich an Herrn Dr. Falke und Prof. Horst. Wir haben
gehört, dass es sich um einen sehr allgemeinen
Informationsanspruch gegenüber der Behörde für den
Verbraucher handelt. Inwieweit hielten Sie, dort wo ein besonderes
Verbraucherinformationsinteresse gegenüber den Behörden
vorhanden ist, z. B. bei den allergenen Stoffen, einzelgesetzliche
Regelungen für einen praktikableren und damit auch
sachgerechteren Ansatz?
Die zweite Frage richtet sich nochmals an Prof. Horst und an den
Markenverband. Es war die Rede von der Kultur des Vertrauens, und
inwieweit würden Sie in diesem Zusammenhang durch das Gesetz
das Verhältnis verändert sehen zwischen der Behörde
und dem Unternehmen auf der einen Seite, den Unternehmen sowie
Betrieben und dem Verbraucher auf der anderen Seite. Sehen Sie hier
eine Klimaveränderung und wie könnten Sie sich
vorstellen, dass das eigene aktive Informationsbedürfnis der
Unternehmen gestärkt wird? Wäre hierfür ein
subsitärer Anspruch des Verbrauchers auf Information ein
gangbarer, praktikabler und richtiger Weg?
An die kommunalen Spitzenverbände, Herrn Dr. Grubel und Frau
Jäger richte ich die Frage, wie stellen Sie sich eine
bundeseinheitliche Erfassung von Daten vor, wenn wir
länderspezifisch unterschiedliche Regelungen haben, unter
Umständen auch länderspezifisch eine sehr
unterschiedliche Kontrolldichte und wie könnte sich dieser
praktisch bei Inkrafttreten eines solchen Gesetzes auswirken?
Abg. Jella Teuchner: Ich möchte mich
zunächst für Ihre Ausführungen bedanken und kann
erfreut feststellen, dass Sie alle grundsätzlich für ein
Verbraucherinformationsgesetz sind. Feststellbar ist aber auch,
dass der Kommunikations- und Informationsanspruch in den letzten
Jahren bei den Verbrauchern grundsätzlich gestiegen ist.
Hierzu zunächst eine Frage an den Markenverband. Ihrer
schriftlichen Stellungnahme entnehme ich, dass die
Markenartikelindustrie bereits jetzt schon bereit ist, mit
Informationen offen umzugehen. Allerdings ist dies durch das
Beispiel von Frau Heidemann-Preuser widerlegt worden. Ich
möchte Sie deshalb fragen, wie wollen Sie in Zukunft über
den Markenartikelverband diesem Bedürfnis noch besser gerecht
werden, reicht hier eine Selbstverpflichtung aus oder sollte es
nicht besser auf dem gesetzlichen Wege geregelt werden?
Herrn Prof. Dr. Falke bitte ich im Hinblick auf die in der Synopse
zu seiner schriftlichen Stellungnahme dargestellte Situation der
Informationsfreiheit in anderen europäischen Staaten um
Auskunft, ob sich für Deutschland ein Nachteil ergibt, wenn
wir uns jetzt in diese Informationsfreiheit nicht mit einschalten
würden, nachdem es in dieser Hinsicht in den übrigen
EU-Staaten keine gravierenden Mängel gibt.
Herr Knitsch hat ausgeführt, dass es in Nordrhein-Westfalen
dieses Informationsfreiheitsgesetz bereits gibt und die
Behörden dort schon heute verpflichtet sind, die Informationen
weiterzugeben. Hier würde mich genauer interessieren, wie
sieht es mit der Kostenfrage aus, welche Kosten würden auf die
Verbraucher zukommen und wie teuer ist es in Nordrhein-Westfalen
für die Behörden, die Informationen zur Verfügung zu
stellen? Bestünde eine reelle Chance, die Daten aus der
Lebensmittelüberwachung in das Internet einzustellen und
welche Kostenfrage verbindet sich damit?
Abg. Gudrun Kopp: Den Vertreter des
Bundesverbandes kommunaler Spitzenverbände bitte ich die
Kosten für den Vollzug der Aufbereitung und der Verwertung von
Informationen innerhalb der Verwaltung nochmal ins Verhältnis
zu stellen zu den Informationen, die die Behörden jeweils
herausgeben können, denn im Gesetzentwurf ist von der
Weitergabe vorhandener Informationen die Rede. Die Behörden
werden nicht verpflichtet, aktiv Informationen zu requirieren.
Insofern stellt sich für mich die Frage, wo der Nutzen
für den Verbraucher ist, wenn er bei einer Behörde
nachfragt und die Auskunft erhält, die Behörde wisse
darüber nichts. Hier geht es also um eine Kosten-Nutzen-Frage
zum Verwaltungsaufwand und dem Informationsgewinn.
Den Markenverband bitte ich um Auskunft, ob es richtig ist, dass in
vielen größeren Firmen auf dem deutschen Markt der
Marketing-Vorteil von offensiver Informationspolitik längst
gesehen wird, und zwar in der Form, dass einige Firmen derzeit ein
sehr modernes technologisch aufbereitetes Informationssystem
vorbereiten, das Kunden z. B. im Lebensmittelhandel in die Lage
versetzt, durch bestimmte Codierungen auch gesundheitsrelevante
Informationen demnächst erhalten zu können. Hierzu
gehört z. B. die Angabe von allergenen Stoffen oder die Angabe
von Broteinheiten für Diabetiker. Wissen Sie von dem und wie
weit ist dieses Projekt? Ferner wüsste ich gern, was Sie in
diesem Zusammenhang von einer Verbändevereinbarung nach dem
Vorbild der Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs
hielten?
Eine letzte Frage an Herrn Prof. Falke. Könnten Sie noch
einmal die verfassungsrechtlichen Problemfelder in diesem
Gesetzentwurf aufzeigen, die sich im Hinblick auf die
Rechtsposition der Wirtschaft und das Haftungsrisiko bei Auskunft
der Behörden und das Recht auf Akteneinsicht mit Blick auf die
EU-Tauglichkeit ergeben.
Der Vorsitzende: Herr Knitsch, Sie haben die
Situation in den Vereinigten Staaten geschildert. Vielleicht
können Sie dieses noch mit Ausführungen zur Haftungsfrage
im US-amerikanischen Recht ergänzen, denn diese Frage war auch
heute Gegen---
stand der Kritik.
Herrn Falke bitte ich um Auskunft, wie groß Sie den
Änderungsbedarf zum vorliegenden Gesetzentwurf
einschätzen und welche Zeit eine sorgfältige Beratung
hierzu in Anspruch nehmen wird, um ordentlich anwendbare Regelungen
zu erreichen und sonst zu befürchtende Kritik am
verabschiedeten Gesetz zu vermeiden.
Herr Prof. Horst, aus der Stellungnahme der Firma Underberg, die
als A-Drs. ausliegt, ist mir bewusst geworden, dass die
Informationspflicht nach § 3 des Gesetzentwurfs sich immer auf
nicht positive Informationen bezieht, also Daten über Gefahren
und Risiken beinhalten soll. Dagegen sind Informationen oder
Hinweise auf qualitätsbestimmende und positive Eigenschaften
bisher nicht vorgesehen. Wie könnte dieses
Berücksichtigung finden?
Frau Heidemann-Preuser, Sie haben ausgeführt, Sie wollen in
der Werbung eine saubere und objektive Information haben. Mir sind
manchmal die kulturellen Aspekte einer gut gemachten Werbung, die
mich anspricht auch ohne Informationen zu enthalten, wichtiger. Ist
es deshalb wirklich zutreffend, dass Werbung auf Information
beschränkt sein sollte?
Abg. Albert Deß: Ich bin nicht
überrascht, dass viele der hier anwesenden
Sachverständigen der Meinung der CDU/CSU-Fraktion sind, dass
dieses Gesetz unausgegoren und wenig zielführend ist. Ich darf
auch für die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag anmerken,
dass auch wir ein Verbraucherinformationsgesetz wollen, dass aber
unser Ansicht nach hier noch Korrekturen notwendig sind. Deshalb
meine Frage an Herrn von Hausen. Wie erklären Sie sich die
Tatsache, dass die kommunalen Spitzenverbände durch die
Bundesregierung weder über das Gesetzesvorhaben selbst
informiert, noch an der am 12.12.2001 stattgefundenen Anhörung
im BMVEL beteiligt wurden oder zuvor anderweitig Gelegenheit
hatten, zu den weitreichenden Regelungen Stellung zu nehmen. Die
Kommunen sind sehr stark betroffen von den Auswirkungen dieses
Gesetzes. Glauben Sie daran, dass das Haftungsrisiko, selbst wenn
es im Gesetz in einer gewissen Art und Weise festgeschrieben wird,
Bestand haben wird oder rechnen Sie damit, dass auf die Kommunen
gewaltige Forderungen zukommen können?
Herr Prof. Dr. Horst, können Sie noch einmal ausführlich
erläutern, inwieweit dieses Gesetz grundgesetzwidrig sein
könnte.
Schließlich eine Frage an Herrn Klein vom Deutschen
Bauernverband. Sind Sie der Meinung, dass es sinnvoll ist, wenn
hier ein nationaler Alleingang beschritten wird? Wir sind in Europa
in einem gemeinsamen Markt mit offenen Grenzen. Befürchten Sie
hier Nachteile für die Produzenten und die Verarbeiter in
Deutschland und haben Sie nicht auch Sorge, dass das zarte
Pflänzchen Öko-Landwirtschaft gerade durch dieses
Verbraucherinformationsgesetz in Misskredit gebracht werden
könnte, wenn hier Informationen ins Internet gestellt werden
müssen, wo die koliformen Keime von Auslaufhühnern und
Bodenhaltungshühnern im Internet stehen und mit denen von
Käfighühnern verglichen werden. Denn nach meinen
Informationen sind die koliformen Keime bei Auslaufhühnern und
in der Bodenhaltung wesentlich höher. Hier fürchte ich,
dass die Öko-Landwirtschaft Probleme bekommt und Gleiches gilt
für Rückstände von Mykotoxinen in Getreideprodukten.
Haben Sie also Befürchtungen, dass die Öko-Landwirtschaft
hier Schaden erleidet?
Herr von Hausen, Bundesvereinigung der kommunalen
Spitzenverbände: Ich will zunächst auf die
Frage, warum die kommunalen Spitzenverbände nicht in die
Vorbereitung des Gesetzentwurfes einbezogen worden sind, eingehen.
Ich kann selbstverständlich nicht genau sagen, was in den
Köpfen der Beteiligten vorgeht, ich kann allerdings sagen,
dass es einige Indizien gibt, dass dies durchaus bewusst geschehen
ist. Nachdem wir Kenntnis von der stattgefundenen Anhörung im
Ministerium erhalten hatten, haben wir uns sofort mit Schreiben vom
28.02. bei der Ministerin beschwert. Deren Antwort datiert vom 27.
oder 28.03. und ist bei uns am 23.04. eingegangen. Dieses Schreiben
hat also offensichtlich im Ministerium sehr lange gelegen bis es
unterschrieben wurde, oder es ist ganz bewusst liegengelassen
worden, damit der Gesetzentwurf zunächst vom Kabinett
verabschiedet werden konnte, bevor wir dazu Stellung nehmen
konnten. So jedenfalls könnte sich das für den Beobachter
darstellen. Die Frage nach dem Haftungsrisiko und den Kosten
möchte ich zusammenfassend beantworten. Ich möchte
zunächst daran erinnern, dass ich eingangs gesagt habe, dass
wir die Zielsetzung des Gesetzentwurfes begrüßen, dass
wir allerdings glauben, dass die Praxis vor Ort in vielen Bereichen
zu wenig beachtet worden ist, so dass der Gesetzentwurf in der
vorliegenden Form einige Gefahren mit sich bringt. Dies gilt
insbesondere für die Kostenebene und es verwundert in diesem
Zusammenhang nicht, dass ein ausgewachsener Ministerialrat aus
Niedersachsen fordert, dass die Informationen
selbstverständlich alle erläutert werden müssen.
Dabei vertritt er ein Land, das dreimal hintereinander vom
Verfassungsgerichtshof in Bückeburg verurteilt worden ist, den
Kommunen die Kosten zu ersetzen, die ihnen durch die
übertragenen Aufgaben entstehen.
In diesem Zusammenhang möchte ich daran appellieren, dass man
in diesem Gesetzentwurf eine Regelung aufnimmt, die die Länder
zwingt, diese Aufgaben den Kommunen zuzuschreiben, weil wir
ansonsten in der Situation stehen, die wir auch in der Sozialhilfe
haben, dass wir ein Konnexitätsprinzip, was es zwischen Bund
und Kommunen nicht gibt, hier nicht zur Verfügung haben und
dass uns Kosten auferlegt werden, die wir nirgendwo einfordern
können. Wir schlagen deshalb vor, dass man in § 6 eine
möglichst weitgefasste Verordnungsermächtigung aufnimmt,
in der bestimmt wird, dass die Länder ausdrücklich den
Kommunen oder den dafür zuständigen Behörden die
Aufgaben übertragen.
Zur Frage der einheitlichen Erfassung von Daten innerhalb der
Bundesrepublik trifft es zu, dass im Moment die Daten
länderweit erfasst werden und dies auch in unterschiedlicher
Weise geschieht. Das sind Verwaltungsvorgänge, die in die
Zuständigkeit der Länder fallen. Eine Vereinheitlichung
könnte nur durch eine entsprechende Ländervereinbarung
erreicht werden. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass es
eine Bundeszuständigkeit gibt, eine entsprechende Regelung zu
fassen.
In der Haftungsfrage ist es so, dass wir in vielen Bereichen auf
Anfangsverdacht hin tätig werden. Es ist deshalb sehr wichtig,
dass solche Informationen erst herausgegeben werden, wenn das
Verfahren wirklich abgeschlossen ist. Erst dann wissen wir, dass
wir kein Haftungsrisiko eingehen. Ich habe eingangs schon darauf
hingewiesen, dass die Firmen häufig nachweisen, dass es sich
um einmalige Ausrutscher handelt und die entsprechenden
Maßnahmen getroffen worden sind.
Zu den Personalkosten kann ich von einer Hochrechnung für den
Kreis Schleswig-Flensburg berichten, in der man von zwei
Lebensmittelkontrolleuren und einer Verwaltungskraft ausgegangen
ist, was ein Bedarf von zweimal V b und einmal VI BAT von zusammen
130.000 Euro pro Jahr ausmacht. In Kreisen mit entsprechend vielen
zu überwachenden Betrieben ergeben sich noch weit höhere
Personalkosten. In der kurzen Zeit in der wir mit dem Gesetzentwurf
befasst waren, war es uns nicht möglich, genauere Recherchen
durchzuführen. Wir müssen uns deshalb auf punktuelle
Angaben beschränken. Insofern bitten wir darum, nicht von der
Intension des Gesetzentwurfs abzulassen, aber in den
Einzelfällen nochmals genau zu überlegen, wie man die
nachteiligen Folgen, die sich letztendlich auch für
Verbraucher ergeben, vermeiden kann. Hier müssen für die
Praxis eindeutige Regelungen gefunden werden und klare Festlegungen
erfolgen, wer die Kosten zu tragen hat.
Prof. Dr. Matthias Horst, Bund für Lebensmittelrecht
und Lebensmittelkunde e. V.: Zu der Frage von Frau
Widmann-Mauz, den konkreten Anspruch auf Informationen gegen
Behörden statt eines allgemeinen Anspruchs, Sie haben das
Beispiel allergene Stoffe genannt, betreffend, möchte ich nur
sagen, es bedarf insoweit überhaupt keiner Regelung in einem
Verbraucherinformationsgesetz, denn wir bekommen eine neue
Kennzeichnungsregelung auf europäischer Ebene, die gerade im
Hinblick auf eine verbesserte Information über potenzielle
allergene Stoffe geschaffen wird. Darüber hinaus kann ich mir
nicht vorstellen, dass hierauf von Verbrauchern angesprochene
Unternehmen in diesem hoch sensiblen Bereich die Auskunft
verweigern. Sie sprachen ferner die Kultur des Vertrauens zwischen
Behörden und Unternehmen an. Wenn wir ein solches Gesetz
bekämen, wäre es sicherlich dringend notwendig, die
Sicherungsmechanismen, die ich Ihnen in meinem einleitenden
Statement geschildert habe, einzubauen, damit eben eine Kultur des
Vertrauens aufgebaut werden kann und nicht Misstrauen gesät
wird. Hierzu gehört beispielsweise eine Verpflichtung der
Behörde, mit dem jeweiligen Unternehmen zu sprechen, bevor sie
eine Information freigibt, damit diese vollständig ist und
nicht Bruchstücke an den Verbraucher weitergegeben
werden.
Das Vertrauensverhältnis der Verbraucher zu den Unternehmen
hängt ganz entscheidend davon ab, wie vollständig und
sachlich richtig die Information ausgestaltet ist. Ich glaube, dass
das Gesetz vor allem dazu benutzt würde, vor allem bestimmte
Organisationen aufzumunitionieren, um das ganz deutlich und
vielleicht überzogen zu sagen.
Das Informationsverhalten der Unternehmen ist im
Lebensmittelbereich essentiell und entsprechend wirken wir auf eine
offene Kommunikation und Information auf jeder Stufe von der
Landwirtschaft bis zum Handel hin. Ich glaube nicht, dass es
sinnvoll wäre, hier eine gesetzliche Verpflichtung zu
schaffen, denn diese Verpflichtung würde den einzelnen Bauern
ebenso treffen wie einen internationalen Multi. Wir haben in
Deutschland allein fast 6.000 Unternehmen in der
Ernährungsindustrie und eine Vielzahl von
Handwerksunternehmen, und sie alle würden davon erfasst.
Möglich ist darauf hinzuwirken, das Informationsangebot zu
verbessern.
Wenn z.B. ein Unternehmen befragt wird nach Kinderarbeit, etwa bei
der Herstellung von Rohstoffen, dann wird eine Vielzahl von
Betrieben gar keine Antwort geben können und die Tatsache,
dass sie mangels Kenntnis keine Antwort geben können, wird
dazu benutzt, sie in die Ecke zu stellen. Auch das muss man mit
berücksichtigen. Ich will damit kein verbessertes
Informationsverhalten abwehren, im Gegenteil, aber ich will auf die
Probleme die damit einhergehen, aufmerksam machen.
Schließlich zum Thema der Verfassungsmäßigkeit des
Gesetzentwurfs. Ich glaube, da gibt es eine Reihe von
Ansatzpunkten, z. B. ob nicht ganz grundsätzlich ein
schutzwürdiges Interesse des Verbrauchers an der Information
das schutzwürdige Interesse der Unternehmen an einer
Nichtinformation überwiegen muss. Eine solche Regelung gibt es
beispielsweise in den Landespressegesetzen. Da ein Hauptnutzer des
Verbraucherinformationsgesetzes auch die Presse sein soll,
würden damit Landespressegesetze unterlaufen. Ich will das
hier im Einzelnen nicht bewerten, aber darum bitten, dass man
dieses mit beachtet. Es ist ferner aus Verfassungsgründen
selbstverständlich, dass vor einer eingreifenden
Tätigkeit einer Behörde das betroffene Unternehmen
angehört wird. Selbstverständlich ist auch, dass immer
das mildeste Mittel des Eingriffs gewählt wird und das vor
Veröffentlichung vor Informationen dem Unternehmen Gelegenheit
gegeben wird, sich selbst zu äußeren und die Information
selbst zu veröffentlichen.
Schließlich bestehen gegen die vom Bundesrat vorgeschlagene
Haftungsbeschränkung gegenüber Behörden auf Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit erhebliche verfassungsrechtliche
Bedenken. Dazu haben wir Ihnen ein Gutachten vorgelegt. Der
Hersteller hat einen verfassungsrechtlichen Anspruch darauf, nicht
mit falschen Informationen von Behörden konfrontiert zu
werden. Die Einschränkung der Staatshaftung für
Behörden ist wohl möglich, aber auch hierfür gibt es
Grenzen, die am Aspekt des öffentlichen Wohls gezogen werden
müssen. Danach geht es wohl nicht an, dass der Gesetzgeber
durch ein Gesetz zunächst ein Haftungsrisiko schafft, um
gleichzeitig zu sagen, die Behörde, die das Gesetz anwendet,
haftet dafür nicht.
Hinsichtlich der Veröffentlichung von positiven und
qualitätsbestimmenden Merkmalen durch Unternehmen gibt es
neben den von mir bereits angesprochenen Beispielen natürlich
auch Restriktionen in den Werberegelungen, die es den Unternehmen
schwer machen, Informationen über für den Verbraucher
relevante Dinge zu geben. Hierzu zählt z. B. das Verbot der
krankheitsbezogenen Werbung. Unternehmen dürfen z. B. nicht
darauf hinweisen, dass bestimmte Bestandteile ihres Produktes, z.
B. Vitamine, dazu geeignet sein können, das Risiko einer
Erkrankung zu vermindern. Insofern trifft es zu, dass das
Unternehmen im Bereich der Werbung nicht alles sagen kann, was es
gerne sagen möchte und was auch wissenschaftlich abgesichert
ist. Um die Verbraucherinformation zu verbessern, sollte man hier
über weitere Änderungen nachdenken.
Dietrich Klein, Deutscher Bauernverband: Die von
Herrn Deß angesprochene Frage des nationalen Alleingangs ist
natürlich ein großes Problem. Wir sind natürlich
froh, wenn Lebensmittelrückstandskontrollen nur in wenigen
Einzelfällen positiv befundet werden. Im internationalen
Wettbewerb wird dies allerdings nicht dafür genutzt, darauf
hinzuweisen, dass es nur sehr wenige Fälle gibt. Vielmehr
verweist die internationale Konkurrenz auf positiv befundete
Kontrollergebnisse, um zu publizieren, was in deutschen Produkten
alles enthalten ist.
Der nationale Alleingang hat aber noch einen anderen Kontext, den
wir morgen in der Anhörung zur Neuorganisation des
gesundheitlichen Verbraucherschutzes und der Lebensmittelsicherheit
auf der Tagesordnung haben. Danach soll die Risikokommunikation
nicht durch die Länder und die Gemeinden erfolgen, sondern sie
soll durch das Bundesinstitut erfolgen. Das heißt, wir
müssen hier einen etwas ganzheitlicheren Ansatz wählen,
um diesen Vorgang in den richtigen Kontext zu stellen. Deshalb kann
ich Ihnen nur viel Mut wünschen, wenn Sie in so kurzer Zeit
dieses Gesetz mit den komplexen Zusammenhängen wirklich
wasserdicht durchberaten wollen oder müssen. Ich hätte
hier erhebliche Bauchschmerzen, vor allem auch im Hinblick auf die
verfassungsrechtlichen Fragen, die durch die Stellungnahme des
Bundesrates hinsichtlich der Haftungsfreistellung aufgeworfen
wurden. Denn dieses bedeutet auch, dass nicht das Land, sondern der
einzelne Beamte haftet, was ihm aus meiner Sicht nicht zuzumuten
ist.
Die Frage von Herrn Abg. Deß zu den möglichen Nachteilen
für deutsche Öko-Erzeuger ist für mich delikat, weil
ich schnell in den Verdacht kommen könnte, dass der
Bauernverband versucht Öko zu benutzen, um gegen das
Verbraucherinformationsgesetz zu kämpfen. Dies ist aber ein
hervorragendes Beispiel dafür, dass im Einzelfall richtige
Detailinformationen zu einer ganz falschen Bewertung führen
können und sogar müssen. Die Tatsache, dass es
Rückstände gibt, ist für Öko-Getreide oder
konventionelles Getreide völlig unterschiedlich zu bewerten.
Für beide ist völlig unbestritten und kein Zweifel
erlaubt, dass beide Produkte gesundheitlich völlig
unbedenklich sind. Dies belegt, dass die Verbraucher nicht einen
Behördenanspruch, sondern ein Recht auf aufbereitete
nachvollziehbare und verständliche Informationen brauchen. Als
abschließende Bemerkung gestatten Sie mir darauf hinzuweisen,
dass ich nicht verstehen kann, dass hier nicht mehr von der
Information der Verbraucher vor Ort gesprochen wird. Das wäre
eine effiziente Einzelfallinformation, die hier völlig
untergeht.
Christopher Scholz, Markenverband: Zu der Frage
von Frau Widmann-Mauz zum Verhältnis der Unternehmen bzw. der
Verbraucher zu den Behörden kann ich sagen, dass das
kooperative Verhältnis, wie es bisher bestanden hat, sicher
nicht abbricht, aber es ist natürlich schon so, dass trotz der
im Gesetzentwurf vorgesehenen Fälle, in denen eine Information
nicht übermittelt werden soll, sicherlich auch bei uns Zweifel
bestehen, ob auf der Ebene, auf der diese Informationen abgefragt
werden, eine sachgerechte Entscheidung darüber immer erfolgen
kann. Dies gilt z. B. für den Bereich gewerblicher
Schutzrechte oder Betriebsgeheimnisse. Insofern wird das Gesetz
sicherlich von der Besorgnis begleitet sein, dass alles was vom
Unternehmen, sei es auch freiwillig, außerhalb von
Verwaltungsverfahren, wenn diese aufgenommen werden sollten,
übermittelt wird, dann eben auch einer Öffentlichkeit
zugänglich gemacht wird und diese Besorgnis wird das
Informationsverhalten sicher auch mit begleiten. Es geht auch in
den Bereich, in dem Informationen an Mitbewerber gegeben werden,
etwa zu Verfahren oder zu Erzeugerquellen, also Informationen die
vielleicht vom Unternehmen strenger als Betriebsgeheimnisse
bewertet werden als dies bei der Behörde der Fall sein
mag.
Das Verhältnis zum Verbraucher wird vor allem dann Schaden
nehmen, wenn etwas schief geht, d. h., wenn der Haftungsfall
eintritt. Hier ist das Problem in der Haftungsfrage selbst
möglicherweise auch nicht gelöst und der Schaden damit
nachhaltig. Darüber hinaus begibt sich das Unternehmen, gerade
als Markenartikler, einer Möglichkeit, das Vertrauen des
Verbrauchers auch dadurch zu erlangen, dass er eine offene
Informationspolitik ohne Gesetzeszwang praktiziert. In den
Fällen, in denen Unternehmen kooperativ sind und sich um ein
partnerschaftliches Auskommen mit dem Verbraucher bemühen,
entfällt für das Unternehmen die hieraus zu gewinnende
Vorteilnahme.
Die Frage von Frau Teuchner, ob die Bereitschaft der
Markenartikelindustrie offen mit Informationen umzugehen, nicht
durch die VZBV-Aktion widerlegt sei, ist aus unserer Sicht zu
verneinen. Wenn man diese genau liest, ist zwar deutliche Kritik im
Vordergrund, aber es wird nicht bestritten, dass in einer ganzen
Reihe von Unternehmen Informationen gegeben werden und wenn man
sich die einzelnen Antworten anschaut ist es so, dass nicht
böser Wille oder Blockadepolitik, sondern eben häufig
mangelnde Effizienz oder Routine im Umgang mit solchen Anfragen
ursächlich dafür waren, dass Informationen nicht immer so
ausgefallen sind wie sie sollten. Hier ist die
Markenartikelindustrie auch selbstkritisch und daran interessiert,
Verbesserungen herbeizuführen und einen Dialog mit den
Verbraucherverbänden zu führen.
Bei der Frage, ob eine Selbstverpflichtung reicht oder eine
gesetzliche Regelung besser ist gilt für den Bereich
Gesundheitsschutz und Sicherheit, dass dort wo nötig,
Verbraucherschutz vorgeht. Wenn hierfür eine gesetzliche
Regelung notwendig ist, können wir das akzeptieren. Wir sehen
nur keine Notwendigkeit, Informationen für ethische
Entscheidungen des Verbrauchers gesetzlich zu regeln. Hier sind wir
der Auffassung, es sollte dem Markt überlassen bleiben,
diejenigen Unternehmen durch den Verbraucher zu honorieren, die bei
einer offenen und ehrlichen Informationspolitik die
Kaufentscheidung des Verbrauchers als Belohnung erringen
können.
Zur Frage von Frau Koch zu modernen Informationssystemen kann ich
unmittelbar nichts sagen. In den Niederlanden ist eine
Selbstbindung der Industrie für Informationen gerade umgesetzt
worden. Dort kann man zentral über den Niederländischen
Markenverband Informationen zu bestimmten Produkten abrufen.
Einzelheiten hierzu sind mir momentan aber nicht bekannt.
Richtig ist aus unserer Sicht, dass gerade die starken Marken eine
offensive Informationspolitik praktizieren, wenngleich nicht in
allen Bereichen. Nicht nur, weil sie an Werberestriktionen gebunden
sind, sondern auch, weil sie z. B. das Image beim Verbraucher mit
berücksichtigen. So ist es z. B. bei Waschmaschinen und
anderen Elektrogeräten so, dass eigentlich alle sehr gute
ökologische Leistungsdaten haben, aber trotzdem keinesfalls
alle damit werben, weil dem die Einsicht zugrunde liegt, dass man
nicht in eine Öko-Ecke gesteckt werden möchte, sondern
seinen Werbeauftritt auf einen anderen Aspekt konzentrieren
möchte.
Zur Verbändevereinbarung und zur Wettbewerbszentrale
vielleicht noch ein Wort. Das Irreführungsproblem bei der
Werbung ist im Gesetzentwurf ursprünglich auch enthalten
gewesen. Das funktioniert in der Praxis ganz gut. Wettbewerber
haben ein Interesse daran, gerade im Bereich der Werbebehauptungen
darauf zu achten, dass sich Wettbewerber keinen Vorteil dadurch
verschaffen, dass mit unzutreffenden oder irreführenden
Angaben geworben wird. Deswegen war unser Petitum auch darauf
gerichtet, diese Klausel aus dem Gesetzentwurf herauszunehmen, weil
wir der Auffassung sind, dass es hier bereits einen ausreichenden
Rechtsschutz auch für Verbraucher gibt. Das
Ordnungswidrigkeitengestz (OWiG) gilt, wenngleich es nicht
ausdrücklich drinsteht, zumindest faktisch auch für die
Verbraucher. Vielleicht wird dies bei der Modernisierung des OWiG
auch noch deutlicher.
Dr. Josef Falke: Ich beginne mit der Frage, ob
eine einzelgesetzliche Regelung zu bevorzugen sei und möchte
sie klar verneinen. Im Bereich der Produktsicherheit, was
technische Güter angeht, und im Bereich der
Lebensmittelregelung haben wir übereinstimmende Tendenzen auf
europäischer Ebene, nämlich den vielen
bereichsspezifischen Regelungen ergänzende Rahmenregelungen
zur Verfügung zu stellen, die für alle Einzelprodukte die
Fragen regeln, die sich generell stellen. Die Frage des Zugangs zu
Informationen ist eine solche Frage. In der Etikettierungsregelung
für spezifische Produkte werden die Etikettierungen
vorgeschrieben, die Informationen obligatorisch ungefragt allen
Verbrauchern überbringen sollen. Wir haben es hier mit
Informationen zu tun, die Verbraucher oder ihre Verbände
maßgeblich für ihre Kaufentscheidung halten oder mit
denen sie politisch agieren wollen. Das ist tatsächlich besser
in einem Rahmengesetz geregelt, das sich mit den Lebensmitteln und
technischen Produkten befasst. So bekommt man auch eine
Parallelität hin zu den einschlägigen Regelungen wie
Produktsicherheitsrichtlinien und die schon angesprochene
Verordnung aus dem Januar 2002 zur Schaffung der europäischen
Behörde für Lebensmittelsicherheit. Zum Vergleich mit den
Informationsfreiheitsgesetzen kann ich Folgendes sagen: Die
Bundesrepublik Deutschland scheint hier ein sehr
entwicklungsfähiges Land zu sein. Ich meine jedoch, dass von
verschiedener Seite Nachteile zu befürchten sind. Der
größte Nachteil besteht meines Erachtens darin, dass,
wenn keine Informationskultur von den verschiedenen Beteiligten
entwickelt werden kann, mangels wiederholter Praxis, dass dann
Vorgänge, die in die Medien geraten, skandalträchtig
werden, obwohl das von der Sache her nicht gerechtfertigt ist. Man
muss sich in Informationsvorgänge dauernd einüben.
Informationsvorgänge müssen zahlreich werden, damit sie
sachhaltig werden. Dann ist es auch klar, dass es nicht darum geht,
bestimmte Unternehmen oder Anbieter von Dienstleistungen
anzuschwärzen, sondern dass es darum geht, Risiken für
die Verbraucher kooperativ abzuklären und darüber so zu
informieren, dass Verbraucher nicht überzogen reagieren.
Verbraucher müssen hierfür auch Hintergrundinformationen,
etwa über allergene Stoffe oder Umweltkontaminanten in einem
Basisumfang vermittelt bekommen, damit sie einzelne Informationen
besser einstufen können.
Der Vorsitzende: Gestatten Sie mir eine
Zusatzfrage. Es ist hier mal gesagt worden, wir hätten einen
Analphabetismus in der Küche. Ist dann nicht Voraussetzung,
dass man die Information entweder anders aufarbeitet oder vom
Verbraucher verlangt, dass er sie auch anders begreifen kann?
Dr. Josef Falke: Ich finde diese Anmerkung
berechtigt und die Alphabetisierungskampagne wird tatsächlich
in den Ländern betrieben, die sich dazu entschlossen haben,
konsumer information gate ways einzurichten und über das
Internet Informationszugänge, die von verschiedenen
Behörden existieren, zusammenzuführen. Hier gibt es
Informationen, die tatsächlich etwa einzelne
Rückrufaktionen oder Warnungen betreffen, das sind
Behördenmitteilungen über die Aktionen, die mit dem
Unternehmen abgestimmt sind und in denen im Prinzip die Information
der Behörde eine zusätzliche ist, um die
Rückrufaktion, die freiwillig von den Unternehmen
durchgeführt wird, mit den abgesprochenen Informationen an
einen möglichst großen Nutzerkreis weiterzugeben.
Daneben existieren aber dann auch allgemeine
Hintergrundinformationen über allgemeine Problematiken wie
Zusatzstoffe oder Umweltkontaminanten oder dergleichen. Damit
können die einzelspezifischen Vorgänge zu den allgemeinen
Hintergrundinformationen ins Bild gesetzt werden.
Zu der verfassungsrechtlichen Absicherung des
Verbraucherinformationszuganges lässt sich sagen, dass die
Länder, die ein umfassendes Informationsfreiheitsrecht
eingeführt haben, dieses auch verfassungsrechtlich abgesichert
haben. Zum Teil beruht das darauf, dass wir ganz junge Verfassungen
haben und in Verfassungen schreibt man häufig die leidvollen
Erfahrungen der Vergangenheit nieder. Die
Informationsfreiheitsrechte sind jeweils so ausgestaltet,
kooperativ mit den Unternehmen wahrgenommen zu werden. Keines der
mir bekannten Informationsfreiheitsgesetze käme auch nur
entfernt auf die Idee, denjenigen Behörden, die Informationen
zugänglich machen, Einschränkungen im Haftungsumfang
einzuräumen. Die Behörden, die Informationen
zugänglich machen, müssen sorgfältig recherchieren
und können dann auch darauf verzichten, sich
Haftungsausschlüsse bescheinigen zu lassen. Behörden
müssen verfassungsrechtliche Grundsätze bei ihrer
Informationstätigkeit beachten. Das ist hier zutreffend
ausgeführt worden. Ich möchte verallgemeinern, dass sie
vor allem den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mit
den verschiedenen bekannten Unterabstufungen zu beachten
haben.
Die Neuregelung des Lebensmittelrechts, die skandalangestoßen
ist, aber weit darüber hinaus jetzt doch Lernfähigkeit
bewiesen hat, wird von der Bundesrepublik Deutschland erfordern,
dass sie ihre interne Behördenstruktur spiegelbildlich zu der
europäischen Struktur anordnet, insbesondere was das Risiko
Management, die Risikoabschätzung und die Risikokommunikation
angeht. Das bedeutet aber auch, dass die entsprechenden Stellen
parallele Befugnisse haben müssen, wie das auch etwa die
Europäische Lebensmittelbehörde hat und wie das die
Risikokommunikationserfordernisse dieser Verordnung vorsehen.
Selbst wenn die Verordnung unmittelbar in den einzelnen
Mitgliedstaaten gilt, muss die Bundesrepublik erhebliche
organisatorische Angleichungsmaßnahmen vornehmen und vor
allem behördliche Praktiken entwickeln, mit denen sie mit
diesen offenen Kommunikationsstrukturen umgehen kann.
Zur Frage, wieviel Vorbereitungszeit für ein solches komplexes
Vorhaben nötig ist, bei dem die Einschätzungen auch so
kontrovers sind, kann ich Folgendes sagen: Es gibt eine
Kontroverse, bei der man recht einfach verfahren kann, das ist die
bei der es darum geht, das ganze abzulehnen oder durchzusetzen.
Dies ist eine einfache Situation für eine
Mehrheitsentscheidung. Das scheint mir hier aber nicht der Fall zu
sein, denn die Argumentationslage ist verworrener. Insofern gilt
es, viele Einzelpunkte aufeinander abzustimmen und viele
Teilnehmer, Behörden, Verbraucherverbände und Unternehmen
kooperativ zusammenwirken zu lassen. Dafür wäre meines
Erachtens mehr Zeit, als in dieser Legislaturperiode zur
Verfügung steht, wünschenswert. Wenn es dann doch aus
politischen Gründen durchgesetzt werden sollte, dann sollte
man Öffnungsklauseln vorsehen, und aus den
Auseinandersetzungen um den Anwendungsbereich eine Tugend machen
und versuchen, den Bereich der Lebensmittelsicherheit und der
lebensmittelbezogenen Informationen konsequent zu regeln. Bei
dieser Beschränkung, die jetzt im Entwurf angelegt ist, sollte
man die Angleichungsmaßnahmen genauer zurückstufen, die
durch die Verordnung und Umsetzung der allgemeinen
Produktsicherheitsrichtlinie erforderlich sind.
Dr. Christian Grugel: Zur Frage von Frau
Höfken, inwieweit hier eine Einbindung in das
Gemeinschaftsrecht der Europäischen Union notwendig ist und
wie diese geleistet werden kann und inwieweit wir hier zu einer
Gleichbehandlung deutscher und anderer Unternehmen kommen, halte
ich es für notwendig, hier eine Notifizierung dieses Gesetzes
vorzunehmen und glaube, dass die Notifizierung zwangsläufig
dazu führen wird und ein Anstoß dafür ist, eine
einheitliche europäische Regelung zu schaffen. Insofern geht
das in die richtige Richtung. Das Entscheidende wird sein, wie man
mit diesem Gesetz in der Praxis umgeht. Dazu sind aus meiner Sicht
drei notwendige Elemente zu bedenken.
Zum einen muss das Verwaltungsverfahren ein Ausschlusskriterium
sein, dann müssen Informationen erläutert sein, auch wenn
das den kommunalen Spitzenverbänden Probleme macht. Zum
zweiten ist das hier eine Aufgabe des übertragenen
Wirkungskreises und da das Urteil aus Bückeburg angesprochen
worden ist, erlauben Sie mir den Hinweis, dass dies dazu
geführt hat, dass die Zuweisungen an die Kommunen reduziert
wurden. Der dritte Punkt der notwendig ist, ist der, dass wir hier
die Informationen in einer Form verfügbar halten, die es den
Behörden leicht macht, sie anzubieten. Das bedeutet, dass man
hier auf Datenträger zurückgreifen wird und um dies
sachgerecht durchzuführen ist Voraussetzung, dass eine
Kommunikation zwischen Behörde und Unternehmen
durchgeführt wird. Ein Vorrang des Unternehmens zu
informieren, wenn die Behörde ansonsten aktiv warnen
würde, ist zweckmäßig. In den anderen Fällen
wird man, um abprüfen zu können ob es sich um ein
Betriebsgeheimnis handelt oder wettbewerbsrelevante Informationen
berührt sind, in sehr vielen Fällen Rücksprache mit
den Unternehmen suchen und Absprachen treffen müssen. Insofern
besteht in der Tat ein gewisser Aufwand und es ist daher
zweckmäßig, so etwas auf Landesseite im Vollzug zu
bündeln.
Damit komme ich im Prinzip zu der zweiten Frage die an mich
gerichtet war, wie man den bundeseinheitlichen Vollzug hier
sicherstellen kann. Zu Recht stellt das Gesetz darauf ab, dass die
Informationen dort abgefragt werden sollen, wo sie vorhanden sind.
Man kann auf der Bundesebene nach meiner Überzeugung nur einen
Bericht erstellen, der einen Überblick gibt. Die
Einzelinformation, welche Behörde welche Erkenntnis gewonnen
hat, wird man, selbst wenn man Informationen verdichtet und sie gut
aufbereitet, nie so zur Verfügung haben, dass man sie
bundesweit anbieten kann. Insofern kann man versuchen, dies auf der
Länderebene zu tun und der Gesetzentwurf trägt dem auch
Rechnung, indem er vorsieht, dass ein Bericht auf Bundesebene
angefertigt wird, aber nicht die Einzelinformation auf Bundesebene
angeboten wird. Notwendig ist allerdings eine Angleichung der
Maßnahmen der Länder. Dafür brauchen wir eine
allgemeine Verwaltungsvorschrift, die für den Bereich der
Lebensmittelüberwachung in der Vorbereitung ist, so dass auch
die Erkenntnistiefe, die in den Ländern gewonnen wird, sehr
viel ähnlicher wird. Es ist ein notwendiger Schritt, um dieses
Gesetz auch wirklich mit Inhalt füllen zu können.
Der Vorsitzende: Frau Heidemann-Peuser, vielleicht
können Sie neben der Beantwortung der Fragen von Herrn Lamp
und von mir auch auf den Analphabetismus mit eingehen, dieses
Schlagwort stammt von Ihrer Präsidentin bei einer
Veranstaltung hier vor Ort und vielleicht auch sagen, wer
zuständig wäre, gegen diesen Analphabetismus etwas zu
tun.
Elke Heidemann-Peuser: Das knüpft an sich
schon an die Frage an, die Herr Lamp mir gestellt hatte, also
inwieweit wollen sich die Verbraucherverbände hier
möglicherweise aus der Verantwortung ziehen, indem sie darauf
hinweisen, die Behörden und die Unternehmen seien künftig
verantwortlich für die Verbraucherinformation. Ganz das
Gegenteil ist natürlich der Fall. Die Verbraucherverbände
sehen für sich eine besondere Stellung in diesem
Gesamtzusammenhang der Verbraucherinformation. Es gehört zu
ihren satzungsgemäßen Aufgaben, die
Verbraucherinteressen durch Aufklärung und Beratung
wahrzunehmen. In jedem Bundesland ist auch bekanntlich eine
Verbraucherzentrale, ggf. mit diversen Beratungsstellen in den
einzelnen Orten vertreten, in denen sehr viel Sachverstand, gerade
auch in Fragen der Ernährung vorhanden ist. Viele
Verbraucherberatungskräfte sind von Haus aus
Ökotrophologen und hier besteht ein
Verbraucherberatungsschwerpunkt seit Beginn dieser Bewegung. Wir
wollen hier auch ein besonderes Zugangsrecht zu den Informationen,
die bei den Behörden vorhanden sind haben und ggf. auch bei
den Unternehmen, um die Verbraucher dann noch besser beraten zu
können. Die hier bereits angesprochene Aufbereitung von Daten
ist eine Aufgabe, die die Verbraucherzentralen im Rahmen ihrer
Aufgabenstellung auch sehr gut übernehmen können.
Deswegen sehen wir uns hier durchaus als Ergänzung und wollen
uns keineswegs ausgrenzen.
Zur Frage des Vorsitzenden zu den Anforderungen an eine
zulässige Werbung bin ich möglicherweise missverstanden
worden. Selbstverständlich ist gegen eine verschönernde
Werbung an sich nichts zu sagen. Wir sind hier im Bereich des
Wettbewerbsrechts und ich habe darauf hingewiesen, dass die Werbung
mit ihren Aussagen bis zu den Grenzen der Irreführung nach
§ 3 OWiG zulässig ist oder der Sittenwidrigkeit nach
§ 1 OWiG. Nur haben wir hier andere Maßstäbe, z. B.
ist das Weglassen von Informationen erst dann eine Irreführung
im Sinne von § 3 OWiG, wenn dadurch eine falsche Vorstellung
bei dem Empfänger geweckt wird. Werbung darf sicher von ihrer
Natur her das Schöne herausstellen, nur muss sie trotzdem
wahrheitsgemäß sein. Gerade dem Recht des Unternehmers,
das er für sich in Anspruch nimmt, wenn er das Positive
herausstellt, muss eine Pflicht zur wahrheitsgemäßen
Information gegenüberstehen. Gerade deshalb ist er auch in der
Pflicht, bei Nachfragen über Einzelheiten aufzuklären. Zu
der mehrfach angesprochen Studie ist es sicherlich so, dass die
Ergebnisse deshalb vielfach unzureichend waren, weil man bei den
Firmen offensichtlich nicht darauf eingestellt war, diese
Verbraucheranfragen zu beantworten. Aber auch das ist sicherlich
schon aufschlussreich, dass Unternehmen erkennen sollten, dass sie
hier mehr tun müssen, den Informationsanspruch der Kunden
ernst nehmen und diesen nicht nur der Kulanz halber erfüllen.
Hier würde ein Anspruch im Gesetz einem solchen
Auskunftsersuchen einen ganz anderen Stellenwert verschaffen.
Peter Knitsch: Die erste Frage hatte Herr Lamp
gestellt, inwieweit durch dieses Gesetz Skandalisierungen in
bestimmten Bereichen Vorschub geleistet wird und inwieweit dieses
Gesetz dazu beitragen wird, Hysterien, die es gerade im
Zusammenhang mit Vorkommnissen im Lebensmittelbereich in den
letzten Jahren gegeben hat, vorzubeugen. Ich hoffe und glaube, dass
Letzteres in der Tat der Fall ist. Eine offenere und transparentere
Informationspolitik der Unternehmen und klar geregelte
Ansprüche von Verbraucherinnen und Verbrauchern und
insbesondere auch weitgehendere Informationsrechte auf klarer
Rechtsgrundlage werden dazu beitragen, solche Skandalisierungen in
der Zukunft weiter zurückzudrängen. Ich will dies an
einem Beispiel deutlich machen.
Schon heute ist es so, dass die
Lebensmitteluntersuchungsämter, sowohl die staatlichen als
auch die kummunalen, in Nordrhein-Westfalen regelmäßig
Jahresberichte herausgeben. Im Rahmen dieser Jahresberichte mit
vielen Daten und Zahlen informieren sie über ihre Erkenntnisse
im abgelaufenen Jahr. Derjenige, der das auswertet, zum Teil macht
das die Presse heute schon, stellt eben fest, dass im Laufe eines
Jahres viele Verstöße gegen Verbraucher schützende
Normen von diesen Untersuchungsämtern festgestellt worden
sind. Zum Teil solche mit Gesundheitsbezug, zum Teil mit
Täuschungsbezug. Und schon heute rufen die Medien bei den
Untersuchungsämtern oder bei uns an, um nähere
Einzelheiten und Informationen zu diesen Vorgängen zu
erfragen. Diese näheren Informationen müssen wir ihnen
heute in vielen Fällen verweigern, weil es dafür keine
entsprechende Rechtsgrundlage gibt.
Wenn etwa über erhöhte Schwermetallkonzentration in
Spielzeugen berichtet wurde und Angaben zu den betroffenen
Herstellern oder Produkten gestellt werden, dann müssen wir
die Auskunft heute hierzu verweigern. Das erzeugt bei den Medien
natürlich eher Misstrauen und führt dazu, dass diese
Themen im Regelfall erst recht aufgegriffen werden und das zum Teil
dann auch in einer Form, die nicht mehr sachgerecht ist. Insofern
glaube ich, dass erweiterte Informationsrechte der
öffentlichen Hand und erweiterte Auskunfts- und Fragerechte
von Verbraucherinnen und Verbrauchern, entsprechenden
Organisationen und den Medien eher dazu beitragen werden, solche
Skandalisierungen, da wo sie nicht gerechtfertigt sind, in der
Zukunft zu vermeiden.
Die zweite Frage zielte auf die Frage des Schadensersatzes bei
mangelnder Sorgfaltspflicht der Recherche und der Befürchtung,
dass es durch ein Gesetz eher zu Wettbewerbsverzerrungen und
Wettbewerbsnachteilen für die deutsche Wirtschaft kommen wird.
In Bezug auf Schadensersatz verstehe ich die Diskussion hier nicht
so recht. Selbstverständlich gilt auch in diesem Bereich die
allgemeine Amtshaftung und weitergehende Ausschlussrechte
würde ich nicht für richtig halten und sie sind auch im
Gesetzentwurf der Bundesregierung nicht vorgesehen. Dieser Bereich
wird dort überhaupt nicht geregelt, genauso wenig wie
übrigens im Umwelt- und Informationsgesetz, das seit Anfang
der 90er Jahre gilt. Ebenso wenig wird dies in den
Informationsfreiheitsgesetzen der Länder geregelt. Jedenfalls
in Nordrhein-Westfalen gibt es dort keine entsprechende Regelung.
Das war auch verzichtbar, weil eben die allgemeine Amtshaftung in
diesem Bereich auch gilt.
Wenn also Behörden vorsätzlich oder grob fahrlässig
falsch informieren ist es so, dass sie selbstverständlich
unter den Voraussetzungen der Amtshaftung haften. Im Übrigen
sind Behörden selbstverständlich auch heute schon
bemüht, sorgfältig zu recherchieren und dies gelingt
ihnen in aller Regel auch.
Den Generalverdacht, Behörden recherchierten schlampig und es
kämen Informationen an die Öffentlichkeit, die sich im
Nachhinein als nicht wahr herausstellen, möchte ich
zurückweisen, wenngleich dies in Einzelfällen vorkommen
kann, weil natürlich auch Behörden sich irren
können. In der Regel wird aber sorgfältig und gut
recherchiert und insbesondere die Untersuchungseinrichtungen der
öffentlichen Hand weisen einen hohen qualitativen Standard
auf. Das haben gerade die Untersuchungen über BSE
ausdrücklich belegt. Jedenfalls gilt dies für
Nordrhein-Westfalen.
Wettbewerbsverzerrungen kann ich im Übrigen nicht erkennen,
ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass dem Zusammenbruch ganzer
Branchen eher damit begegnet werden kann, dass man Verfehlungen
einzelner Unternehmen klar benennt. Auch im internationalen
Vergleich kann ich nicht erkennen, dass es zu großen
Problemen kommen wird. Die internationalen Produzenten, die
über Niederlassungen in Deutschland verfügen oder ihre
Produkte über Händler in Deutschland vertreiben, sind
auch auskunftspflichtig, weil das Verbraucherinformationsgesetz
für sie genauso gilt. Zudem hat z. B. in den Vereinigten
Staaten ein sehr viel weitergehendes Informationsfreiheitsgesetz,
als es die Bundesregierung jetzt für den
Verbraucherschutzbereich hier anstrebt, seit Anfang der 60er Jahre
Geltung und die Vereinigten Staaten sind im Lebensmittelbereich der
weltweit größte Exporteur. Dort ist durch den
entsprechenden freedom of information act die Wirtschaft keineswegs
zusammengebrochen und auch die Exportwirtschaft wird dadurch nicht
beeinträchtigt.
Die dritte Frage von Frau Teuchner zielte auf die Kostenfrage des
Informationsfreiheitsgesetzes. Es ist so, dass sich das
Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen an die Regelung
anlehnt, die demnächst auch auf europäischer Ebene
Geltung haben wird für die Umweltinformationsrichtlinie. Diese
ist im Wesentlichen so ausgestaltet, dass Gebühren erhoben
werden können. Deswegen sollte das
Verbraucherinformationsgesetz meines Erachtens auch so ausgestaltet
werden, dass es in das Ermessen der Länder gestellt wird, ob
sie Gebühren erheben oder nicht. Dass die Gebühren
selbstverständlich nur in einer Höhe erhoben werden
dürfen, dass sie keinen erdrosselnden Charakter haben,
versteht sich von selbst. Insbesondere die Einsichtnahme von
Informationen vor Ort sollte gebührenfrei gestaltet werden,
ebenso wie Informationen, die vom Internet abgerufen werden.
Die vierte Frage vom Vorsitzenden zielte auf die Haftungsregelungen
in den Vereinigten Staaten. Nach den Ausführungen, die ich
dort insbesondere von den Vertretern der FDA (Food and Drug
Administration) gehört habe, ist es so, dass man die Situation
in den USA wie folgt einschätzt: Durch das sehr rigide
Produkthaftungsrecht sind die Unternehmen dort in den letzten 20/30
Jahren zu einer viel transparenteren Kultur der
Informationswiedergabe gekommen, d. h., Unternehmen geben von sich
aus sehr viele Informationen nach draußen, weil sie davon
ausgehen, dass sie bei etwaigen Haftungsprozessen dadurch Vorteile
haben. Sie können darauf verweisen, dass sie die
Informationen, die möglicherweise irgendwann einmal Gegenstand
eines Haftungsprozesses werden, auch in der Vergangenheit schon
gegeben haben. Das hat nach Einschätzung der FDA dazu
geführt, dass Unternehmen viel stärker als hier
Informationen weitergeben und zum Zweiten dazu geführt, dass
die anfänglich vorhandene Kritik der Unternehmen an dem
freedom of information act dort weitgehend verstummt ist.
Ich möchte auf den Punkt, den Herr Grugel vorhin genannt hat,
nämlich die Frage des Ausschlusses von Informationen
während eines Verwaltungsverfahrens, noch kurz eingehen. Ich
möchte entschieden davor warnen, eine solche Regelung in das
Verbraucherinformationsgesetz hineinzunehmen. Denn das würde
bedeuten, dass Verbraucherinnen und Verbraucher gerade in einer
Situation, in der sie Informationen der öffentlichen Hand
erwarten, und das sind die aktuellen Fälle, in denen die
Verwaltungsverfahren noch laufen um evtl. Missstände
abzustellen, Informationen von Seiten der öffentlichen Hand
nicht gegeben werden müssten. Ich glaube, dass es keiner
verstehen wird, wenn z. B. Behörden unmittelbar nach Entstehen
der BSE-Krise hätten sagen müssen, es bestehe zwar
grundsätzlich ein Anspruch auf Information, aber im Moment
müssen wir dies nicht sagen, weil ein entsprechendes
Verwaltungsverfahren gegen die betroffenen Firmen läuft.
Der hier gegebene Hinweis, die Unternehmen würden freiwillig
selbst informieren, trifft zwar zu, aber sie informieren in der
Regel nur dann, wenn die Informationen für das Unternehmen
positiv sind. Ich habe jedenfalls in meiner beruflichen Praxis noch
kein anderes Beispiel erlebt. Unternehmen werben in der Tat mit
guten Ergebnissen der Stiftung Warentest, ich habe aber noch nicht
gesehen, dass ein Unternehmen sein Produkt mit dem Hinweis bewirbt,
das Ergebnis der Stiftung Warentest sei leider mangelhaft gewesen.
Dies ist aber genau der Bereich, über den wir hier
sprechen.
Brigitte Jäger: Die erste Frage, bei der es
um die Sorgfalt der Behördenvertreter geht, kann ich
dahingehend beantworten, dass sich alle bemühen, so
sorgfältig wie möglich zu arbeiten und es ist an sich
selbstverständlich, dass ein amtliches Gutachten vorliegt,
bevor man mit Informationen an die Öffentlichkeit geht.
Jedenfalls posaunt man nicht leichtfertig in die
Öffentlichkeit, was man anschließend nicht beweisen
kann. Der Schutz der Wirtschaft vor Missbrauch ist im Gesetzentwurf
mit verankert, und hier geht es darum, dass der Schutz des
geistigen Eigentums, insbesondere Urheberrechte, dem
Informationsanspruch entgegenstehen und außerdem Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnisse und wettbewerbsrelevante
Informationen, die ihrem Wesen nach Betriebsgeheimnissen
gleichkommen, vor Offenbarung geschützt werden sollen und
dahinter der Informationsanspruch der Verbraucherinnen und
Verbraucher zurückstehen muss. Zur Frage der
Wettbewerbsverzerrung kann ich nur wiederholen, was schon gesagt
worden ist. Man sollte dies positiver sehen, denn man kann sich von
schwarzen Schafen einer Branche auch eher absetzen. Dies ist
momentan überhaupt nicht möglich. Nehmen Sie das Beispiel
Glyzerin in Wein, das in sehr hochrangigen renommierten Unternehmen
nachgewiesen wurde. Glyzerinzusatz bringt einen ausdrucksstarken
Geschmack bei Wein, der vielleicht von Natur aus nicht vorhanden
ist.
Wenn man hier darauf hinweisen kann, dass bestimmte Betriebe
hiervon nicht betroffen sind, hat das für diese Betriebe
Zweifels ohne Schutzwirkung.
Die angesprochene bundeseinheitliche Erfassung der Daten und die in
dem Zusammenhang behauptete unterschiedliche Kontrolldichte der
Länder möchte ich verneinen. Wir haben in ganz
Deutschland eine Untersuchungsdichte von 5,7 Proben auf 1.000
Einwohner pro Jahr. Das sind für Berlin etwa 20.000 Proben.
Davon fünf Lebensmittelproben und 0,7 für
Bedarfsmittelgegenstände. Was konkret an diesen Proben
untersucht wird, mag unterschiedlich sein, aber genau dies ist die
Vielfalt der Länder, die sich ergänzt. Wir haben in
Deutschland das föderative System und die
Lebensmittelüberwachung ist Ländersache. Wir haben aber
natürlich auch schon Ansätze dies zu vereinheitlichen,
wir haben teilweise Programme die bis zur EU weitergegeben werden
müssen und es gibt den Gesetzentwurf zur Neuorganisation des
gesundheitlichen Verbraucherschutzes und der
Lebensmittelsicherheit, in dem ein Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit geschaffen wird.
Zu den Aufgaben dieses Amtes gehören die Vorbereitung
allgemeiner Verwaltungsvorschriften zur Durchführung von
Gesetzen. Ich denke, dass hier auch die Anforderungen an die
Durchführung dieses Gesetzes festgelegt werden können, so
dass dies bundeseinheitlich erfolgt. Dies ist auch das Bestreben
der Länder.
Abg. Ulrich Heinrich: Es sind eine ganze Reihe
kritischer Fragen gestellt worden und die Antworten waren dann auch
entsprechend. Ich habe große Sorgen, dass wir mit diesem
Gesetz einen Schnellschuss bekommen, der uns nachher keine
große Freude bereitet. Das Resümee für mich aus
dieser Anhörung ist, dass der von der Bundesregierung
vorgesehene Zeitplan, mit einer abschließenden Beratung im
Ausschuss und der anschließenden Zweiten und Dritten Lesung
im Plenum noch im Mai bei dem jetzigen Stand der Gesetzgebung und
der Diskussion hierzu, dies nicht hergibt. Es wäre nach meinem
Dafürhalten absolut unverantwortlich, wenn ich hier von den
Sachverständigen höre, dass nachdrückliche
Verfassungsbedenken bestehen und mir die Worte von Herrn Prof. Dr.
Falke vor Augen führe, halte ich das in diesem Verfahren nicht
für akzeptabel. Ich möchte sehr darum bitten, dass wir
hier mehr Luft hereinbekommen, um die Dinge seriöser behandeln
zu können.
Der Vorsitzende: Das war eine Stellungnahme, die
in die Ausschuss-Sitzung gehört. Ich würde aber gern zwei
Dinge hier ansprechen, einmal die Frage der Sorgfalt und der
Haftung, zu der Sie, Herr Knitsch, eine andere Auffassung haben.
Sie haben gesagt, da wird etwas hochgespielt in den Stellungnahmen
der kommunalen Spitzenverbände und auch des Bundes für
Lebensmittelrechts und des Markenverbandes. Vielleicht können
Sie das nochmal etwas erläutern.
Der zweite Punkt ist etwas, das aus dem Statement von Frau
Jäger kam. § 7 regelt in einem Bundesgesetz deswegen
Gebühren und Auslagen, damit eben Kostendeckung sichergestellt
ist. Das ist wohl auch die Begründung dafür. Nun haben
Sie, Frau Jäger, gesagt, Kostendeckung wird es wohl nicht
geben. Das heißt, die Länder werden dort auf Kosten
sitzen bleiben. Nach § 7 Absatz 2 des Gesetzentwurfs
heißt es auch, dass die gebührenpflichtigen
Tatbestände und die Gebühren zu bestimmen sind. Ich
würde Sie deshalb bitten, darauf nochmal einzugehen.
Burghard von Hausen: Es geht hier um die
Ausschlussgründe des § 4 Absatz 3 des Gesetzentwurfs. Das
Tätigwerden von Kontrollbehörden, insbesondere im
Lebensmittelbereich wird häufig durch einen Anfangsverdacht
ausgelöst, der noch keine abschließende Beurteilung
erlaubt. Bei Bekanntgabe zieht das aber bereits negative Folgen
für die Betroffenen nach sich. Wir würden deshalb gerne
vorschlagen, in diesen Paragraphen eine Vorschrift aufzunehmen, die
sich auf das behördliche Ermittlungsverfahren schon auswirkt.
Denn erst wenn sichere Ergebnisse vorliegen, kann auch mit gutem
Gewissen veröffentlicht werden. Wenn Sie im Zusammenhang mit
der Haftung dazu noch bedenken, dass es zumindest in den fünf
neuen Bundesländern ein Staatshaftungsgesetz ohne jedes
Verschulden gibt, führt dies auch bei unverschuldetem Handeln
ohne Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu
Haftungsansprüchen. Das betrifft die Länder und Kommunen,
denen es anerkanntermaßen finanziell besonders schlecht geht.
Da sind meines Erachtens weitere Überlegungen notwendig, wie
man so etwas wasserdicht abschirmt. Dazu müsste man den
Gedanken, den Herr Prof. Falke vorhin auch genannt hat, aufgreifen,
dass man nämlich dem
Verhältnismäßigkeitsprinzip in irgendeiner Weise
besser Rechnung trägt und Ausschlussgründe aufnimmt
für Bagatellfälle. Wir sind heute einfach in der
Situation, dass solche Informationen wirklich gravierende
Auswirkungen für die betroffenen Unternehmen haben
können.
Der Vorschlag der Verbraucherverbände, unsere Informationen
aufzunehmen und dann aufzubereiten, halten wir auch für
durchaus bedenkenswert. Das würde uns sehr stark entlasten und
wir hätten die Gewähr, dass dort sachverständige
Personen diese Informationen so aufbereiten, dass der Verbraucher
wirklich etwas damit anfangen kann. Es ist jedenfalls unbedingt
notwendig, dass die Mehrkosten die durch dieses Gesetz verursacht
werden, den Kommunen wirklich erstattet werden. Dazu ist eine
Regelung notwendig, die die Länder in die Pflicht nimmt.
Peter Knitsch: Es ist in der Tat die Frage, ob man
diesen Bereich mit allen anderen Bereichen der öffentlichen
Haftung gleichstellen möchte oder nicht. Nach meiner
Auffassung sollte man das tun, denn es gibt meines Erachtens keinen
Grund, diesen Bereich anders zu behandeln, wie sonstiges
rechtswidriges Verhalten der öffentlichen Hand. Wenn in den
fünf neuen Bundesländern der Verfassungsgeber die
Entscheidung getroffen hat, dass dort sogar noch stärker als
in den alten Bundesländern, nämlich auch ohne Verschulden
gehaftet werden soll, dann wird er sich dabei etwas gedacht haben.
Überzeugende Gesichtspunkte, warum man diesen Bereich anders
behandeln soll als andere Bereiche der Haftung, fallen mir dazu
nicht ein. Ich hatte vorhin das Umweltinformationsgesetz, das
genauso haftungsrelevant sein kann, genannt. Etwas anderes
wäre nicht zu vermitteln. Die Wirtschaft würde sich zu
Recht dagegen wehren, wenn man in dieses Gesetz einen
weitergehenden Haftungsausschluss hineinschreiben würde.
Dietrich Klein, DBV: Das kann meines Erachtens
nicht so stehen bleiben. Es geht nicht darum, dass für
rechtswidriges Verhalten von Behörden gehaftet werden soll,
sondern in den Anträgen vom Bundesrat geht es gerade darum,
ein rechtswidriges Verhalten im Ansatz auszuschließen. Wenn
nämlich die Behörde nicht verpflichtet ist, die
inhaltliche Richtigkeit der Daten zu überprüfen und wenn
sie es auch tatsächlich nicht tut und trotzdem
veröffentlicht, dann hat sie nicht rechtswidrig gehandelt,
weil sie gegen die Pflicht zur Überprüfung nicht
verstoßen hat, weil diese eben nicht besteht. Nach diesen
Vorschlägen soll jeglicher Ansatzpunkt für eine Haftung
ausgeschlossen werden und es ist tatsächlich etwas völlig
anderes als im Umweltínformationsgesetz. Hier sollte kein
Wirrwarr gestiftet werden.
Der Vorsitzende: Wir haben im Ausschuss noch die
Gelegenheit, hierüber ausführlich zu sprechen, und ich
bitte die Bundesregierung, dass speziell zu diesem Punkt nochmals
eine abschließende Information im Ausschuss gegeben wird. Sie
haben uns vieles an Information gegeben, fast bin ich geneigt zu
sagen, viel zu viel. Das muss alles auch sortiert und verarbeitet
werden. Wir müssen es in unsere Beratungen mit einbeziehen.
Ich hoffe, dass wir auch ausreichend Gelegenheit haben, dieses zu
tun. Meine Bedenken und Sorgen habe ich am Anfang benannt, aber mir
bleibt jetzt erst mal nur, Ihnen ganz herzlich zu danken. Für
mich sind Anhörungen immer etwas Belebendes und Gutes, weil
ich Informationen bekomme, die mir die Entscheidungen manchmal
etwas leichter machen, manchmal, das gebe ich auch gerne zu, auch
schwieriger gemacht werden. Wir machen in diesem Ausschuss sehr
viel Anhörungen, weil wir in vielen Fällen auch
überfordert sind, die Informationen nur über Mitarbeiter
oder andere Quellen zu bekommen. Aus dem Gespräch und dem
Dialog, wie wir ihn gerade geführt haben, kann man sehr viel
mehr bekommen.
Also nochmals vielen Dank und guten Heimweg.
Der Vorsitzende schließt die Sitzung um
14.10 Uhr