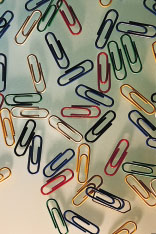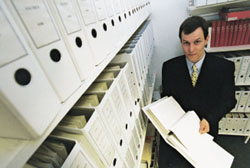Titelthema
Abgeordnetenbüros - Teamarbeit im Verborgenen
Ein Abgeordneter wird gewählt, setzt sich unter den
Bundestagsadler, hört sich Reden an – und das war's? Oft
wird die Arbeit der Volksvertreter mit den Sitzungen im Plenarsaal
gleichgesetzt. Diese Debatten sind zwar wichtig, aber sie stellen
nur einen winzigen Bruchteil der Abgeordnetenaufgaben dar. Die
Politiker arbeiten sich in komplizierte Fachfragen ein, bilden sich
in Arbeitsgruppen der Fraktionen und in Ausschüssen des
Parlamentes ihre Meinung, holen sich Rat von Wissenschaftlern und
Beteiligten, verhandeln mit der Bundesregierung und den
Bundesländern und kümmern sich last not least um ihre
Heimat, ihren Wahlkreis. Das ist so viel, dass es ein Einzelner
allein gar nicht bewältigen kann. Deshalb braucht jeder
Abgeordnete Mitarbeiter. Und weil jeder Mensch auf dieser Welt
anders ist, organisiert auch jeder Politiker seine Arbeit anders.
Blickpunkt Bundestag schaute sich in einigen Abgeordnetenbüros
um: Wie funktionieren diese wenig bekannten Arbeitseinheiten, die
zwar im Verborgenen wirken, ohne die der gesamte Parlamentsbetrieb
aber kaum denkbar wäre?
|
|
 |
|
Grundsätzlich ist jeder Abgeordnete frei in seiner
Entscheidung, wie er das Geld für seine Helfer verwenden will:
Ob er sich dafür eine einzelne herausragende Spitzenkraft
leistet, es durch zwei teilt oder ob er ein halbes Dutzend
studentische Teilzeitkräfte davon beschäftigt.
Hauptsache, der Etat stimmt am Ende. Aber nicht nur für sein
persönliches Mandat erhält er Hilfe. Wer besondere
Aufgaben übernommen hat, etwa als Ausschussvorsitzender,
erhält auch besondere Unterstützung. Und in den
Fachthemen arbeiten dem Abgeordneten außerdem noch fachlich
geschulte Fraktionsmitarbeiter zu. Aber auch das ist von Fraktion
zu Fraktion unterschiedlich und hat damit zu tun, ob sie groß
oder klein, in der Regierung oder in der Opposition ist.
Wie solch ein Team entsteht, ist auch ganz verschieden, meist
eine Mischung aus Planung und Zufall. Als Grietje Bettin für
Bündnis 90/Die Grünen vergangenes Jahr in den Bundestag
nachrückte, war sie froh, das Sekretariat ihres
Vorgängers schon besetzt zu finden. Barbara Grasemann wusste,
wie der Hase läuft. Ein unschätzbarer Vorteil für
alle, die neu im parlamentarischen Geschäft sind. Das war
neben der Abgeordneten selbst vor allem Thomas Peick, der mit
Bettin schon seit Jahren in Schleswig-Holstein zusammen arbeitete,
mit ihr Wahlkämpfe bestritt, ihren politischen Weg mal mehr
oder weniger nah begleitet hatte. Und der mit ihr nun als
Persönlicher Referent die Arbeit in Berlin organisiert.
Diese Organisation begann im April 2000 mit unzähligen
Fragen: Was bedeutet das störende Klingeln im Flur? (Das ist
der Ruf zu einer namentlichen Abstimmung im Plenum.) Wie erfahre
ich von den Sitzungen, an denen meine Abgeordnete teilnehmen soll?
Wie kann ich über das bundestagsinterne Computersystem am
besten Themen recherchieren? Wie finde ich mich in die Strukturen
ein, die sich in der Fraktion, in den Ausschüssen, im
Parlament gebildet haben? Wie definieren wir "unser" Thema, bei
Bettin sind es vor allem die "Neuen Medien", in Konkurrenz zu den
benachbarten Themen, um die sich andere Abgeordnete
kümmern?
|
|
 |
Büro Grietje Bettin
(rechts): Mitarbeiterbesprechung. |
Viele Fragen. Aber das Team um Bettin ist gewohnt, die Antworten
gemeinsam zu suchen. Früher ging es um die Aktivitäten
der grünen Jugend in Schleswig-Holstein, heute ist die
Mitgestaltung der Medienlandschaft in der Bundesrepublik das Thema.
Da müssen viele Auskünfte eingeholt, Initiativen
abgestimmt, Trends in den einzelnen Bundesländern beobachtet
werden. Bettin ist zwar neu in Berlin, aber ihr Büro
funktioniert nach alt bewährten Prinzipien. "Das ist eine seit
langem gewachsene Kommunikation", unterstreicht Bettin. Auch Oliver
Passek, der als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in Berlin hinzukam,
und Björn Pistol, der die Arbeit im Wahlkreis koordiniert,
kannten Bettin und Peick von früheren Parteitreffen. Es sei
zwar ein wenig übertrieben formuliert, findet Bettin, aber "im
Grunde haben wir jetzt die idealen professionellen Strukturen
für das gefunden, was wir früher in unserer Freizeit
gemacht haben".
Nicht ganz unbeleckt von parlamentarischer
Büro-Organisation war auch Detlef Parr, als er 1994 für
die FDP erstmals in den Bundestag einzog. Auch er ersetzte einen
ausscheidenden Abgeordneten mitten im laufenden Geschäft,
musste also ebenfalls "von heute auf morgen von null auf hundert"
kommen. Obwohl Parr zuvor selbst als Referent im Düsseldorfer
Landtag gearbeitet hatte, war er doch heilfroh, erfahrenen Rat zu
haben, von einem "alten Fuchs ans Händchen genommen" zu
werden. Daran vermochte Parr auch anzuknüpfen, als er nun in
Berlin neu anfing und mit Gabriele Hauser-Allgaier als Referentin
sowie Hanna Daberkow fürs Sekretariat seine "Visitenkarte"
fand. Auf die Ausschreibung im Internet hatte er über 150
Bewerbungen erhalten. Viele möchten hinter die Kulissen des
Parlamentsbetriebes blicken, kräftig mit anpacken, dass der
Laden läuft.
Parr kann es auch noch flotter formulieren: "Wir machen das
Chaos griffig." Am Anfang stand für ihn und sein Büro die
Einarbeitung in ein neues Thema, die Gesundheitspolitik. "Das war
Knochenarbeit." Aber nun ist Alltag eingekehrt. Und das bedeutet
für Hauser-Allgaier zum Beispiel die Durchsicht Dutzender von
Faxe und E-Mails, die sich schon auf ihrem Schreibtisch und in
ihrem PC türmen, wenn sie morgens das Büro betritt.
"Manchmal landen hier regelrechte Mail-Bomben." Auf dem
Gesundheitssektor finden sich viele Interessenverbände, die zu
jeder politischen Entscheidung gerne die Basis mobilisieren und die
Abgeordneten mit Eingaben regelrecht unter Beschuss nehmen. Da wird
das Büro auch zum Schutzwall.
|
|
 |
Büro Detlef Parr:
Telefonieren, Faxen, Mailen. |
Wer vorgefertigte Massenappelle an die Abgeordneten verschickt,
bekommt eine Standardreaktion. Wer individuell seinen
Volksvertreter anschreibt, erhält auch eine individuelle
Antwort. Ein weiterer Job für Hauser-Allgaier: der Kontakt zu
den Medien. "Man muss ja auch stattfinden in der
veröffentlichten Meinung", erläutert Parr. Und so geht
die Freude durchs gesamte Büro, wenn eine Pressemeldung im
Blätterwald Niederschlag fand, der FDP-Abgeordnete Parr etwa
mit seiner Sicht zur Handy-Strahlung registriert wurde.
Sitzungsvorbereitung, Materialsichtung, Einzelrecherche. Dafür
gehen viele Stunden drauf. Und für das Termin-Management.
Mitunter fallen vier, fünf oder gar sechs Verpflichtungen
gleichzeitig an, bei denen der Abgeordnete eigentlich Präsenz
zeigen sollte. "Wenn wir Herrn Parr klonen könnten,
hätten sämtliche Klone täglich mehr als genug zu
tun", meint Hauser-Allgaier.
"Ich stöhne nicht darüber, aber zwischen 8 und 23 Uhr
sind wir immer verplant", sagt auch der CDU-Abgeordnete Werner
Lensing. Und damit meint er nicht einen Termin am Morgen und einen
am späten Abend. Das geht manchmal im Zehn-Minuten-Takt.
Welche Themen stehen im Forschungsausschuss an? Was kommt auf den
Verteidigungspolitiker Lensing zu? Wie geht es weiter bei der
Bio-Ethik, wofür Lensing Sprecher seiner Fraktion in der
Enquete-Kommission ist. Welche der Interviewanfragen an Lensing als
Sprecher der interfraktionellen Initiative zum Nichtraucherschutz
können in der Mittagszeit angenommen werden? Wann muss Lensing
im Bundestag sein, wo die Regierung gerade seine Anfrage
beantwortet? Was behandelt der Stiftungsrat der Stiftung Deutsche
Friedensforschung, in der Lensing als Abgeordneter mitwirkt. Und
während er von 15 bis 17 Uhr im Plenum seinen Dienst als
Schriftführer verrichtet, ist in seinem Büro schon die
Einladung zu einer spontan einberaumten Beratung über die
Medizin-Ethik eingetroffen. Und so weiß er, dass er die Karten
für die Theateraufführung am Abend einmal mehr vergessen
kann. Fazit: "Ich könnte mein Mandat verantwortlich nicht
ausüben, wenn ich nicht qualifizierte Zuarbeiter
hätte."
Qualifizierte Zuarbeit. Das leistet zum Beispiel Ute Ahlberg.
Sie jongliert permanent mit den Terminen, arbeitet die Postberge
durch, die mehrfach täglich eintreffen und organisiert die
sonstigen Abläufe – zum Beispiel die Betreuung der
Besuchergruppen.
|
|
 |
Büro Werner Lensing:
qualifizierte Zuarbeit. |
Das können pro Jahr auch schon einmal 2.000 Westfalen sein,
die "ihren" Abgeordneten in der Hauptstadt sehen wollen. Und auch
ohne Dietmar Niedziella wäre Lensings Arbeit kaum denkbar. Als
ehemaliger Zeitsoldat und Student der Staatswissenschaften an der
Bundeswehrhochschule passt er ideal zum Arbeitsfeld Lensings, zieht
für seinen Chef in konzentrierter Form zusammen, was der
für seine Fachberatungen braucht. "Das geht hier um 8 Uhr
jeden Morgen los und endet regelmäßig im Open End", sagt
Niedziella. Sein Profil: Allrounder. "Meistens weiß man
morgens noch nicht, was einen mittags oder abends erwartet." Aber
es hat für ihn einen ganz besonderen Reiz, "als ganz kleines
Rädchen an dem ganz Großen hier mitzudrehen und dabei
vielleicht doch das eine oder andere bewirken zu können."
An der Art, wie der Abgeordnete sein Büro organisiert,
lässt sich mitunter auch sein politischer Werdegang ablesen.
Zum Beispiel bei Rolf Niese. Der Hamburger SPD-Abgeordnete hatte
schon einen reichen Erfahrungsschatz als Kommunal- und
Landespolitiker, als er 1987 in den Bundestag gewählt wurde.
Ob Mitglied der Bürgerschaft oder Fraktionschef in Bergedorf,
er hatte diese Aufgaben gewissermaßen "nach Feierabend"
bewältigt. Jede Sitzung bereitete er selbst vor, jeden Antrag
setzte er selbst auf, jeden Brief beantwortete er selbst. Das
prägt. Und so kann er es sich nicht anders vorstellen, als die
Bereiche des Bundeshaushaltes, für die er nun die
Berichterstattung übernommen hat, selbst mit spitzem Bleistift
Posten für Posten durchzuprüfen. Aber um dann
sämtlichen Fragen nachzugehen, die sich daraus ergeben, greift
auch er gerne auf qualifizierte Hilfe zurück. Kay Wahlen ist
dies, und der wollte "schon immer denen über die Schulter
schauen, die die Entscheidungen treffen". Deshalb hat er über
Praktika schon bei der Hamburger Bürgerschaft
reingeschnuppert, bei der Europäischen Union, bei den
Vereinten Nationen. Und nun ist er bei einem Haushaltspolitiker
gelandet. Also dort, wo das Parlament seine Kernkompetenz
ausspielt.
Auch Niese hat sich am Anfang von einem erfahrenen Mitarbeiter
helfen lassen, "der schon gut wusste, wie die Kiste hier
läuft". Dessen Nachfolger Wahlen hat sich schnell an die
spezifische Arbeitsweise seines Chefs gewöhnt. Die
"Kernarbeit" macht Niese eben selbst. Es gibt keine Terminzusage,
zu der er nicht selbst sein Okay gegeben hat. Auch sämtliche
Post will Niese sehen. Zumindest sehen. "Ich will wissen, was hier
landet." Meistens reist der Hamburger schon sonntagsabends in die
Hauptstadt, der Montag ist dann bei ihm klassischer Bürotag.
Es wird gesichtet – und zusammen mit dem Mitarbeiter
gewichtet. Der Kontakt mit einem weiteren Mitarbeiter im
Wahlkreisbüro ist durch elektronische Verknüpfung
garantiert. So hat der Abgeordnete grundsätzlich Zugriff auf
seine Berliner Dokumente auch von seinem Wahlkreis aus. Aber
meistens greift man zum Telefon oder bedient das Fax. Klare
Aufgabentrennung zwischen Bundestags- und Wahlkreisbüro
erleichtert bei Niese die Abwicklung. "Deswegen brauchen wir auch
kaum Datenaustausch zwischen Hamburg und Berlin." Und mittlerweile
kommt der Abgeordnete auch mit der elektronischen Bürohilfe,
der Recherche per Internet oder Intranet, selbst immer besser klar.
"Letztens war er sogar schon einmal schneller als ich", lobt
Wahlen.
|
|
 |
Büro Rolf Niese: Der
Mitarbeiter kennt die Arbeitsweise des Chefs. |
Zu den Grundvoraussetzungen, die die Mitarbeiter mitbringen
müssen, gehören nicht nur schnelle Auffassungs- und
Organisationsgabe, gehört nicht nur eine Persönlichkeit,
durch die "die Chemie stimmt". Es sollten auch schon verwandte
politische Einstellungen da sein. "Sonst wird der Mitarbeiter nicht
glücklich", meint Niese. Im Team müsse nicht jeder alles
gleich sehen, unterschiedliche Auffassungen im Detail befruchteten
eher die Diskussion und führten oft zu neuen, interessanten
Ideen. "Aber es sollte schon die gleiche Couleur sein."
Kein Wunder also, dass sich Andreas Keller, der sich in Marburg
mit "linker, emanzipatorischer Hochschulpolitik" befasste, nun als
Referent bei der PDS wohl fühlt. Er kümmert sich hier um
die Hochschulpolitik, sein Referentenkollege Peer Kösling, der
in der DDR eine Uni-Laufbahn absolvierte, um die Bildungs- und
Kulturpolitik. Sie sind die wesentlichen Teile der fachlichen
Unterstützung für die PDS-Abgeordnete Maritta
Böttcher. Ihre persönliche Mitarbeiterin ist Adelaide
Grützner. Sie hatte durch ihren Mann, der in einem
Wahlkreisbüro arbeitete, schon einen gewissen Einblick in die
parlamentarischen Büroabläufe. "Aber hier ist es doch
ganz anders." An der Basis sei der Kontakt mit den Bürgern und
Wählern wesentlich direkter, in Berlin müsse man "vieles
mehr in Strukturen übersetzen".
|
|
 |
Büro Maritta Böttcher:
Die Chefin setzt auf Teamarbeit. |
Das Böttcher-Team bereitet gerade eine Klausur der
PDS-Arbeitsgruppe aus dem weiten "Kultus"-Feld vor. Abgeordnete,
Persönliche Mitarbeiter und Fachreferenten werden dort
außerhalb der festen Büroabläufe mit externem
Sachverstand den Kulturföderalismus unter die Lupe nehmen
– und neben Impulsen für die politische Arbeit sicher
wieder ein noch stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl
von dort mitbringen. "Wir kommen in unserer Arbeit nur voran, wenn
wir uns gegenseitig aufeinander verlassen können", sagt
Böttcher. Deshalb kehrt sie auch selten die Chefin heraus.
"Ich bin doch nur in dieser Rolle, weil auch meine Mitarbeiter
einen erfolgreichen Wahlkampf gemacht haben. Im Grunde könnte
es auch andersherum sein." Die Philosophie aller Abgeordneten,
gleich wie unterschiedlich ihre Büros organisiert sind, bringt
sie auf einen gemeinsamen Punkt: "Wir ziehen als Team an einem
Strang."
Gregor Mayntz