

> Debatte > Essay 02/05
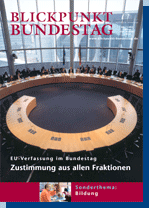
Die aktuelle Ausgabe von Blickpunkt Bundestag liegt jetzt vor. Sie können sie hier als PDF-Datei öffnen oder herunterladen. Blickpunkt Bundestag können Sie auch abonnieren. Mehr dazu unter „Abo“.
Politik aktiv gestalten:
Mitmischen.de ist das Jugendforum des Deutschen Bundestages im
Internet. Die Plattform bietet Chats mit Abgeordneten des
Bundestages, Diskussionsforen, Abstimmungen, Nachrichten und
Hintergrundberichte zu aktuellen politischen Themen.
www.mitmischen.de
![]() Wie
Einstein zum Politiker wurde
Wie
Einstein zum Politiker wurde
Ein Essay von Jürgen Renn
Einstein symbolisiert wie wohl kein Zweiter den revolutionären Charakter der Naturwissenschaft des zwanzigsten Jahrhunderts. In gleichem Maße wie die Naturwissenschaften selbst hat er auch das öffentliche Bild von Naturwissenschaft geprägt. Dazu gehört der Mythos des Wissenschaftlers, der sich über Konventionen und Autoritäten hinwegsetzt. Einstein setzte seinen Ruhm stets bewusst für politische Anliegen, aber auch für die öffentliche Verbreitung wissenschaftlichen Wissens ein.
Am Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts sind allerdings die Konflikte, auf die sich seine Unangepasstheit bezog, fast in Vergessenheit geraten. Erst aus diesen Konflikten erklärt sich jedoch, warum sich mit dem Namen Einsteins nicht nur ein bedeutendes wissenschaftliches Erbe verbindet, sondern nach wie vor auch eine politische Herausforderung: die Notwendigkeit für Wissenschaftler, gesellschaftliche und politische Verantwortung zu übernehmen.
Wie kam es dazu, dass Einstein sich dieser Verantwortung in besonderem Maße bewusst wurde? Sein Eintritt in das öffentliche Leben verbindet sich eng mit seiner Berufung nach Berlin. Erst in dieser Zeit wurde er zu einem weit über die Wissenschaft hinaus respektierten Intellektuellen und zum Vorkämpfer demokratischer und pazifistischer Ideale. Der Kontrast zwischen Einsteins Berliner Jahren und der vorangegangenen Zeit in der Schweiz wirkt auf den ersten Blick frappierend und geradezu unerklärlich. Denn im Gegensatz zu Einsteins politischem Engagement in Berlin ist von einer öffentlichen Wirksamkeit vorher nichts zu spüren. Doch auch nach Berlin war er nicht als politisch aktiver Wissenschaftler gekommen.
Zur Zeit des deutschen Überfalls auf Belgien war Einstein gerade vier Monate in Berlin. Er teilte die allgemeine Kriegsbegeisterung nicht und fühlte sich im Kreise der Kollegen durch seine Einstellung zu den Tagesereignissen isoliert. Erst der berüchtigte „Aufruf an die Kulturwelt“ vom Oktober 1914 löste jedoch sein politisches Engagement aus. Er wurde von zahlreichen Intellektuellen unterzeichnet, die sich bemüßigt fühlten, den Krieg und den Militarismus mit dem angeblich notwendigen Schutz deutscher Kultur zu rechtfertigen. Einstein zögerte nicht, einen nur von wenigen unterstützten Gegenaufruf zu unterschreiben, der ihn noch mehr vom akademischen Establishment isolierte, zugleich aber mit anderen Kriegsgegnern in Kontakt brachte.
Wie kann ein Einzelner überhaupt gesellschaftliche Konflikte beurteilen und auf sie reagieren, wenn sich hinter diesen Konflikten komplizierte gesellschaftliche Mechanismen verbergen, deren Strukturen und Gesetzmäßigkeiten nicht unbedingt in ihren Oberflächenerscheinungen zutage treten? Engagement hat offenbar nicht nur mit politischen und moralischen, sondern auch mit kognitiven Problemen zu tun. Weltanschauungen und politische Bewegungen übernehmen die Rolle von Vermittlungsinstanzen, indem sie dem Einzelnen ein vereinfachtes und in der Regel verfälschendes Bild dieser Strukturen anbieten, das aber dem Individuum oft erst die intellektuellen Ressourcen zur Entwicklung eigener Handlungsperspektiven eröffnet.
In Einsteins Fall spielten sein Familienhintergrund, die Erfahrungen mit einer funktionierenden Demokratie in der Schweiz, nicht zuletzt aber der implizit politische Charakter seines wissenschaftlichen Selbstverständnisses eine wichtige Rolle für die Entwicklung seiner politischen Ansichten. Die Entstehung dieses Selbstverständnisses hängt insbesondere mit seiner Lektüre populärwissenschaftlicher Bücher zusammen, in der Gedankengut der bürgerlichen Revolution von 1848 eine wichtige Rolle spielte. Aber erst der bereits erwähnte Versuch führender Kreise, Wissenschaftler und Künstler direkt in die politische Auseinandersetzung hineinzuziehen, ein Versuch, der in mancher Hinsicht die spätere ideologische Instrumentalisierung kultureller und wissenschaftlicher Aktivitäten im Nationalsozialismus vorwegnimmt, provozierte sein Engagement. Zu dessen historischen Voraussetzungen gehörte also auch eine dramatische Veränderung der gesellschaftlichen Rolle des Wissenschaftlers, die Einstein mit einer Herausforderung konfrontierte, die er vor dem Hintergrund persönlicher Erfahrungen anzunehmen in der Lage war. Vielleicht blieben ihm auch deshalb immer Einzelschicksale wichtig, wie sein rastloser Einsatz für Verfolgte, Verurteilte und Emigranten während zweier Weltkriege und eines Kalten Krieges zeigt.
Foto: Berliner Zeitung / Paulus
Ponizak
Erschienen am 15. März 2005
Weitere Informationen:
Professor Dr. JÜRGEN RENN, Jahrgang 1956, ist
Direktor am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte
(Berlin), Honorarprofessor für Wissenschaftsgeschichte an der
HU Berlin und Adjunct Professor für Philosophie und Physik an
der Boston University. Er hat sich mit der Entwicklung des Wissens
und seiner Rolle in der Kultur befasst und sich mit Studien
über die Entstehung der Relativitätstheorie international
einen Namen gemacht.
www.mpiwg-berlin.mpg.de