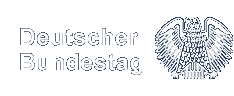IV. Die Weimarer Republik
6. Die Auflösung der Republik
In den letzten Jahren der Weimarer Republik schreitet die Aushöhlung des parlamentarisch-demokratischen Systems immer schneller voran. Die politischen Gewichte verschieben sich angesichts der Schwierigkeiten, ein tragfähiges Kabinett zu bilden, vom Parlament und den Parteien hin zum Reichspräsidenten und seinem Beraterkreis, dem die Bildung einer aus den alten Eliten zusammengesetzten Rechtsregierung autoritären Charakters vorschwebt. Dieses Ziel rückt näher, als die Große Koalition unter Hermann Müller demissioniert und eine parlamentarische Regierungsbildung nicht mehr zu Stande kommt. Die konservativen Hoffnungen ruhen nun auf Reichskanzler Heinrich Brüning (Zentrum), der von Hindenburg mit der Kabinettsbildung beauftragt wird und bei Bedarf vom Notverordnungsrecht Gebrauch machen kann. Dazu erhält er bereits in den ersten Wochen Gelegenheit, als seine zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise eingeleiteten Sparmaßnahmen vom Parlament abgelehnt werden. Als schließlich Brünings Kurs am Reichstag endgültig zu scheitern droht, schlägt Hindenburg den Weg von der verdeckten zur offenen Präsidialregierung ein, löst das Parlament auf und erlässt bis zu den Neuwahlen im September 1930 die abgelehnten Notverordnungen. Der erhoffte Sieg der bürgerlichen Parteien bleibt aus, stattdessen erzielen mit der NSDAP und der KPD die radikalen Parteien enorme Stimmengewinne, so dass sie danach über eine Sperrminorität verfügen. Erneut bildet Brüning ein Minderheitskabinett, das jedoch nun aus Rücksicht auf die Regierungskoalition in Preußen und zur Vermeidung einer Rechtsdiktatur von den Abgeordneten der SPD gestützt wird. Die von ihm weiterhin verfolgte Deflationspolitik spitzt die soziale und politische Lage schließlich immer stärker zu, was die Kluft zwischen ihm und dem Reichspräsidenten vertieft. Als Hindenburg bei seiner Wiederwahl zum Reichspräsidenten auch auf die Stimmen der SPD-Wähler angewiesen ist und diesen Umstand als "Verkehrung der Fronten" auffasst, entlässt er Brüning am 30. Mai 1932.
|
|||||||||
| Wahlhelfer vor einem Berliner Wahllokal, 1932 |
Hatte Brüning die Funktion des Reichstages und seiner Fraktionen bereits auf die reine Mehrheitsbeschaffung und Tolerierung reduziert, so vollziehen seine Nachfolger, Franz von Papen und General Kurt von Schleicher, eine radikale Abkehr vom Parlamentarismus. Das von Papen geführte "Kabinett der Barone" verfügt über keinerlei parlamentarischen Rückhalt mehr und ist allein von Hindenburgs Gunst abhängig. Diese nutzt Papen, um die geschäftsführende preußische Regierung unter dem Sozialdemokraten Otto Braun staatsstreichartig zu entmachten und auf Reichsebene eine Regierungsbeteiligung der Nationalsozialisten ins Spiel zu bringen. Dieses Unterfangen misslingt ihm zunächst ebenso wie seinem Nachfolger Schleicher, der mit sozialpolitischen Zugeständnissen den gemäßigten Flügel der NSDAP auf seine Seite zu ziehen versucht. Nach langem Zögern ernennt Hindenburg auf Initiative Papens den Führer der mittlerweile zur stärksten Reichstagsfraktion aufgestiegenen NSDAP am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler: Adolf Hitler.