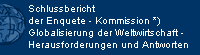3.8 Exkurs:
Handelstheorien als Leitbilder
3.8.1 Eine
kurze Geschichte des Freihandels
3.8.1.1 Britische Hegemonie und
Freihandel
Wir beginnen unseren Durchgang durch die
Geschichte des Freihandels naheliegenderweise mit einem Blick auf
dessen Leitidee, Ricardos sogenannte Theorie der komparativen
Kostenvorteile.
Sie geht bekanntlich davon aus, dass es
für das Wohl der Menschheit das Beste sei, wenn jedes Land
sich auf die Herstellung derjenigen Güter spezialisiert,
für die es den vergleichsweise geringsten Arbeitsaufwand
benötigt, und die anderen Güter durch den Handel erwirbt.
Damit wird nicht nur das Prinzip der produktivitätssteigernden
Arbeits teilung, sondern auch das liberale
Gesellschaftsprinzip auf die internationalen Beziehungen
übertragen: „Bei einem System des vollkommen freien
Handels wendet natürlich jedes Land sein Kapital und seine
Arbeit solchen Zweigen zu, die jedem am vorteilhaftesten sind.
Dieses Verfolgen des individuellen Vorteils ist bewundernswert mit
dem allgemeinen Wohle des Ganzen verbunden“ (Ricardo 1979:
114f.). Freilich hatte Adam Smith das auch schon so gesehen. Die
Pointe Ricardos liegt jedoch in der Zuspitzung, dass der Handel
sich selbst für die Länder lohnt, bei denen die
Arbeitsproduktivität in allen Branchen entweder höher ist
als bei den durchschnittlichen Konkurrenten oder bei denen sie in
allen Branchen niedriger ist: Auch sie sollten sich spezialisieren,
nämlich auf den Bereich, in dem die Produktivität
komparativ – d.h. im Vergleich zwischen den Bereichen, in
denen sie selber bisher tätig sind – am höchsten
ist. „Zwei Menschen können beide Hüte und Schuhe
erzeugen, und einer ist dem anderen in beiden Tätigkeiten
überlegen. Aber in der Herstellung von Hüten kann er
seinen Konkurrenten nur um ein Fünftel oder 20 Prozent
überflügeln, und in der Schuherzeugung übertrifft er
ihn um 1/3 oder 33 Prozent. Wird es nicht in beider Interesse
liegen, dass der Überlegene sich ausschließlich mit der
Schuherzeugung und der Unterlegene mit der Hutmacherei
beschäftigt?“ (Ricardo 1979: 117). Es sollen also alle
am Handel teilnehmen, sowohl die, die der Meinung sind, sie seien
auf allen Gebieten so überlegen, dass sie den Austausch nicht
brauchen, als auch die, die aufgrund ihrer Unterlegenheit auf allen
Gebieten der Meinung sind, sie könnten aus ihm keinen Vorteil
ziehen. Keiner soll denken, er könne alles, und keiner soll
denken, er könne nichts, sondern wirklich jeder soll sich im
eigenen Interesse spezialisieren und zugleich erfahren, dass er die
anderen braucht. Selbst der Stärkste hat relative
Schwächen, braucht also Handels-partner, und selbst der
Schwächste hat relative Stärken, mit denen er im Handel
aufwarten kann. Alle können und sollen einbezogen werden,
niemand muss und darf ausgeschlossen werden. Indem Ricardo so die
Extreme einbezieht, will er eben deutlich machen, dass im freien
Handel keiner Verluste erleidet: Es ist nie ein Nullsummenspiel,
immer ein Positivsummenspiel.
Die Tragweite der Smith-Ricardoschen Idee
zeigt sich daran, dass die Sozialwissenschaften aus ihr das Prinzip
der modernen im Unterschied zur traditionellen Gesellschaft
überhaupt hergeleitet haben: fortschreitende
Rollendifferenzierung, Individualisierung und daher Zusammenhalt,
Solidarität immer weniger aufgrund vorgegebener
natürlicher Gemeinsamkeit, sondern nur als Anerkennung des
anderen in seinem Anderssein.
Das ist die
ideale Seite der Sache. Auf die reale Seite werden wir
gestoßen durch das konkrete Beispiel, mit dem Ricardo seine
These erläutert. Es ist der freie Handel zwischen England und
Portugal, bei dem sich Portugal auf die Lieferung von Wein und
England auf die von Tuch spezialisiert hat. Befremdlich ist aber
das Beispiel noch nicht deshalb, weil es sich offenbar um sehr
ungleiche Partner handelt. Denn darin liegt ja eben die Pointe
Ricardos, am Extrem der Ungleichheit den Vorteil des freien Handels
zu demonstrieren. Befremdlich ist, dass Ricardo die Dinge
hypothetisch so darstellt, als sei Portugal sowohl in der Wein- als
auch in der Tuchherstellung produktiver gewesen! Da nicht
anzunehmen ist, dass er die Leser in diesem Punkt täuschen
konnte, mag die Erklärung darin liegen, dass er auf einem
hohen Abstraktionsniveau denkt und seine Beispiele
spielerisch-willkürlich wählt. Das ist ihm auch im 19.
Jahrhundert schon vielfach vorgeworfen worden. Aber diese
Erklärung reicht nicht aus. Denn er nimmt ja nicht irgendein,
sondern gerade dieses bekannte Beispiel und kehrt es um. Der Grund
wird klar, wenn man seinen Text nicht mit der Brille der
Ökonomielehrbücher, sondern unbefangen in seinem
historischen Kontext liest. Sein Thema ist nämlich gar nicht
eine „Lehre von den komparativen Kostenvorteilen“,
sondern die Frage, ob man über den Außenhandel die
Profitrate steigern kann. Und seine Antwort ist, dass man das nur
erreicht, wenn man die Nahrungsmittel billiger macht und so die
Löhne senken kann. „Es war mein Bestreben, durch dieses
ganze Werk zu zeigen, dass die Profitrate niemals anders als durch
eine Senkung der Löhne erhöht werden kann und dass eine
dauernde Senkung der Löhne nur durch ein Sinken der Preise der
lebenswichtigen Güter, für welche die Löhne
verausgabt werden, eintritt“ (Ricardo 1979: 113). Wie man die
Nahrungsmittel verbilligen konnte, das wusste aber jeder
interessierte Leser: Indem man die kurz vor dem Erscheinen von
Ricardos Buch, nämlich 1815 eingeführten hohen
Kornzölle wieder senkte oder abschaffte! „Wenn wir
anstatt unser eigenes Getreide anzubauen oder die Kleidung und die
anderen lebenswichtigen Güter des Arbeiters selbst zu
erzeugen, einen neuen Markt entdecken, durch den wir uns mit diesen
Waren wohlfeiler versorgen können, so werden die Löhne
fallen und der Profit wird steigen“ (Ricardo 1979: 113). Im
landwirtschaftlichen Bereich musste also endlich die Freiheit des
Handels einziehen, denn bei den überlegenen Industriewaren
verstand sie sich von selbst. Ricardo will demnach mit seinem
konstruierten Fall zeigen, dass selbst bei einer absoluten
Unterlegenheit Englands in beiden Bereichen eine Spezialisierung
auf die komparativ stärkere Industrie im Handel mit
Agrarländern vorteilhaft wäre. Und er nimmt damit
natürlich Partei in dem langen Streit zwischen Landadel und
Industriebürgertum, der erst ab 1846 zugunsten des letzteren
beendet wurde: Die Hungersnot in Irland nach der Missernte von 1845
hatte demonstriert, dass Großbritannien seine wachsende
Bevölkerung nicht mehr selber ernähren konnte. Also
wurden die Einfuhrzölle auf Getreide (auch Baumwolle und
andere Roh  stoffe) endlich
abgeschafft. Die Freihandelsbewegung hatte sich durchgesetzt. Die
Fabrikanten aber reagierten ganz der Logik Ricardos gemäß
mit einer Senkung der Löhne um bis zu 25 Prozent (Marx 1969:
300). stoffe) endlich
abgeschafft. Die Freihandelsbewegung hatte sich durchgesetzt. Die
Fabrikanten aber reagierten ganz der Logik Ricardos gemäß
mit einer Senkung der Löhne um bis zu 25 Prozent (Marx 1969:
300).
Noch in anderer
Hinsicht ist das Beispiel Ricardos irritierend. Wusste er nicht,
dass der „freie“ Handel zwischen England und Portugal
auf den berühmt-berüchtigten Methuen-Vertrag von 1703
zurückging, der schon im 18. Jahrhundert als Meisterleistung
der britischen Diplomatie gesehen wurde, nämlich im
Überlisten des Partners? (vgl. z.B. Smith
1975: 329f.). Er war sogar der klassische Fall jener
merkantilistischen Verträge, die nur der Form nach auf
Gegenseitigkeit beruhten, inhaltlich jedoch ganz bewusst auf die
Schädigung des anderen zielten. Denn nach herrschender Lehre
war der Schaden des anderen der eigene Gewinn und umgekehrt, weil
man dem Wirtschaftkrieg gar nicht ausweichen konnte. So wurde
Portugal nach dem Abkommen von 1703 derart mit englischen Tuchwaren
überschwemmt, dass es mit seinem Weinexport nach England die
Handelsbilanz nicht mehr ausgleichen konnte und mit brasilianischem
Gold bezahlen musste – eine Katastrophe nach
merkantilistischer Lehre. Smith (1975: 331ff.) sucht zu zeigen,
dass es keine Katastrophe war. Zudem geriet der Portweinhandel
selber unter englische Kontrolle. Drittens wurde Portugal der erste
jener zahlreichen weiteren Absatzmärkte der expandierenden
englischen Industrie, die eben darum zu keiner eigenen
industriellen Entwicklung kamen (der Minister Marques de Pombal,
der die Probleme erkannte und ihnen seit 1756 mit Reformen
beikommen wollte, wurde 1777 auf Betreiben des Landadels entlassen
und verbannt). So betrug das Bruttoeinkommen Portugals schon zur
Zeit Ricardos nur noch ein Zehntel des britischen. Viertens war das
Land seit dem Sieg Wellingtons über die Franzosen 1810 bis
1822 englisches Protektorat – also zum Zeitpunkt des
Erscheinens von Ricardos „Grundsätzen“. Ist der
politische Status eines Protektorats demnach eine gute
Voraussetzung für freien Handel? Warum nur wählt Ricardo
dieses offensichtliche Gegenbeispiel zum freien Handel, um für
diesen zu werben? Redet er ironisch, um nicht zu sagen zynisch? Der
Grund könnte auch die schon erwähnte Abstraktheit seines
Denkens sein, hier im Hinblick auf geschichtliche
Zusammenhänge: Er sieht von ihnen ab, sie interessieren ihn
einfach nicht. Aber beim Methuen-Vertrag und seinen Folgen ging es
ja nicht um eine weit zurückliegende, belanglose, sondern um
jüngste, durchaus aktuelle Vergangenheit! Es gibt wohl nur
eine Erklärung: Der Sieger der Geschichte vergisst
unwillkürlich und unbewusst, wie er zu seinem Sieg gelangt
ist, und gibt ihm eine ideale, auch die Moral befriedigende
Interpretation. Der, der den Krieg bzw. Wirtschaftskrieg in
überwältigender Weise gewonnen, im Grunde alle
unterworfen hat, proklamiert nun großmütig den Frieden
bzw. eben den freien Handel, den er eigentlich immer schon gewollt
habe. Denn das war doch die Situation, in der sich
Großbritannien 1817 befand und die Ricardo zum Ausdruck
brachte. Nachdem 1815 der Hauptkonkurrent Frankreich endgültig
überwunden war, gab es in der Tat niemanden mehr, der
Großbritannien wirtschaftlich wie in der Beherrschung der
Meere noch ernsthaft infragestellen konnte. Zwar gab es auf dem
Kontinent ein Gleichgewicht der Mächte, aber zur See ein
eindeutiges englisches Machtmonopol. Schon nach Trafalgar
verfügte die Royal Navy über mehr Kriegsschiffe als alle
anderen Kriegsflotten der Welt zusammengenommen. Und schon 1800 war
das Industrialisierungsniveau pro Kopf in Großbritannien
doppelt so hoch wie im europäischen Durchschnitt (Kennedy
1989: 237).
Was man somit an Ricardos Text selber
erkennen kann, ist der bemerkenswerte Sachverhalt, dass der freie
Handel auf erfolgreichem Protektionismus beruht, wenn er auch diese
seine dunkle Herkunft begreiflicherweise vergessen machen
möchte.
Natürlich ist das nicht bloß an
Ricardos Text zu erkennen, sondern zumal an der realen Geschichte.
Großbritannien ist bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts durchaus
keinen eigenen, etwa auf den freien Handel zielenden Weg gegangen,
sondern hat die merkantilistische Politik der anderen
europäischen Staaten sehr wohl mitgemacht. Es konnte zum
Initiator des Freihandels vielleicht sogar nur deshalb werden, weil
es sie am konsequentesten praktiziert hat; jedenfalls – da
glückliche Umstände auch hier mitgespielt haben –
deshalb, weil es in dieser Politik am erfolgreichs ten
war.
Außer dem
Methuen-Vertrag ist der sogenannte Navigation-Act von 1651 ein
treffender Beleg für diese Tatsache. Ursprünglich gegen
die holländische Handelsdominanz gerichtet, wurde das Gesetz
auch beibehalten, als sie längst gebrochen war, und galt mit
gewissen Modifikationen bis zur Einführung des Freihandels
also rund 200 Jahre. Es besagte kurzgefasst: 1. Allen
nichtenglischen Schiffen ist es „bei Strafe des Verlustes von
Schiff und Ladung verboten“, mit englischen Kolonien Handel
zu treiben. 2. Das gleiche Verbot gilt für die
Küstenschiffahrt und –fischerei Großbritanniens. 3.
Europäische Waren dürfen ebenfalls nur auf englischen
Schiffen oder auf denen des Herstellungslandes eingeführt
werden (gegen den Zwischenhandel) (Smith 1975: 225). Gewiss hat
sich England mit diesem Gesetz nicht besonders hervorgetan, denn
Frankreich und schon Spanien haben ganz ähnliche Regelungen
getroffen. Interessant ist jedoch, dass der Vorreiter der
Freihandelslehre Adam Smith keine Bedenken hatte, die Regelung
ausdrücklich zu begrüßen und ausführlich zu
begründen. Zwar räumt er ein, „dass einige
Bestimmungen dieser berühmten Akte auch aus nationaler
Feindseligkeit hervorgegangen sein können. Sie sind jedoch
ebenso klug, als ob sie alle von der wohlüberlegtesten
Weisheit diktiert worden wären. Zu jener Zeit verfolgte
nationale Feindseligkeit genau das gleiche Ziel, das die
wohlüberlegteste Weisheit im Auge gehabt hätte: die
Verminderung der Seemacht Hollands, der einzigen Seemacht, welche
die Sicherheit Englands gefährden konnte.“Smith
erläutert auch sehr schön, weshalb die Akte für die
Freiheit des Handels und den Wohlstand, den sie bringen kann,
„nicht günstig“ sei. Dennoch kommt er zu dem
Schluss: „Da die Verteidigung jedoch von viel
größerer Bedeutung als Reichtum ist, ist die
Navigationsakte vielleicht die weiseste von allen
Handelsbestimmungen Englands“ (Smith 197: 226f.). Von daher
erscheint es gar nicht mehr als Ironie der Geschichte, dass der
Prophet des Freihandels nach dem großen Erfolg seines Werkes
in Würdigung seiner wissenschaftlichen  Verdienste zum
Zollkommissar von Schottland ernannt wurde. Denn für die
Orientierung der politischen Praxis Englands hat seine
Freihandelstheorie bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ohnehin kaum
etwas bedeutet (Fieldhouse 1965: 66). Und das spiegelt sich eben in
seiner eilfertigen Inkonsequenz. Verdienste zum
Zollkommissar von Schottland ernannt wurde. Denn für die
Orientierung der politischen Praxis Englands hat seine
Freihandelstheorie bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ohnehin kaum
etwas bedeutet (Fieldhouse 1965: 66). Und das spiegelt sich eben in
seiner eilfertigen Inkonsequenz.
Dass Großbritannien vielmehr in der
merkantilistischen Politik besonders konsequent war, zeigt die
Kolonisierung Indiens so deutlich, dass sich eine Erläuterung
fast erübrigt.
Denn Indien war nicht irgendein Land der
später so genannten Dritten Welt, sondern das Land, auf das
sich wegen seines sagenhaften Reichtums schon seit dem 15.
Jahrhundert die Sehnsüchte der europäischen
Kolonialmächte richteten. Bekanntlich war die Entdeckung
Amerikas ja gleichsam ein Nebeneffekt dieser Sehnsüchte und
war noch das Ziel von Napoleons Ägypten-Expedition eigentlich
Indien. Indem es seit der Schlacht von Plassey 1757 endgültig
unter britischen Einfluss kam, war England sozusagen automatisch
der Sieger unter den Kolonialmächten.
Der Sinn der merkantilistischen
Kolonialpolitik bestand nun darin, die positive Handelsbilanz
dadurch zu sichern, dass die abhängigen Gebiete Rohstoffe und
Nahrungs- bzw. Genussmittel lieferten, selber aber kein Gewerbe
entwickeln durften, sondern als Absatzmarkt für die Industrie
des Mutterlandes dienten. Nur war das mit Indien lange Jahrhunderte
nicht zu machen! Denn dort war die Nachfrage nach europäischen
Fertigprodukten lächerlich gering, weshalb nicht einmal die
Importe aus Indien durch Exporte gedeckt werden konnten. So wurde
der Ostindischen Kompanie im 17. Jahrhundert vorgeworfen, Geld
außer Landes zu lassen – eine Sünde wider den
Heiligen Geist des Merkantilismus. Und ihre Verteidiger (Mun,
Child) mussten den Engländern erklären, dass die Kompanie
doch auch mit anderen Ländern noch Geschäfte mache, die
wieder Geld hereinbrächten (Haussherr 1954: 220). Anfang des
18. Jahrhunderts aber konnte man dieser miss lichen Situation
nur dadurch Herr werden, dass man massive
Einfuhrbeschränkungen zum Schutz der englischen Manufakturen
verhängte (Fieldhouse 1965: 105).
Die Handelsverhältnisse begannen sich
erst zugunsten Englands zu verändern, als das Mogul-Reich
zunehmend zerfiel und die französische Ostindische Kompanie
ihre Positionen nicht mehr behaupten konnte – also aufgrund
politischer Machtverschiebungen. Jetzt konnten die Briten die
indischen Streitigkeiten ausnutzen und immer größere
Gebiete unter ihre Kontrolle bringen. Jedenfalls seit 1763 erfolgte
die Kolonisierung nicht mehr hauptsächlich durch die private
Ostindische Kompanie und bloß peripher, sondern unter
staatlicher Einflussnahme, und sie erfasste bis etwa 1820 den
ganzen Subkontinent. Dabei machte die Kompanie Gewinne, die sie
durch den Handel allein niemals erzielt hätte (Fieldhouse
1965: 127).
Zumal aber konnten die Briten die
Arbeitsteilung und den Austausch nun zu ihrem Vorteil umgestalten!
Obwohl noch 1815 der indische Export von Baumwollwaren nach
Großbritannien den Export in die umgekehrte Richtung bei
weitem überwog (und zwar trotz der fortgeschrittenen
Industrialisierung im Mutterland), war Großbritannien nun in
der Lage, Indien zum Kauf seiner Stoffe zu zwingen – mit dem
Ergebnis, dass das Land 1850, als der Freihandel seinen Siegeszug
antrat, ein Viertel des gesamten Exports von Lancashire abnehmen
musste und das eigene Gewerbe weitgehend verloren hatte. Vollendet
war dieser Prozess allerdings erst, als England sich entschloss, in
Indien die Produktion von Baumwolle und anderen
landwirtschaftlichen Rohstoffen (Jute, Indigo, Opium) im
Großen zu betreiben. Nun konnte Indien, das früher
Baumwollwaren in die ganze Welt geliefert hatte, nur noch
Rohbaumwolle ausführen, die in England verarbeitet und dann
als Fertigprodukt wieder eingeführt werden musste. Und da die
Landwirtschaft nicht mehr vorrangig der Ernährung der
Bevölkerung diente, kam es immer wieder zu Hungersnöten
(Bairoch 1973: 102).
Natürlich hatte diese Umkehrung des
Handelsverhältnisses zwischen den beiden Nationen ihren Grund
auch in der industriellen Überlegenheit Englands. Wäre
sie demnach auch ohne koloniale Gewalt unter Freihandelsbedingungen
eingetreten? Das ist erstens eine rein hypothetische, um nicht zu
sagen sinnlose Frage. Denn sie setzt doch voraus, dass Indien nicht
nur als selbständiger Staat weiterbestanden hätte,
sondern auch freiwillig einer solchen Arbeitsteilung zugestimmt und
darin sogar noch seinen Vorteil erkannt hätte! Zweitens war
Indien noch im 18. Jahrhundert ein hochentwickeltes Land, das viele
Bedingungen für den industriellen Fortschritt durchaus
erfüllte: Seine Landwirtschaft war in der Lage, die
notwendigen Überschüsse zu erzeugen. Es gab
hochqualifizierte Fachkräfte nicht nur im Textilbereich,
sondern auch in der Stahlproduktion oder im Schiffbau. Es gab
genügend Geldreichtum für potentielle Investitionen und
auch unternehmerische Initiative (vgl. Kennedy 1989: 42 f.).
Drittens hätte sich die industrielle Überlegenheit
Englands umgekehrt jedenfalls nicht in diesem Ausmaß entfalten
können ohne die gewaltsam hergestellten
Absatzmöglichkeiten. So musste Indien z.B. Stoffe aus
Großbritannien einführen, weil die im Land für den
eigenen Markt hergestellten Stoffe von der Kolonialmacht mit hohen
Steuern belegt wurden. Ohne diese Maßnahme aber, meint die
1826 erschienene History of British India, „hätten die
Mühlen von Paisley und Manchester gleich zu Anfang mit ihrer
Arbeit aufgehört und wären kaum wieder in Bewegung zu
setzen gewesen, nicht einmal durch Dampfkraft. Sie wurden durch die
Opferung der indischen Hersteller geschaffen“ ( Chomsky 2001:
42). Die Mechanisierung der Weberei, die seit 1825 erfolgte, konnte
erst „unter dem Anreiz der Außenmärkte
stattfinden“; und der enorme Anstieg des Imports von
Rohbaumwolle bzw. des Exports von Fertigbaumwolle führte zu
Transportschwierigkeiten und so zum Bau der ersten
Gütereisenbahn zwischen Manchester und Liverpool 1830
(Bergeron, Furet, Kosselleck 1974: 190f.). Der Kolonialismus ist
demnach nicht nur im Freihandel, sondern auch in der industriellen
Entwicklung Englands als (eine) Voraussetzung enthalten.
Das muss den damaligen Liberalen
übrigens sehr wohl bewusst gewesen sein. Denn bei aller Kritik
am Kolonialismus im Allgemeinen (Disraeli 1852: „Diese
verdammten Kolonien ... sind ein Mühlstein um unseren
Hals!“) haben sie die Herrschaft über Indien
seltsamerweise nie infragegestellt. „Sogar die
entschiedensten Vertreter des Freihandels und des Laissez-faire
wurden Manipulatoren von Zolltarifen und zu bürokratischen
Planern, wenn es um Indien ging“ (Eldridge 1998: 58).
Es ist wahr, dass die Liberalen schon seit
Adam Smith und Jeremy Bentham („Emanzipiert eure
Kolonien!“ 1793) den Kolonialismus und eine kostspielige
Außenpolitik überhaupt ablehnten. Als sie sich seit den
40er Jahren durchzusetzen begannen, gab Großbritannien in der
Tat auch Kolonien frei (Kanada, Australien, später
Südafrika) und wandte sich zugleich international gegen eine
weitere koloniale Expansion.
Es ist jedoch ebenso wahr, dass England zur
selben Zeit sein Kolonialreich – sozusagen im Selbstlauf
– immer noch jährlich durchschnittlich um 250000 qkm
ausdehnte (Kennedy 1989: 246), und dass andere, nicht unmittelbar
unter britischer Herrschaft stehende Regionen der Erde von der
Wucht seines Exports getroffen wurden. Sie wurden zu einer
Arbeitsteilung mit England gezwungen, die der merkantilistischen
durchaus analog war. Man denke nur an den Opiumkrieg: Das
große China sah gar keinen Grund, mit den westlichen Barbaren
in intensiveren Austausch zu treten. Die Briten fanden aber heraus,
dass Indien sich auch sehr kostengünstig auf den Anbau von
Mohn spezialisieren ließ, der dann ins benachbarte China
exportiert wurde. Begreiflicherweise unterband das chinesische
Reich jedoch 1800 den Import, weil das Opium seiner Auffassung nach
die Gesundheit der Bevölkerung gefährdete. Daraufhin
wurde es lange Jahrzehnte eingeschmuggelt, bis 1838 ein rigoroser
chinesischer Beamter große Mengen der Droge beschlagnahmen und
alle ausländischen Warenkontore schließen ließ. Die
Folge war, dass England China den Krieg erklärte, um die
Öffnung der Häfen für den Drogenimport zu erzwingen,
was ihm 1842 schließlich gelang. Auch etwa Ägypten oder
die lateinamerikanischen Staaten, die sehr wohl über ein
Indus trialisierungspotential verfügten (Brasilien,
Argentinien), gerieten unter den deindustrialisierenden Einfluss
des Handels mit England.
Das war der reale Hintergrund, auf dem sich
die Freihandelsidee durchsetzte. Großbritannien verband mit
der Aufhebung der Kornzölle (1846) und der Navigationsakte
(1849) die Hoffnung, dass die anderen europäischen Staaten
seinem Beispiel folgen würden. Diese Hoffnung war nicht
unbegründet, denn viele von ihnen verfügten ebenfalls
über Kolonien, und aufgrund des langen Friedens waren die
politischen Voraussetzungen günstig. In der Tat folgte Holland
sofort, Spanien 1850, und mit dem Handelsvertrag von 1860 zwischen
England und Frankreich (sog. Cobden-Vertrag) gelang über die
Meistbegünstigungsklausel der Durchbruch für fast ganz
Europa. Zahlreiche internationale Abkommen (z. B. zur Sicherung der
Freiheit auf den Meeren) und die ersten Weltausstellungen
vervollständigten das Bild des friedlichen Handels und Wandels
(Palmade 1974: 120ff.).
Doch die Zeit des Glücks währte
nicht lange. Schon nach der Wirtschaftskrise von 1873 lebte der
Protektionismus wieder auf. Weil das neue Deutsche Reich von der
Krise besonders betroffen war und über keine kolonialen
Ausweichmöglichkeiten verfügte, wurde es zu seinem
Vorreiter. 1879 beschloss der Reichstag hohe Zölle sowohl auf
Eisenwaren als auch auf landwirtschaftliche Erzeugnisse. Als die
deutsche Industrie daraufhin den Spitzenplatz in Europa eroberte,
zogen ab 1890 die anderen Staaten nach. Auch Großbritannien
spürte natürlich die deutsche und amerikanische
Konkurrenz. Die 1881 gegründete „Fair Trad League“
konnte sich aber nicht durchsetzen. Warum hielt England bis zum 1.
Weltkrieg im Grunde am Freihandel fest, obwohl es sich bekanntlich
am Imperialismus durchaus beteiligte? Weil das Empire einen
riesigen geschützten Markt bildete, auf den es ausweichen
konnte, wenn in Europa Marktanteile verloren gingen!
Wir halten fest, dass die Freihandelstheorie
nach rund 200 Jahren protektionistischer Vorbereitung ganze 30
Jahre erfolgreich praktiziert wurde; und zwar exklusiv von den
europäischen Staaten, die an der ersten industriellen
Revolution teilnahmen.


|