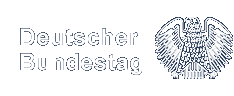Protokoll 14/84
14. Wahlperiode
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
84. Sitzung
Berlin, den 20. Februar 2002, Beginn 10.30 Uhr
(Sitzungssaal: 2.200, Paul-Löbe-Haus)
Vorsitz: Christel Riemann-Hanewinckel (SPD)
Öffentliche Anhörung zu folgenden Vorlagen:
Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres und anderer Gesetze
(FSJ-Förderungsänderungsgesetz - FSJGÄndG)
-Drucksache 14/7485-
federführend:
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
mitberatend:
Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Haushaltsausschuss
Verteidigungsausschuss
Gesetzentwurf des Bundesrates
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres und zur Änderung des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres
-Drucksache 14/5120-
federführend:
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
mitberatend:
Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Antrag der Abgeordneten Gerhard Schüßler, Ina Lenke, Ernst Burgbacher, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
Deutschland braucht gesetzliche Rahmenbedingungen für einen allgemeinen Freiwilligendienst
-Drucksache 14/7811-
federführend:
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
mitberatend
Rechtsausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung
Ausschuss für Kultur und Medien
Berichterstatter:
Abg: Dieter Dzewas (SPD)
Abg. Christian Simmert (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Abg. Thomas Dörflinger (CDU/CSU)
Abg. Ina Lenke (FDP)
Abg. Monika Balt (PDS)
84. Sitzung
Beginn: 10.30 Uhr
Vorsitzende: Ich bitte jetzt alle die, die noch keinen Platz gefunden haben, sich zu setzen. Ich möchte gern die Anhörung des Ausschusses beginnen, wir sind schon etwas verspätet.Als Ausschussvorsitzende bitte ich vor allem die Sachverständigen um Entschuldigung, dass sie etwas warten mussten. Wir haben heute ein ziemliches Gedränge, weil wir die Anhörung schon während unserer eigentlichen Ausschuss-zeit beginnen und hatten deshalb etwas Mühe, unser Pensum an mitberatenden Vorlagen, auch wirklich bis um 10.30 Uhr abgearbeitet zu haben.
Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, die Sachverständigen, die Ausschussmitglieder und alle die, die neugierig und interessiert sind.
Wir haben im Ausschuss beschlossen, dass die öffentliche Anhörung maximal bis 13.30 Uhr dauern wird. Der Ablauf der Anhörung wird so sein, dass die Sachverständigen gebeten sind, dem Ausschuss in einem kurzen mündlichen Statement von maximal 5 Minuten ihre, ich sage einmal Highlights oder ihre Besonderheiten oder das, was Sie noch einmal zuspitzen möchten, darzustellen. Es wird dann Gelegenheit sein, von Seiten der Abgeordneten in zwei Fragerunden Fragen zu stellen, und Sie haben dann auch die Möglichkeit zu antworten. und auch das eine oder andere, was in dem Kurzstatement vielleicht nicht benannt werden kann, noch deutlich zu machen. Außerdem liegen dem Ausschuss ihre schriftlichen Stellungnahmen vor. Diese müssten auch in dem Sinne im mündlichen Statement nicht unbedingt wiederholt werden. Aber es liegt bei Ihnen, was Sie dem Ausschuss hier noch mit auf dem Weg geben wollen.
Grundlage unserer Anhörung sind einmal der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung eines Gesetzes zur Förderung eines Freiwilligen sozialen Jahres und anderer Gesetze; der Gesetzentwurf des Bundesrates, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung eines Gesetzes zur Förderung eines Freiwilligen sozialen Jahres und zur Änderung eines Freiwilligen ökologischen Jahres und der Antrag der Abgeordneten Gerhard Schüßler und der FDP, Deutschland braucht gesetzliche Rahmenbedingungen für einen allgemeinen Freiwilligendienst, zu denen Sie dann Stellung beziehen können.
Vielleicht ist es eine etwas ungewöhnliche Situation hier, es ist das erste Mal, dass wir in diesem Ausschusssitzungssaal in der regulären Ausschusszeit eine öffentliche Anhörung durchführen. Ich stelle jetzt schon fest, dass der Saal nicht nur sehr voll ist, und ich hoffe, dass wir keine Probleme mit der Luft haben werden. Dies ist auch der erste Probelauf für die Klimaanlage in diesem Raum. Für die Sachverständigen ist es vielleicht eine etwas eigenartige Situation, dass sie wie in einem Aquarium sitzen und wir Sie von allen Seiten begucken können. Leider ist es anders nicht möglich. Sie sehen das große Interesse der Kolleginnen und Kollegen. Wir hatten erst überlegt, ob wir Sie in die vordere, obere Reihe mit hineinnehmen, aber das reicht eben auch nicht aus. Obwohl wir nun schon so viel neu gebaut haben, ist das Problem, einen entsprechenden Sitzungssaal zu bekommen, immer ein großes Problem. Vielleicht hätten wir ausweichen können und wir wären nach, was weiß ich wohin, z.B. an den Müggelsee ausgewichen. Aber das hätte sehr viele Probleme mit sich gebracht technischer Art und auch hinsichtlich der Frage der Zeit. Deshalb probieren wir es also hier in dieser Enge. Vielleicht bringt dann auch die Enge eine Erhöhung des Engagements, denn davon können hier, glaube ich, alle ausgehen, dass das Thema, das wir heute zu behandeln haben, für alle ein sehr wichtiges Thema ist.
Jetzt noch ein technisches Problem: Wir haben keine Chance, dass an diesem Tisch an dem Sie sitzen, Tischmikrofone aufgestellt werden können. Deshalb steht dort ein so einsames Standmikrofon, und meine Frage oder die Bitte ist, ob Sie ihre Statements bzw. dann auch ihre Antworten dort an diesem Mikrofon abgeben können. Der- und diejenige, die dann reden, sind dadurch deutlich herausgehoben.
Ich muss noch einige weitere organisatorische Dinge deutlich machen. Die Zeitvorgabe ist bei 5 Minuten. Es ist außerdem so, dass es, nachdem die Statements abgegeben worden sind, bestimmte Regularien für die einzelnen Fraktionen in den Fragerunden gibt. Innerhalb der Zeit, die dann vorgegeben wird, ist auch die Antwortrunde zu gestalten.
Ein nächster Punkt, alle schriftlichen Statements liegen aus, die kann man sich mitnehmen. Das gilt auch für die Gäste. Ich bitte die Sachverständigen, wenn es nicht schon geschehen ist, sich noch einzutragen und dann auch, wenn Sie ihr Statement abgeben, deutlich den Namen und Verband oder Ihre Behörde zu nennen. Das ist dann einfach wichtig für das Protokoll. Das Protokoll wird ein Wortprotokoll sein und wird hier vom Deutschen Bundestag so schnell es irgendwie geht - ich gehe davon aus in den nächsten 14 Tagen - erstellt sein. Pausen sind in der Anhörung nicht vorgesehen. Das heißt, wer aus welchem Grund auch immer den Raum verlassen muss oder möchte, tut das einfach. Das ist hier so üblich. Das ist auch bei den Abgeordneten so und das gilt dann auch für alle anderen. Es wird durch die Firma Dussmann hier eine Versorgung im Raum mit Getränken oder auch Kleinigkeiten möglich sein.
Ich bitte außerdem noch darum, alle mitgebrachten Handys aus- oder still zu schalten, wenn es denn nicht zu umgehen ist, dass man angerufen werden muss. Heute gibt es noch eine Besonderheit: ?PHOENIX? wird die Anhörung aufzeichnen und so weit mir gesagt worden ist, am Freitag nachmittag ausstrahlen. Also, wer das weitersagen möchte, bzw. alle, für die das dann noch interessant sein könnte, Verbände, Vereine usw., haben dann die Möglichkeit, die gesamte Anhörung noch einmal zu sehen.
So, das war eine lange Vorrede, und jetzt bitte ich die Sachverständigen in der alphabetischen Reihenfolge, das ist immer die unverfänglichste Methode. Das heißt, Jörn Fischer, der Bundesvorsitzende von "Grenzenlos e.V? beginnt. Sie haben das Wort für 5 Minuten, bitte schön.
SV Jörn Fischer: Mein Name ist Jörn Fischer, ich bin Vorsitzender von "Grenzenlos e.V.". Wir sind eine träger- unabhängige Vereinigung von ehemaligen und aktiven internationalen Freiwilligen und fungieren gleichzeitig als Dachverband der von internationalen Freiwilligen gegründeten ehemaligen Organisation. Ich habe selbst meinen Dienst im Ausland, in Uruguay, absolviert und bin Verfasser von zwei Büchern zum Thema ?Internationale Freiwilligen-dienste". Da wir in erster Linie die Interessen der Auslandsfreiwilligen vertreten, werde ich in den folgenden Ausführungen vor allem auf die internationalen Dienste eingehen.
Aus meiner Sicht stellt sich die Entwicklung dieses Gesetzes so dar, dass gesagt wurde: In Ordnung, wir reformieren das FSJ-Gesetz und ganz nebenbei versuchen wir diejenigen zu befrieden, die mittlerweile seit Jahrzehnten gesetzliche Rahmenbedingungen für die internati-onalen Dienste fordern. Und dass das Gesetz auf diese Art und Weise gestrickt wurde, merkt man der Regelung der internationalen Dienste an.
Um es kurz zu machen: Der Gesetzentwurf berücksichtigt nicht die besonderen Anforderungen der Freiwilligen zum Ausland, damit meine ich z. B. die Regelung zur Dauer, die umfassende Sozialversicherungspflicht, die Sprach-kursregelung, die Art der Träger-anerkennung etc.
Damit keine Missverständnisse entstehen, wir wenden uns nicht gegen eine soziale Absicherung der Freiwilligen, im Gegenteil. Aber in diesem Fall verursacht sie den Trägern der Dienste so hohe Kosten, dass sich nur wenige den Luxuswert leisten können, einen Dienst im Ausland nach dem geplanten FSJ-Gesetz anzubieten. Außerdem manifestiert der geplante sozialrechtliche Status den Arbeitnehmerstatus der Freiwilligen, was sich insbesondere auf die aufenthalts-rechtliche Situation im Gastland negativ auswirkt. Uns erreichen immer wieder Nachrichten, nach dem ein Dienst aus auf-enthaltsrechtlichen Gründen abgebrochen werden musste oder erst gar nicht angetreten werden konnte.
Nach meiner Einschätzung wird das Gesetz für die internationalen Dienste voraussichtlich nicht oder nur sehr wenig zur Anwendung kommen.
Die Freiwilligen werden weiter gezwungen sein, die Dienste im gesetzlich nicht geregelten Bereich im Ausland zu leisten. Da uns vollkommen klar ist, dass von diesem Gesetz keine fundamentalen Änderungen mehr zu erwarten sind, haben wir uns Gedanken gemacht, wie die mit den ungeregelten Diensten verbundenen Härten und Nachteile für die Freiwilligen ausgeglichen werden könnten. Zu diesen Härten und Nachteilen gehört, dass die Absolventen von internationalen Diensten Einschränkungen in Kauf nehmen müssen, bei Hochschulzulassung, Waisenrente, Kindergeld, Arbeitslosengeld, um nur einige zu nennen.
Und unser Vorschlag besteht darin, in weiteren Artikeln zu diesem Gesetzentwurf Einzelgesetze zu ändern und so einen Ausgleich von Nachteilen für die jungen Freiwilligen zu erreichen. So würde z. B. in das Hochschulrahmengesetz aufgenom-men werden, dass Freiwillige, die einen Dienst im Ausland leisten, der bestimmten Anforderung zu entsprechen hat, nicht benachteiligt werden, wie dies bereits für Freiwillige im FSJ der Fall ist. Diese Änderungen sind ohne großen Aufwand zu realisieren und würden zudem fast kostenneutral ausfallen. Gleiches gilt für die Fortzahlung von Kindergeld und Waisenrente. Beim Kindergeld wurde für die Dienstleistenden nach §14 b, dem anderen Dienst im Ausland, zum 1. Januar dieses Jahres erfreulicherweise ja bereits eine solche Lösung umgesetzt. Eine ähnliche Lösung ist für jegliche Art von internationalen Diensten erstrebenswert. Ich möchte Sie daher bitten, für die vielen betroffenen Freiwilligen noch in diesem Gesetz Abhilfe zu schaffen und so einen großen Schritt zur Verbesserung der Situation zu tun.
Konkrete Vorschläge befinden sich im Anhang der schriftlichen Stellungnahme, die ich verfasst habe. Dennoch sollte klar sein, dass das nur ein wichtiger Zwischenschritt sein kann auf dem Weg zu einem umfassenden Freiwilligengesetz. Gestatten Sie mir noch eine kurze Schlussbemerkung. Die unglaubliche Diskrepanz zwischen den Sonntagsreden der Politiker über die Bedeutung von freiwilligem Engagement und inter-kultureller Erfahrung einerseits und der politischen Realität andererseits wirkt auf junge Menschen frustrierend und demotivierend, und zwar genauso für die, die einen Freiwilligendienst im Ausland leisten wollen und abgewiesen werden, weil es zu wenig Einsatzstellen gibt, genauso auch für die Freiwilligen, die einen Dienst leisten oder geleistet haben, aber ohne den adäquaten rechtlichen Rahmen. Die junge Generation ist bereit sich zu engagieren, aber die Politik ist bislang nicht fähig dazu, die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen. Danke.
Vorsitzende: Das war auch, was die Zeit angeht, genau richtig. Dankeschön.
Herr Gerstberger, bitte, von der Robert-Bosch-Stiftung.
SV Günter Gerstberger, Robert Bosch Stiftung: Verehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich darf mich sehr herzlich bedanken für diese Gelegenheit, hier vorzutragen und Erkenntnisse und Erfahrungen der Robert-Bosch-Stiftung in diesen Novellierungs-prozess einzubringen. Die Robert-Bosch-Stiftung hat 1998 ein Manifest für Freiwilligendienste ?Jugend in der Gemeinschaft? zusammen mit einer Kommission von Experten und jungen Bundestagsabgeordneten vorgelegt, und diese Stellungnahme ist mit ihnen auch abgestimmt. Es ist sehr zu begrüßen, die Ausweitung der Tätigkeitsfelder über das Soziale im engeren Sinn hinaus, die Flexibilisierung des Mindestalters für Freiwilligendienste und die Anerkennung des Freiwilligendienstes als Zivildienst-ersatz. Sehr zu bedauern bleibt, dass der Reformvorschlag das Versprechen einer Regelung grenzüberschreitender Dienste nicht einlöst und einen Dienst vorsieht der weiterhin mit dem europäischen Freiwilligendienst nicht kompatibel ist. Damit harren die mit Stimme der Bundesregierung verabschiedete Mobili-tätsempfehlung der EU und der Beschluss des europäischen Parlaments weiter ihrer Umsetzung. So werden auch die, mit der europäischen Einigung verbundenen neuen Möglichkeiten und Chancen, gerade auch für junge Menschen, nicht ausgeschöpft.
Zum FSJ/FÖJ-Änderungsgesetz: Als FSJ-Änderungsgesetz bleibt der Entwurf bewusst innerhalb der engen Grenzen eines stark regulierten Freiwilligendienstes und der damit einher gehenden Beschrän-kungen und Kapazitätsprobleme. Er hält an den überkommenen Prinzipien der Träger, ihrer Anerkennung und Alimentierung durch staatliche Stellen fest und verkennt, dass der freiwillige Dienst, das heißt die unentgeltliche Dienstleistung zur Erfüllung von Aufgaben des Gemeinwohls, seine Legitimation nicht aus staatlicher Gewährleistung, sondern aus der Inanspruchnahme von Grund- und bürgerlichen Freiheiten bezieht. Befriedigende Regelungen, so unsere Auffassung zur Beseitigung der bekannten und weiterhin ungelösten Probleme, lassen sich nur im Rahmen eines Gesetzes für einen allgemeinen Freiwilligendienst treffen, der über die engen Führungen eines speziellen Dienstes hinausgeht, die Rechtsgrundlage fixiert, die Praxis aber weitestgehend in die Verantwortung der gesellschaftlichen Gruppierungen legt, die diese Dienste durchführen.
Ein solches Gesetz hat den Rechtsstatus eines Freiwilligen im Gegensatz zu einem Arbeitnehmerstatus oder Auszubildenden-status festzulegen. Angesichts der veränderten Sicherheitslage und auch des damit verbundenen schwindenden Bedrohungsbewusstseins, insbesondere aber mit Blick auf die veränderten Anforderungen an die Streitkräfte, ist die allgemeine Wehrpflicht auch in Deutschland immer weniger zu begründen. Dazu ist eine Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zu erwarten. Nur ein allgemeiner deregulierter Freiwilligendienst, der einen offenen und vielfältigen Markt von Freiwilligen schafft und von ihnen lebt, kann dann den Bedarf an Diensten auffangen.
Wir meinen, das Manifest hat von seiner Aktualität nichts verloren, und wir danken der FPD-Fraktion sehr, dass sie die Forderung des Manifests aufnimmt und sich für einen allgemeinen bürger-gesellschaftlich getragenen Frei-willigendienst einsetzt. Auch im Falle einer Zustimmung zu dem vorliegenden Gesetzesentwurf zur Novellierung von FSJ/FÖJ mit der einen oder anderen Modifikation - wir kommen sicherlich nachher darauf - bleibt das Thema "Jugendfreiwilligendienste" auf der politischen Tagesordnung und sollte in grundsätzlicher Weise in der kommenden Legislaturperiode vom Parlament aufgegriffen werden.
Es ist prinzipiell zu begrüßen, dass das Ausland mit einbezogen ist, dass die Einsatzfelder ausgeweitet werden - alles dies ist dringend zu empfehlen. Ich komme zu einzelnen Punkten:
Die Einsatzfelder auf den gemeinnützigen Bereich insgesamt auszuweiten und unbedingt auch den Kulturbereich in seinen vielseitigen Fassetten mit dazu zu nehmen: Warum nicht die im deutschen Kulturrat zusammengeschlossenen Ein-richtungen? Dazu gehören sollten unbedingt auch bürgerschaftliche Initiativen, Familienzentren, Dorfclubs, Selbsthilfegruppen.
Die Formulierung "praktische Hilfs-tätigkeit" halten wir abgesehen von der negativen Kommentation für unglücklich. Ein Freiwilligendienst muss attraktiv sein. Er muss sich auszeichnen durch Herausforderungen an die Kreativität, an die Eigeninitiative. Er muss auch anspruchsvolle berufsqualifizierende Elemente erhalten und nicht eben nur in dem engen Sinn ein Hilfsdienst und ein Lerndienst sein.
Die pädagogische Begleitung ist ein weiterer wichtiger Punkt, an dem wir meinen, dass der vorliegende Gesetzesentwurf weiter gefaßt werden könnte, ohne all zu sehr doch ins Grundsätzliche gehen zu müssen. Die pädagogische Begleitung sollte im wesentlichen vor Ort geleistet werden.
Er sollte auch Mentoren, Ehrenamtliche vielmehr umfassen, sie grundsätzlich auch in dem Entwurf, in dem Gesetz festschreiben und systematisch Träger und Einsatzstellen dazu auffordern, das Potential solcher ehrenamtlicher Mentoren zu erschließen. Besonders für schwierigere Gruppen, benachteiligte Gruppen, Aussiedler, Ausländer ist es sehr wichtig, solche Einzelpersonen vor Ort zu haben, die die jungen Menschen im Sinne einer sozialen Elternschaft begleiten. Es ist völlig klar, dass ein guter Freiwil-ligendienst Bildungsangebote und kundige Begleitung haben muss. Er braucht sein Maß an Professionalität. Allerdings meinen wir, wäre es weitaus sachdienlicher die ?Bildungstage? nicht auf eine bestimmte Zahl fest zu schreiben und sie durch einen zentralen Träger durchführen zu lassen. Sondern dies ist auch in die Einsatzstellen selbst zu geben, in die Verantwortung der Stellen vor Ort, die selber besser wissen, was von der Einsatzstelle geleistet werden und wie ein auf den Freiwilligen zugeschnittenes Programm gemacht werden kann. Und, dass dann hinterher selbstverständlich auch im Zeugnis, in dem Zertifikat, das unbedingt Bestandteil des Freiwilligendienstes sein sollte, dieses dann gehörig zur Geltung kommen kann. Ich sehe auf die Uhr, ich habe leicht überschritten. Nachher gibt es sicherlich noch Gelegenheit auf Einzelheiten einzugehen. Ich danke Ihnen.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Gerstberger. Jetzt bitte ich Herrn Hinrich Goos, vom Bundesarbeitskreis "Freiwilliges ökologisches Jahr. Bitte schön.
SV Hinrich Goos, Bundesarbeitskreis FÖJ, Betreuungsstelle beim Jugendpfarramt der Nordelbischen Kirche:
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, auch ich danke für die Einladung. Ich spreche für den Bundesarbeitskreis "Freiwilliges ökologisches Jahr", ein junger Zusammenschluss. Wir haben uns im Mai letzten Jahres erst gegründet und sind daher auch noch in der Findungsphase für unsere Stellungnahmen, für unsere Position, aber wir haben sie ja dann noch schriftlich eingereicht.
Ich möchte einige Punkte ansprechen und vielleicht auch schon auf meine Vorredner eingehen. Wir begrüßen es, dass es weiterhin in diesem Gesetz dieses zentrale Trägerprinzip fest geschrieben gibt. Denn in dem Bereich, der in Richtung Arbeitsmarkt geht und wo die Gefahr der Ausnutzung besteht, ist so eine aufsichtliche Einrichtung für uns unabdingbar, die wir mit unserer zentralen Trägerschaft haben.
Die drei gesetzlichen Regelungen, über die wir heute sprechen, bieten unserer Meinung nach einige Vorteile, aber en gros erreichen sie doch nicht das, was sich viele junge Menschen letztlich erhofft haben. Ich will das auch insbesondere in Bezug auf das Ausland, was auch im ökologischen Bereich für junge Menschen sehr interessant ist, konkretisieren:
Ganz aktuell sind die Anfragen um neue Plätze, die ja durch die erfreuliche Haushaltsaufstockung möglich geworden sind, von den Trägern gar nicht weiter ausgeschöpft. Es sind gut 200 neue Plätze beantragt, aber davon praktisch keine im Ausland. Also, wenn das Gesetz so verabschiedet wird, wie jetzt hier, werden wir damit nicht diese Steuerungswirkung erreichen, die Sie sich vielleicht als Abgeordneter auch erhofft haben. Das liegt an einer auch als Verschlechterung zu bezeichnenden Situation. Bisher war es ja durchaus möglich, einen Freiwilligendienst im Ausland - auch in Europa - zu machen. Das ist ganz vorsichtig von einigen Trägern in Angriff genommen worden, aber war auch immer noch nicht attraktiv genug.
Die Attraktivität ist aber vermindert, da jetzt die lange Vorbereitungszeit, einschließlich Sprachschule in Deutsch-land, hinzu gekommen ist, und die für uns auch als quasi Supervision oder Reflektionsbetreibung notwendige Semi-nartätigkeit im Ausland nicht gegeben ist. Es sei denn, es wird noch einmal wieder zusätzlich geleistet zu dem, was gefördert wird.
Was die Altersänderungen angeht, so halten wir es gerade im freiwilligen ökologischen Jahr, wo die Einsatzstellen vielleicht anders noch in der Gesamtheit als im FSJ mehr dezentral verteilt über ganz Deutschland oder nachher auch im Ausland liegen, für äußerst problematisch. Also, man kann nicht so leicht größere Einheiten zusammenfassen, das konkretisiert sich am Beispiel Schleswig-Holstein: 100 Einsatzplätze und die sind eben über das ganze Land verstreut. Da ist die Erreichbarkeit dann schon schwierig. Wir bemängeln auch, dass es nicht konkreter gefaßt worden ist, was die pädagogische Betreuung, auch der Einsatzstellen, angeht. Denn das Prinzip, das Herr Gerstberger hier angesprochen hat, dass es eine fachliche und persönliche Betreuungsperson auch im FÖJ gibt, ist ja eigentlich bereits Standard. Nur die Schulung dieser Leute ist im Augenblick im Gesetz nicht konkreter geregelt, bzw. auch in der Vergangenheit sind leider die Arbeitstagungen, die nach dem Bundesjugendplan für eine solche Fortbildung eigentlich möglich werden, nicht mehr in die Förderung eingeflossen.
Was wir weiter für einen ganz großen Nachteil halten, ist die Verblockung von Kurzzeitblöcken die dann über zwei Jahre gestreckt werden können. Wir sehen nicht die Möglichkeit, mit den Jugendlichen prozesshaft zu arbeiten und sie auch zu den Erfolgserlebnissen zu führen, die sie jetzt nach einem einjährigen Freiwilligendienst bei uns erhalten.
Wir haben dazu auch Befragungen bei den Jugendlichen gemacht, und die Jugendlichen haben sich auch entschieden dagegen ausgesprochen, dass diese Verblockung stattfindet. Die Jugendlichen, die bei uns nach vielleicht kürzeren Zeiten anfragen, die sind in der absoluten Minderzahl. Wir sehen nicht die immer wieder behauptete große Nachfrage für diesen Bereich.
Ich denke, die anderen Punkte sind einfach schon mehrfach angesprochen worden, und vielleicht nehmen wir uns viel mehr Zeit für Ihre Fragen auf und für die Diskussion. Und deshalb stoppe ich dann erst einmal hier.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Goos. Ich bitte jetzt Herrn Walter Kohler, Referatsleiter im Sozialministerium Baden-Württemberg, zu Wort.
SV Walter Kohler, Referatsleiter im Sozialministerium Baden Württemberg: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Vorgestellt bin ich bereits. Mein Name ist Walter Kohler, ich leite das Referat Pflegeberufe, Freiwilliges soziales Jahr und Zivildienst im Sozialministerium Baden-Württemberg, und ich danke Ihnen, dass ich die Möglichkeit habe, bestimmte baden-württembergische Anliegen hier in diese Diskussion einzubringen.
Wenn es um das freiwillige Engagement der Bevölkerung geht, sprechen wir im Südwesten gern vom Bürgerland Baden-Württemberg. Wir haben vor über 10 Jahren damit begonnen neben dem traditionellen Ehrenamt neue Formen freiwilligen Engagements der Bürgerinnen und Bürger in einem offenen Diskussionsprozess zu diskutieren und modellhaft zu entwickeln.
Ich denke, es kommt nicht von ungefähr, wenn wir heute sagen können, dass etwa 20% aller Zivildienstleistenden im Bundesgebiet aus Baden-Württemberg kommen. Derzeit sind wir dabei, über lokale Freiwilligendienste jungen Menschen von 14 bis 27 Jahren unterschwellig, zeitlich befristet und vielfältig neben Schule, Ausbildung, Beruf und Studium Zugang zum Freiwilligen Engagement und zum Dienst in der Gesellschaft eröffnen. Wir denken dabei an Projekte im Bereich des Sozialen, der Kultur, der Ökologie, der Bildung und der Politik. Die Richtgröße liegt dabei bei etwa 40 Stunden, und wir denken an eine Begleitung durch Mentoren, die das aus der Bürgerschaft heraus freiwillig tun und die aus Mitteln der Landesstiftung Baden-Württemberg fortgebildet werden. Das freiwillige soziale Jahr und das freiwillige ökologische Jahr müssen nach unserem Verständnis in diesem Zusammenhang verankert werden. Für uns bedeutet dies, dass sie für die jungen Menschen die bereit sind aus einer gewissen Unverbindlichkeit heraus zu treten und weiterreichende Verpflichtungen zugunsten der Gemeinschaft einzugehen, eine logische Fortsetzung des freiwilligen Engagements sind. Um einen möglichst breiten Personenkreis auf die Angebote des freiwilligen sozialen Jahres und des freiwilligen ökologischen Jahres ansprechen zu können, wollen wir hier möglichst viele Aufgabenfelder öffnen über das hinaus was bislang jetzt schon geschehen ist. Dienst an der Gemeinschaft soll Spaß machen, und Spaß machen kann er nur, wenn man ernst genommen wird in diesem Dienst, wenn man seinen eigenen Neigungen in diesem Dienst nachgehen kann. Die Dienstbereitschaft muss zeitlich dann angenommen werden, wenn sie da ist und sie sollte soweit wie möglich auch an der zeitlichen Verfügbarkeit des Bewerbers gemessen und akzeptiert werden. Der jetzt vorliegende Änderungsentwurf zum Freiwilligen-Sozialen-Jahrgesetz und zum Freiwilligen-Ökologischen-Jahrgesetz greift einen Teil unserer Überlegungen auf. Er lässt weiteren Spielraum bei der Anerkennung von Einsatzstellen. Hinzu gekommen sind Einrichtungen der Jugendbildung, Einrichtungen der Jugendarbeit und kulturelle Einrichtungen. Die Senkung des Mindestalters kommt vor allem Absolventen der Hauptschulen und Realschulen entgegen, die bislang bei Erreichen der Altersgrenze bereits in der Ausbildung und damit eigentlich für diesen freiwilligen Dienst verloren waren. Die Möglichkeit der Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres oder freiwilligen ökologischen Jahres in Blöcken könnte auch für die Schaffung ergänzender Angebote dienen, etwa für eine Verbindung mit der Nachholung einer mittleren Reife.
Die Verlängerungsmöglichkeit auf bis zu 18 Jahre - vermerkt sei hier z. B., Lücken zwischen Teilnahme FSJ und FÖJ bis zur Aufnahme einer Berufsausbildung, eines Studiums usw.- zu schließen; die Anrechnung der Teilnahme am freiwilligen sozialen Jahr oder freiwilligen ökologischen Jahr schließlich auf den Zivildienst schafft eine bisher nicht dagewesene Wertigkeit. Dies geschieht aber auch nur halbherzig. So sehr wir die vorgesehene Anrechnung der Teilnahme am freiwilligen sozialen Jahr auf den Zivildienst dennoch begrüßen, so deutlich muss ich auf die Ungerechtigkeit hinweisen, die der Gesetzentwurf in diesem Punkt für die ganz jungen Teilnehmer bringt.
Voraussetzung für die Anrechnung ist eine vorangegangene Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer. Diese kann man frühestens 6 Monate vor Vollendung des 17. Lebensjahres beantragen, quasi im Hinblick auf die bei der Kriegsdienstverweigerung zu treffende Gewissenentscheidung, die sicher sinnvoll ist. Mit der jetzigen Regelung werden die ganz jungen Teilnehmer aber ganz einfach um die Anrechnung betrogen. Der jetzt vorliegende Änderungsentwurf ist von daher sicher nicht die Weichenstellung, die nach einem Jahr der Freiwilligen angemessen wäre. Wir haben eine ganze Reihe von Wünschen, die wir gerne in einem umfassenderen Freiwilligengesetz geregelt hätten. Dazu gehört die Erweiterung der Einsatzbereiche auf alle Aufgabenfelder, in denen Schlüssel-qualifikation und soziale Kompetenz zum Nutzen der Allgemeinheit erworben werden können. Dazu gehören das freiwillige soziale Jahr und das freiwillige ökologische Jahr auch in Teilzeiten, die Schaffung eines sogenannten Sozial-guthabens, das auch den ganz jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am freiwilligen sozialen Jahr und freiwilligen ökologischen Jahr die Anrechnung auf den Zivildienst und insgesamt die Anrechnung auch auf Anstellungszeiten im öffentlichen Dienst ermöglichen könnte und auch das Problem der Angleichung von sogenannten Entgeltpunkten müßte dann eigentlich auch keines mehr sein. Schließlich stellt sich die Frage nach einem Bundesbeauftragten für die Freiwilligendienste, der zugleich die Bedeutung der Freiwilligendienste für die Gesellschaft verkörpern könnte.
Nun kann man natürlich sagen, dass sich freiwilliges Engagement abgesehen von bestimmten Programmen nur schwer gesetzlich regeln läßt. Es geht uns auch nicht darum jegliches freiwilliges Engagement in ein gesetzliches Regelwerk zu pressen. Die Frage ist aber, ob denn jeder, der Initiative ergreifen will, auch das Rad neu erfinden muss. Und ich denke schon, ein kleines bißchen besseren Service, den man in einem solchen Freiwilligengesetz für diejenigen, die sich engagieren wollen einbringen kann, könnte manchen, der sonst aus Unsicherheit zurückschreckt, dazu bringen, sich nun eben doch in diese Arbeit einzubringen. Vielen Dank.
Vorsitzende:Vielen Dank Herr Kohler.
Frau Helga Salzmann ist die nächste Sachverständige. Sie spricht für die evangelische Kirche in Deutschland. Bitte schön.
SV Helga Salzmann für den Rat der Evangelischen Kirche Deutschlands und für die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege:
Vielen Dank für die Einladung. Ich spreche hier für den Rat der evangelischen Kirche in Deutschland und bin auch gleichzeitig beauftragt worden, für die Bundes-arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege hier das Votum abzugeben. Da war Herr Direktor Steinhilber gemeldet, er kann leider nicht dabei sein. Die BAGfW begrüßt den Gesetzentwurf, weil er Gestaltungs-merkmale setzt und Impulse für die Weiterentwicklung von Freiwilligen-diensten als Bildungszeiten und als Lerndienste gibt und so die langjährigen und guten Erfahrungen des freiwilligen sozialen und des freiwilligen ökologischen Jahres aufnimmt. Die Erweiterung der Einsatzfelder und somit auch die Verbreitung des Interessenspektrums von jungen Leuten ist zu begrüßen.
Sie lassen eine Ausweitung der Freiwilligendienste und eine Erweiterung der Freiwilligenzahlen erwarten. Die Aufnahmen der Möglichkeit, Freiwilligen- dienste im Ausland zu leisten und auch damit als Bildungsstil das interkulturelle Lernen festzuschreiben, wird ebenfalls von uns sehr begrüßt. Nicht zuletzt die Herabsetzung des Alters ermöglicht es auch den Jüngeren mit unterschiedlichen Schulabschlüssen, ohne große alters-bedingte Hemmnisse nach der Schule einen freiwilligen Dienst zu leisten. Der Gesetzentwurf nimmt als Ziel, Härten und Nachteile für die Jugendlichen zu beseitigen.
Die BAGfW stimmt diesem zu, hält es aber für zu kurz gegriffen und zu einseitig. Unserer Meinung nach sollte auch eine Zielbestimmung im Gesetz vorzufinden sein, die einen stärkeren jugendpolitischen Bezug herstellt und die Persönlich-keitsentwicklung als Ziel im Gesetz verankert. Im übrigen muss der Gesetzentwurf daran gemessen werden, ob er in den Einzelbestimmungen den Zielen dient oder sie eher behindert.
Und in diesem Zusammenhang möchte ich auf einige kritische Punkte aufmerksam machen. Der Anteil der unter 18-jährigen im FSJ ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen und liegt jetzt bei ungefähr 35%. Die Trägerverbände haben also in den letzten Jahren bereits viel zur Integration jüngerer Menschen in das FSJ geleistet und getan. Die Erfahrungen zeigen aber, dass jüngere Freiwillige sowohl in der individuellen Begleitung als auch in der Seminararbeit eine dichtere und größere, intensivere Begleitung benötigen. In Zukunft wird es dringend erforderlich sein, das Fördervolumen als Bestandteil der Fördervereinbarung mit den Trägern zu verbessern. Es bleibt zu hoffen, dass aus den Erwartungen, die der Gesetzentwurf aufzeigt, auch förder-politische Konsequenzen gezogen werden. Der Gesetzentwurf wird seinem Anliegen, die Auslandsdienste auszuweiten, nicht gerecht und bleibt hier auch stark unter den Erwartungen zurück. Begrüßenswert ist es, dass in Zukunft ein FSJ/FÖJ auch im außereuropäischen Ausland geleistet werden kann, sowie dass die pädagogische Begleitung in ihrem Umfang festgeschrieben ist. Jedoch die einzelnen Regelungen werden eine Ausweitung verhindern und dies in einem Bereich, der gerade auch für junge Menschen sehr attraktiv ist. Die Begrenzung der Dienstzeit auf 12 Monate ohne Verlängerungs-möglichkeiten ist so ein Hindernis. Gerade bei Auslandsdiensten brauchen junge Leute eine längere Zeit, sich einzugliedern, sich anzupassen an die neue Kultur, an das fremde Umfeld und damit wäre eine Ausweitung der Zeit auch begründet, eine Verlängerung der Zeit ungefähr auf 18 bis 24 Monate. Durch die Sozialversicherung wird ein quasi Arbeitnehmerstatus begründet, der den Status der Freiwilligkeit gerade im Ausland ziemlich unterlaufen kann. Die Auslandsträger, denke ich, werden auch noch mehr dazu sagen, welche Erfahrungen sie da vorliegen haben. Nicht zu verachten ist es auch, dass durch die Sozialversicherung den Trägern so hohe Kosten auferlegt werden, die dann wiederum auch eine Ausweitung verhindern werden.
Offensichtlich ist es politisch gewollt, alle gesetzlich geregelten Freiwilligendienste der Sozialversicherungspflicht zu unterstellen und damit das Risiko einer Stagnation in Kauf zu nehmen. Anders denken wir, kann diese Regelung nicht gedeutet werden. Denn es liegen verschiedene Vorschläge auf dem Tisch, wie eine angemessene und gute soziale Absicherung der jungen Freiwilligen auf anderem Wege erreicht werden könnte. Wir weisen hier auf das schon vor längerer Zeit eingereichte Eckpunktepapier der Kirchen hin, aber auch auf den Beitrag von Rolf Schuler, der Entwurf des FSJ-Förderungsgesetzes vor dem Hintergrund des internationalen Sozialrechtes. Die Festschreibung der pädagogischen Begleitung ist zu begrüßen. Die Regelung allerdings, dass die Seminartage überwiegend in Deutschland stattfinden sollen, ist dem Lerndienst im Ausland und den vorliegenden Erfahrungen derjenigen, die Auslandsdienste organisieren und durchführen, nicht angemessen. Die Effizienz des Lernens und Verarbeitens vor Ort wird dadurch herabgemindert. Auch junge Kriegsdienstverweigerer können nach der Regelung §14c Auslandsdienst leisten. Für sie leistet der Bund eine Kostenerstattung. So erfreulich dieses auf der einen Seite ist, bedeutet es aber eine eklatante Benachteiligung von jungen Frauen, für die die Träger oder die Einsatzstelle die Gesamtkosten aufbringen müßten und die somit kaum eine Chance erhalten werden, in größeren Zahlen an diesem Auslandsdienst teilzunehmen. Zum Zweck der Gleichbehandlung wäre die Kostenübernahme des Bundes auch für junge Frauen erforderlich. Problematisch ist nach unserer Meinung auch die Anerkennung der Träger durch die Länder. Wir plädieren hier dafür, die bisherigen Regelungen einzuhalten und auf das FSJ im außereuropäischen Ausland auszudehnen. Unserer Meinung nach braucht es nach den Erfahrungen hier immer eine dritte Instanz, einen sogenannten Moderator zwischen Freiwilligen und Einsatzstelle, und diese Funktion hat der Träger.
Problematisch ist unserer Meinung nach auch die Verquickung von Freiwil-ligendiensten und Pflichtdiensten. Wenn das Ziel ist, die Freiwilligendienste für die Zukunft zu stärken, müssen auch die Strukturen und Regelungen der Freiwilligendienste anerkannt werden. Wenn dem so sein wird, wird befürwortet und begrüßt, dass ein FSJ anstelle eines Zivildienstes geleistet werden kann. Die Kostenübernahme für junge Zivildienst-leistende ist erfreulich, aber auch hier wieder: es darf kein Verdrängungs-wettbewerb zu Lasten der jungen Frauen geschehen, der ganz leicht geschieht, wenn junge Männer in den Freiwilligendienst kommen und ihre Kosten praktisch mitbringen und Einsatzstellen, die nicht viel Geld aufbringen können, dann auch diese jungen Männer einsetzen. Das sind zum großen Teil attraktive Einsatzstellen, aber diese bleiben dann den jungen Frauen wieder verschlossen, weil sie teurer werden. Wir kriegen zwei Kategorien von Freiwilligen, und das ist sehr problematisch.
Antragstellung auf Kriegsdienst-verweigerung, so ist es geregelt und vorgesehen, muss vor Ableistung des FSJ gestellt sein. Hier betonen die Kirchen, dass dies gerade bei jüngeren Teilnehmern zum Problem und zu Konflikten mit der UN-Kinderrechtskonvention führen wird. Um aus diesen Dilemma herauszukommen, schlagen die Kirchen vor, dass der Zeitpunkt für die Antragstellung unerheblich sein sollte. Sowohl bei Wehrpflichtigen als auch bei Kriegsdienst-verweigerern sollte ein FSJ und FÖJ nachträglich anerkannt werden, unabhängig vom Zeitpunkt der Antragstellung. Ich danke Ihnen.
Vorsitzende: Vielen Dank Frau Salzmann, Sie haben jetzt für den Rat der EKD und die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege gesprochen. Ich bitte jetzt Herrn Schmidt für die deutsche Sportjugend.
SV Rudolf Schmidt, Deutsche Sportjugend - Geschäftsstelle: Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Besucherinnen und Besucher, ich spreche für die deutsche Sportjugend. Die deutsche Sportjugend ist die Dachorganisation des Jugendsports im deutschen Sportbund, und wir haben seit 25 Jahren Erfahrungen im Bereich Zivildienst. Wir sind noch keine Fachorganisation im Bereich des freiwilligen sozialen Jahres. Deswegen will ich mich mit diesbezüglichen Äußerungen zurückhalten. Ich stelle mich aber zur Verfügung, wenn es um die Kombination zwischen Zivildienst und FSJ und speziell um das Thema Modell geht. Insgesamt begrüßt die deutsche Sportjugend den vorliegenden Gesetzesentwurf, mit dem die Absicht verbunden ist, die Anzahl der Einsatzstellen im FSJ, FÖJ deutlich zu erhöhen, die Tätigkeitsbereiche zu erweitern und damit mehr jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, einen Zugang zu einem bildungsorientierten Freiwilligen-dienst zu ermöglichen.
Wir befürchten, dass der Bildungsanspruch des bisherigen FSJ/FÖJ Gesetzes verloren geht, wenn im §2 Abs. 2 des vorliegenden Änderungsgesetzes im wesentlichen abgehoben wird auf überwiegende Hilfstätigkeiten in gemeinwohlorientierten Einrichtungen. Denn wenn man das so definiert, dann kann auch alles dazu gerechnet werden, vor allem unter Berücksichtigung der Erwartung aus dem Zivildienst, jeden Einsatz in den Tätigkeitsfeldern 02, 03 ,05, so heißt es beim Bundesamt für den Zivildienst, konkret Reinigung, Pflege- und Instandsetzungsarbeiten, zu ermöglichen. Unsere diesbezüglichen Erfahrungen im Zivildienst sind negativ: Zivildienst-leistende, die keinen sozialen Dienst oder vorrangig sozialen Dienst leisten, sondern eben Reinigung, Pflege- und Instand-setzungstätigkeiten - Organisationsauf-gaben -, sind häufiger krank, sind demotiviert, sind eher geneigt, Sonder-urlaub einzureichen und dergleichen mehr und bringen letztlich für die Arbeit oder für die Gewinnung von Ehrenamtlichen zumindest im Bereich des Sports nichts.
Die deutsche Sportjugend befürchtet weiterhin, dass eine notwendigerweise schnelle Ausweitung der Platzzahlen im FSJ/FÖJ bei Beibehaltung der bisherigen Anerkennungsverfahren bezüglich neuer Trägerstrukturen z.B. im Sport nicht stattfinden werden. Dazu mache ich gerne Ausführungen, wenn Sie mich dazu befragen.
Ich bin gleichzeitig Stellvertretender Vorsitzender des IJA oder internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland. Und aus dieser Sicht bedauere ich es, dass es mit diesem Gesetz nicht möglich sein wird, das große Interesse von jungen Leuten ihren Dienst im Ausland zu machen auch einigermaßen zu erweitern. Denn es wäre sinnvoll, hier auch unter Gesichtspunkten der Anpassung an europäische Rahmen-bedingungen und gewollte Regelungen der Vereinheitlichung auf dem europäischen Bereich eine deutliche Annäherung in Richtung europäischer Freiwilligendienst zu machen. Und ich befürchte weiterhin, und das ist meine letzte Befürchtung, dass der Versuch, mit diesem Gesetz eine schnelle und auch eine kostenneutrale Regelung für das immer größer werdende Problem, jungen Leuten nach ihrer Schule und nach ihrer Schulpflichtzeit nun einen Zugang zum Ausbildungs- und Berufs-leben zu ermöglichen, keinen Erfolg haben wird.
Vorsitzende:Vielen Dank. Herr Slüter hat jetzt das Wort von dem Bundesarbeitskreis FSJ, ist das richtig, oder BDKJ. Hier gibt es eine kleine Irritation ?
SV Uwe Slüter: Mitarbeiter beim BDKJ, hier als Sprecher des Bundesarbeitskreises FSJ:
Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Möglichkeit, im Rahmen dieser Anhörung für den Bundes-arbeitskreis FSJ Stellung nehmen zu können. Der Bundesarbeitskreis FSJ, das sind die AWO, die AEJ, der BDKJ, der deutsche Caritasverband, das Deutsche Rote Kreuz, der internationale Bund und das Jugendaufbauwerk Berlin mit etwa 13.000 Freiwilligenplätzen im Inland, die unter unserem Dach versammelt sind. Das FSJ ist seit etwa 40 Jahren eine Maßnahme der Jugendbildung. Eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums hat gezeigt, dass das FSJ sowohl von Freiwilligen als auch von Einsatzstellen sehr positiv beurteilt wird und als allgemein akzeptiertes Programm gilt. Die gesetzlichen Veränderungen des FSJ haben bisher nie in die Substanz dieses Programms eingegriffen. Es bleibt eine moratoriums- verlängernde Phase für junge Leute. Es ist ein Lerndienst, und es ist ein Beitrag junger Menschen zu einer demokratischen Gesellschaft, eben ein Jugendgemein-schaftsdienst. Der Gesetzentwurf geht konsequent diesen Weg weiter. Er gibt Impulse für eine Weiterentwicklung auf bewährter Grundlage und deshalb begrüßen wir als Bundesarbeitskreis diesen Gesetzentwurf.
Im Detail begrüßen wir die Beibehaltung der pädagogischen Begleitung, die Integration jüngerer Menschen, auch ab 15 Jahre, die Neuhinzufügung der interkulturellen Dimension dieses Programms, zum Teil die zeitlichen Flexibilisierungsmöglichkeiten und vor allem die Beibehaltung des Trägerprinzips. Natürlich auch die Ausweitung des Einsatzstellenspektrums. Allerdings meinen wir, dass mit diesem Gesetz eine Ausweitung nur sehr begrenzt möglich ist, weil die hohen Sozialversicherungskosten es vielen Einsatzstellen kaum möglich machen werden, neue Einsatzplätze in diesem Bereich anzubieten und es von daher eher eine Stagnation als eine massive Ausweitung geben wird. Wir haben das Problem, dass eigentlich nur im Bereich des § 14 c Zivildienstgesetz eine Aus-weitung möglich sein könnte, und das ist ja kein Freiwilligendienst.
Der Bund sollte an dieser Stelle prüfen, wenn er die Sozialversicherung so gestalten will, wie er sie jetzt in diesem Gesetz gestaltet, ob er Teile der Sozialversicherungskosten aus anderen Töpfen mit übernehmen kann, ansonsten befürchte ich, dass Träger nicht in der Lage sind, Einsatzstellen zu finden, die entsprechend der Nachfrage von jungen Leuten ausreichen. Auch die Förderung für die pädagogische Begleitung, die ja die Träger sicherzustellen haben, benötigt einen Schub, und ich habe den Eindruck, dass auch hier die Unterstützung der Politik notwendig ist, um da noch mehr zu erreichen als die Ministerin im Bundestag schon zugesagt hat. Dafür möchte ich mich allerdings bedanken.
Ja, ich sehe zwei Knackpunkte, die mit dem Gesetz verbunden sind. Das ist zum einen die Frage des Auslandsfreiwilligen-dienstes und zum anderen die Frage des §14 c. Darauf möchte ich kurz noch einmal eingehen.
Zum Ausland: Die neue Möglichkeit, auch außerhalb des europäischen Auslands einen freiwilligen Dienst leisten zu können, die wird von uns nachdrücklich begrüßt. Die Rahmenbedingungen sind allerdings so, dass außerhalb des §14 c kaum Träger finanziell in der Lage sind, diesen Freiwilligendienst im Ausland anzubieten.
Das heißt, jüngere Männer als §14 c, ich nenne die jetzt mal so, sind sozialversicherungspflichtig und leisten einen gesetzlich geregelten Freiwilligendienst. Jüngere Männer unterhalb von sechzehneinhalb Jahren oder siebzehneinhalb Jahren können diesen Dienst so nicht machen, weil sie nicht die Möglichkeit bekommen frühzeitig so ihren auch schon vor der Musterung geleisteten Dienst anerkannt zu bekommen. Jetzt kommt aber das große Problem: Jungen Frauen bleibt nur die Möglichkeit, einen ungeregelten Freiwilligendienst zu leisten und dies ist für mich tatsächlich eine Benachteiligung.
Zum §14 c: Die Träger im Bundes-arbeitskreis werden diesen § 14, das heißt, die Möglichkeit für zivildienstpflichtige junge Männer, anstelle des Zivildienstes ein FSJ zu leisten, umsetzen. Aber meine große Bitte ist, das Bundesamt für Zivildienst so weit wie möglich aus diesem ganzen Verfahren herauszuhalten. Frei-willigendienste müssen Freiwilligendienste bleiben. Für uns hat das Bundesamt für Zivildienst eine Kompetenz im Bereich des Zivildienstes, aber keine Kompetenz im Bereich der Freiwilligendienste. Im konkreten bedeutet das: Keine Anerkennung der Einsatzstellen, in denen zivildienstpflichtige junge Männer tätig sind, durch das Bundesamt für Zivildienst. Keine Definition ?auslastende Tätigkeit?, so dass sich dann eine weitere Prüfmöglichkeit für das Bundesamt ergeben würde, und unsere ganz große Bitte, arbeiten Sie mit den im Gesetz im
§ 5 genannten Trägern auf der Ebene zusammen. Die Zusammenarbeit mit diesen bundeszentralen Trägern im Abrechnungsverfahren könnte sich als gravierende Schwachstelle erweisen.
Zum Abschluss habe ich eine Bitte: Das Trägerprinzip sollte unbedingt, so wie es jetzt schon im Gesetz festgehalten ist, beibehalten werden. Es ist dringend erforderlich, dass sich Einsatzstellen nicht als Träger anerkennen lassen können. Soweit meine Ausführungen bis hier her, danke.
Vorsitzende: Vielen Dank Herr Slüter. Jetzt bitte ich Herrn Dr. Christian Staffa
SV Christian Staffa, Geschäftsführer von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste: Auch ich bedanke mich für die Einladung und begrüße die Vorsitzende, die Abgeordneten und auch die Gäste. Aktion Sühnezeichen Friedensdienste bietet 18-monatige Dienste in 10 Ländern und 12-monatige Dienste in Deutschland und Großbritannien an. Wobei Deutschland ein Incoming-Programm ist und in Großbritannien ein deutsch-polnisches-Freiwilligenprogramm organisiert wird. Insgesamt begrüßen wir die Ziele des Gesetzes, das heißt die angestrebte Vereinheitlichung der Freiwilligengesetz-gebung, der Ausweitung auf das außereuropäische Ausland. Wir müssen uns noch einmal vor Augen führen, woher wir kommen in Richtung § 14 b, sozusagen als Notlösung politisch grob erkämpft. Man kann da heutzutage immer noch so Nachwirkungen bei Anerkennungs-verfahren von Einsatzstellen finden, dass das ein politisch nicht wirklich geliebtes Projekt war und gegenüber diesem Zustand ist § 14 c und die Anerkennung von Friedens- und Versöhnungsdiensten im Rahmen dieses Gesetzes wirklich ein großer Erfolg, den wir anerkennen wollen. Wir haben, und ich fürchte das langweilt Sie schon, tatsächlich auch eine große Skepsis bezogen auf die Arbeit-nehmerfiktion. Die sind da entschieden anderer Meinung als der Gutachter, und wir haben das Problem, dass sich aus der Sozialversicherungspflicht verschiedene Folgen ergeben, die wir dann sozusagen sukzessive auch immer mit beklagen, z.B. die Frage der Dauer, die an dieser Ausstrahlung hängt.
Dann ein Punkt, der sich bezogen auf frühere Entwürfe positiv verändert hat: Dass Begleitung jetzt auch im Ausland stattfinden kann, ist ja auch ein Fortschritt gegenüber vorhergehenden Entwürfen. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir haben bezogen auf die Begleitung ein Problem, das mag Ihnen jetzt etwas detailliert erscheinen, aber es ist für uns relativ entscheidend, was die pädagogische Konzeption angeht.
Zum Beispiel, der Vorbereitungsdurchlauf bei ASF erstreckt sich über ein halbes Jahr, das heißt, Freiwillige machen ein Praktikum, machen noch einmal eine Gedenkstättenfahrt und dann erst eine Woche vor Dienstbeginn kommt das, was im Gesetz Vorbereitungsseminar genannt werden würde. Wie ich jetzt erfahren habe, müsste man die Freiwilligen, wenn man das abbrechen wollte, quasi von Anfang der ersten Vorbereitungsmaßnahme an sozialversichern und ihnen Taschengeld zahlen, obwohl sie da noch was ganz anderes sind, nämlich in der Regel Schülerrinnen und Schüler. Das ist ein Problem, was ich jedenfalls, bisher nur gehört habe. Wir haben bei der Nachbereitung das pädagogische Konzept, dass wir die interkulturelle Erfahrung, die die Freiwilligen gemacht haben, erst einmal wieder in einer Anlaufphase im Heimatland testen und das Rückkehrer-seminar erst nach zwei Monaten stattfindet. Auch da ist die Frage, was passiert in der Zwischenzeit. Ist es in diesem Gesetzesrahmen möglich, solch ein Konzept bei zu behalten, was wir für pädagogisch am fruchtbarsten halten und nicht ein Nachbereitungsseminar direkt nach der Dienstzeit. Das stelle ich mal als Frage. Bei der Evaluierung oder auch bei den Verhandlungen um die Durchfüh-rungsbestimmung wird es sicher noch einmal eine Rolle spielen.
Ein Kritikpunkt ist auch schon genannt worden. Die Frage der Kompatibilität mit dem europäischen Freiwilligendienst. Es scheint uns nicht wirklich einleuchtend, dass man da nicht versucht hat, auf der konzeptionellen Ebene sozusagen, Brücken zu bauen Wir werden als Freiwilligendienstträger in Zukunft ein ähnliches Problem haben, was wir jetzt schon haben. Insofern ist es keine gravierende Veränderung ? nämlich, dass wir verschiedenen Status von Freiwilligen unter unserem Dach versammeln werden. Das ist § 14 b, das ist EVS, das ist §14 c und da wird, wie Jörn Fischer sagt, vermutlich auch ungeregelter Dienst bleiben, je nach dem, was für Finanzierungsmöglichkeiten wir auf tun. Deshalb bin ich auch skeptisch, wenn auch nicht ganz hoffnungslos, dass wir jetzt als Träger unsere Freiwilligenzahlen sehr erhöhen können. Möglicherweise ergibt sich etwas aus der Kostenerstattung über §14 c, die ja auch eine grundlegende Verbesserung gegenüber §14 b ist, was uns da sozusagen ein bißchen Rückenwind gibt für die Finanzierung auch insbesondere von Frauen.
Bezogen auf die Trägeranerkennung ist auch schon gesagt worden - wir sind natürlich darauf angewiesen, da wir als Auslandsdienst einen bundesweiten Aktionsradius haben -, dass wir die Trägeranerkennung irgendwie zentral regeln können und nicht in allen Bundesländern vorstellig werden müssen, um uns anerkennen zu lassen.
Insgesamt spricht sowohl das sehr gute an diesem Gesetz wie auch die von mir geäußerte Skepsis sehr dafür, dass die Evaluierung in zwei Jahren wirklich dringend notwendig ist und wir da auch offen eruieren können, ob die Ziele des Gesetzes wirklich verwirklicht werden konnten, insbesondere die Ausweitungs-frage. Meine dringende Bitte ist da in dieser Phase der nächsten zwei Jahre zu prüfen, ob der für uns große Stolperstein "Sozialversicherung" klein geklopft werden kann. Herzlichen Dank.
Vorsitzende: Vielen Dank Herr Staffa. Ich bitte jetzt Herrn Prof. Dr. Heinz Steinmeyer, der als Einzelsach-verständiger, wenn ich das recht sehe, für sich selbst spricht. Bitte schön.
SV Prof. Dr. Heinz Steinmeyer: Frau Vorsitzende, vielen Dank. Sie haben insofern recht, ich spreche für mich alleine, tue das nach bestem Wissen und Gewissen und möchte deshalb gleichzeitig auch natürlich nicht Stellung nehmen zu dem Gesetzentwurf und der Sinnhaftigkeit bestimmter Dinge außerhalb des Kernbereichs, für den ich mich zuständig fühle, nämlich die Frage der Sozialversicherung. Ich möchte mich deshalb auf die sozialversicherungs-rechtlichen Fragen konzentrieren. Es mag jetzt etwas technokratischer und etwas detaillierter werden, aber das liegt in der Natur meines Auftrages hier. Zunächst einmal, die Sozialversicherung ist schon mehrfach angesprochen worden. Bei der Sozialversicherung ist es so, dass mein Ausgangspunkt war - und ich halte das auch für sinnvoll, dass man ausgeht von dem Status wie er derzeit ist. Und der derzeitige Status ist der der Beschäftigten- Fiktion im Inland und von daher geht es da um das weitere Hinausdenken auch auf Auslandssachverhalte. Das ist also der Ausgangspunkt, den ich dabei anlegen möchte. Ich gehe ein bißchen entsprechend ihrem Fragenkatalog vor, konzentriere mich aber auf die Fragen, die für mich relevant sein konnten. Es wurde auch angesprochen die Frage der Arbeits-erlaubnis und der Probleme die mit den Arbeitserlaubnissen teilweise zusammen hängen. Ich möchte das etwas relativieren. Und zwar relativieren, insofern, als es zum einen so ist, dass ausländische Staaten dann, wenn die Sozialversicherung sicher gestellt ist, erheblich eher geneigt sind, Erlaubnisse zu erteilen, weil sie sicher sind, dass der soziale Schutz da ist. Das ist im europäischen Recht so auch gängig. Das zweite ist, dass die Beschäftigten- Fiktion ja nicht bedeutet, dass sie Arbeitnehmer sind, sondern dass sie nur wie solche behandelt werden. Ich gebe zu, das ist ein juristischer Kunstgriff, aber dieser juristische Kunstgriff müsste halt aus meiner Sicht den Betreffenden erläutert werden. Was die Begrenzung auf die 12 Monate anbetrifft, die hier auch mehrfach schon erörtert und moniert wurde, so möchte ich nur darauf hinweisen, dass es hier um eine Regelung des europäischen Sozialrechts geht. Die Regelung des europäischen Sozialrechts kann der Gesetzgeber nicht ändern. Es gibt durch- aus Stimmen, die sagen, die 12 Monate sind für Arbeitnehmer bezogen. Darum geht es ja hier, also hier geht es nicht um Arbeitnehmer, aber bei einer Beschäftigungsfiktion geht es um den Arbeitnehmerstatus. Da ist eine 12-monatige Höchstfrist vorgesehen und diese läßt sich nicht verlängern. Die ließe sich nur verlängern über eine Ausnahmeverein-barung nach Artikel 17 der Verordnung Nr. 140871, aber das ist ein sehr umständliches Verfahren, vor dem ich hier aus zwei Gründen nur warnen kann. Zum einen, weil hier das Problem darin besteht, dass es um einen relativ kleinen Personenkreis geht. Dann würde man zu Gesetz schreiben "die Ausnahme zur Regel gemacht". Das ist eine Ausnahmevorschrift und den Verwaltungsaufwand, jetzt im einzelnen festzustellen, wer nun darunter fällt, mit den betreffenden Staaten in den Einzelfällen Vereinbarungen zu schließen.... Also ich kann nur vor dem Aufwand warnen.
Ich möchte schließlich noch zu einer anderen Frage Stellung nehmen, und zwar zur der Frage der Bundesrepublik Deutschland. Da hat es im Vorfeld einige Fragen gegeben, ob man auch ausländische Träger mit Sitz im Ausland mit hinzuziehen sollte oder könnte. Der Gesetzentwurf hat sich für einen Sitz in der Bundesrepublik Deutschland entschieden, und das halte ich für europarechtlich auch durchaus tragbar, auch wenn man über Dienstleistungsfreiheit diskutieren könnte oder Niederlassungsfreiheit. Es gibt aber seit ein paar Tagen eine Rechtssache, eine Entscheidung des europäischen Gerichtshofs, der eher eine Anknüpfung an den Sitz im Inland unter den Schutzgesichtspunkten für akzeptabel angesehen hat und Verständnis dafür gezeigt hat. Ich habe, glaube ich, meine Zeit noch nicht erfüllt, aber ich möchte Ihnen sozusagen den Rest schenken, herzlichen Dank.
Vorsitzende: Vielen Dank für das persönliche Geschenk. Wir werden es dann gemeinsam nutzen. Jetzt bitte ich Herrn Robert Wessels, vom Kommissariat der deutschen Bischhöfe, und zwar hier vom Katholischen Büro in Berlin, bitte schön.
SV Robert Wessels, Kommissariat der deutschen Bischöfe, Katholisches Büro Berlin:
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich möchte mein Statement mit einem Ausflug in die Gesetzeshistorie des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres aus dem Jahre 1964 beginnen. Sozusagen als Zeitzeuge berufe ich mich auf den damaligen Landgerichtsrat Dr. Hans, der das Gesetz 1965 kommentiert hat. Dr. Hans beginnt seine Ausführungen mit der Entstehungs-geschichte und schreibt: Das freiwillige soziale Jahr, dass durch das Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres vom 17.08.1964 seine staatliche Anerkennung erfahren hat, ist keine Entdeckung des Bundesgesetzgebers, sondern eine Schöpfung der Kirchen. Genau genommen eine Schöpfung der evangelischen Kirche, die das freiwillige soziale Jahr seit nunmehr 10 Jahren praktiziert. Will man Wesen und Sinn dessen erfassen, was der Bund durch die in dem neuen Gesetz vorgesehenen staatlichen Maßnahmen fördern will, so bedarf es eines Eingehens auf die Gründung und Entwicklung des freiwilligen sozialen Jahres in der Praxis der Träger, insbesondere der Kirchen.
Dr. Hans beschreibt im Anschluss die rasante Entwicklung, die das freiwillige soziale Jahr in den Kirchen und dann auch in den freien Wohlfahrtsverbänden genommen hat. Rasch bildeten sich Standards heraus: Klar, Diakonisches Jahr, 12 Monate, und davon wollte die evangelische Kirche auch nicht abweichen. Man hat eine Verlängerung abgelehnt und immer stattdessen, wenn ein Übergang verlängert werden sollte, ein normales Dienstverhältnis empfohlen. Anfänglich betrug das Mindestalter 17 Jahre, in der katholischen Kirche 18 Jahre. Aber man war sich immer schon einig, dass man den Dienst ausführlich begleitete, sogar bis hin, dass in der katholischen Kirche von Anfang an Einführungseminare von 3 bis 6 Wochen gehalten und während des Einsatzjahres die Freiwilligen auf regelmäßigen Treffen weitergebildet und unterwiesen wurden. Im Ergebnis hatten die Kirchen einen sozialen Wehrdienst etabliert, der den Freiwilligen die Möglichkeit zur persönlichen Orientierung bieten sollte. Auch heute ist noch allgemein anerkannt, dass das FSJ Jugendliche in einer Lebensphase unterstützen soll, die gekennzeichnet ist von dem Bedürfnis nach persönlicher und beruflicher Orientierung, von dem Wunsch, die eigene Fähigkeit zu erweitern und neue Formen des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens zu erproben. Der Gesetzgeber hat 1964 diesen Charakter des FSJ in ein FSJ-Gesetz umgesetzt. Er wollte sicherstellen, wie Sie heute auch, dass bestimmte soziale Mindeststandards, dass bestimmte Leistungen auch den Freiwilligen weiter gewährt werden. Es ging damals um Kindergeld, Steuer-ermäßigung, -vergünstigung und auch um die Sozialversicherung. Gleichzeitig hat er ganz klar festgelegt: Freiwilligendienst ist keine Berufsausbildung, ist kein Praktikum. Freiwilligendienst soll keinem Pflichtdienst für Frauen Vorschub leisten und Freiwilligendienst wird auch nicht deshalb etabliert, um den Personalmangel im sozialpflegerischen Bereich zu begegnen. Warum erwähne ich das Gesetzgebungsverfahren, das fast 40 Jahre zurückliegt? Ich erwähne es, weil damals ein erfolgreiches Gesetz geschaffen wurde und sich das Gesetzgebungsverfahren deshalb aus zwei Gründen zur Nachahmung empfiehlt:
- Gesetzesänderungen im Bereich des FSJ müssen das Wesen und Konzept der bestehenden Freiwilligendienste berücksichtigen.
- Der Gesetzgeber sollte sich bei der gesetzlichen Verankerung eines Freiwilligendienstes an den bestehenden erfolgreichen Modellen orientieren und sich bemühen diese umzusetzen.
Diesen beiden Maßstäben wird der Gesetzentwurf, den wir im Grundsatz begrüßen, nicht durchgehend gerecht. Die Verlängerungsmöglichkeit des FSJ/FÖJ Inland ohne pädagogische Begleit-veranstaltung, der gestückelte Freiwilligen-dienst, der sich praktisch kaum pädagogisch begleiten lässt, ein Zeugnis, das den Anforderungen eines Arbeits-zeugnisses entspricht, erscheinen vor dem Hintergrund, dass der Freiwilligendienst ein Lerndienst ist und der persönlichen Orientierung dient, problematisch. Daneben setzt der Gesetzentwurf mit dem FSJ-Ausland auf ein Auslands-freiwilligenkonzept, das bislang als FSJ- europäisches Ausland relativ wenig genutzt wurde.
Die Gesetzeshistorie verdeutlicht auch, warum Kirchen und die in der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände zusammen geschlos-senen Verbände als geborene Träger im FSJ-Gesetz anerkannt wurden. Sie hatten, bevor das FSJ Förderungsgesetz in Kraft trat, schon jahrelang bewiesen, dass sie die Freiwilligen gut auf den Freiwilligendienst vorbereiten und sie verantwortungsvoll während des Dienstes begleiten. Die Abbrecherzahlen waren und sind sehr niedrig, die Rückmeldungen sehr positiv. Dieses Prinzip der geborenen Träger wurde für das FSJ bisher stets durchgehalten. Auch als das FSJ im europäischen Ausland 1993 eingeführt wurde, änderte der Gesetzgeber das Prinzip der geborenen Träger nicht.
Die Kirchen haben sich auch bei dem Freiwilligendienst im Ausland für die Freiwilligen als kompetente, verlässliche und verantwortungsvolle Träger und Partner erwiesen. Die Kirchen stellen über die Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungs-hilfe e.V., mit dem FIT- das ist die ?Freiwillige Internationale Dienste Service- und Beratungsstelle? - eine Einrichtung, die ihre Träger unterstützt und berät. Die Gründe, warum das Prinzip der geborenen Träger nunmehr im §5 Abs. 2 FSJ-Änderungsgesetz für den Auslands-freiwilligendienst durchbrochen ist, sind uns nicht verständlich.
Die Gesetzeshistorie lässt über dies eine weitere Parallele zu. Auch bei der Entwicklung der Freiwilligendienste im Ausland haben kirchliche Verbände und Gruppen als Träger bei der Entwicklung des freiwilligen sozialen Jahres eine sehr wichtige Rolle gespielt und sich einen exzellenten Ruf erworben. Ich erinnere nur an die ?Aktion Sühnezeichen?. Die meisten von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, werden Mitgliedsverbände der Dachorganisation der kirchlichen Träger kennen.
Die AGDV, das ist die evangelische Dachorganisation, hat zum Beispiel die ?Aktion Sühnezeichen Friedensdienste? als Mitglieder, die Bundesarbeitsgemeinschaft auf katholischer Ebene hat den BDKJ, den Caritasverband, die Jesuiten als Mitglieder. Diese haben alle einen sehr guten Ruf. Auch diese freiwilligen Träger, diese auslandsfreiwilligen Träger, haben gewissermaßen einen Standard für einen Auslandsfreiwilligendienst entwickelt und in einem Eckpunktepapier zusammen-getragen.
Demnach soll ein Freiwilligendienst im Ausland bis zu 24 Monaten dauern dürfen. Eine angemessene pädagogische Begleitung wird verlangt und Kranken-versicherung, Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung gewährleistet.
Leider hat sich das Eckpunktepapier, das hier von Frau Salzmann bereits erwähnt wurde, nach anfänglich sehr guten Kritiken nicht durchgesetzt, und wir besprechen heute mit § 3 FSJ-Änderungsgesetz eine Auslandsregelung, die von der Mehrzahl der Träger von Auslandsfreiwilligen-diensten eher als hinderlich, denn als förderlich angesehen wird.
Eine letzte Bemerkung zu § 14 c: Wir haben in unserer Stellungnahme unsere Bitte kund getan, das FSJ/FÖJ auch dann als Zivildienstausnahme anzuerkennen, wenn der Jugendliche dieses bereits vor Anerkennung des Antrages auf Kriegs-dienstverweigerung angetreten bzw. abgeleistet hat. Wir haben in unserer Stellungnahme dargelegt, dass die Möglichkeit, bereits früher einen Kriegs-dienstverweigerungsantrag zu stellen, dieses Problem nicht löst, sondern vor dem Hintergrund der Kinderrechtskonvention und der mit ihr angestrebten Straight- Eighteen-Position bedenklich ist. Ich würde mir wünschen, dass deutlich geworden ist, dass den Kirchen sehr an einem attraktiven und erfolgreichen Freiwilligengesetz gelegen ist. Vielleicht gelingt es noch, die einzelnen Schwächen des Gesetzentwurfs aufzubessern und so die gewünschte Ausweitung von Freiwilligendiensten erfolgreich zu realisieren. Vielen Dank.
Vorsitzende: Vielen Dank Herr Wessels.
Damit ist die erste Runde beendet, die Runde der Sachverständigen. Jetzt haben die Fraktionen das Wort. Damit Sie sich im Raum orientieren können, werde ich nur ganz kurz vorstellen, an welcher Stelle der Runde wer sitzt: Hier sitzt das Ausschußsekretariat, links neben mir die Bundesregierung, die vertreten ist durch die Parlamentarische Staatssekretärin Frau Dr. Niehuis. Die Bundesregierung hat ausdrücklich auch an vielen Stellen gesagt, dass sie ein sehr großes Interesse an dieser Anhörung hat, und das zeigt sich auch durch die persönliche Teilnahme der Staatssekretärin. Dann schließt sich die SPD-Fraktion an, von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Herr Simmert. Dann schließt sich die PDS-Fraktion, die FDP-Fraktion an und in dieser lange Runde hier sitzt die Fraktion der CDU/CSU.
Ich werde jetzt nach Fraktionen aufrufen, so sind unsere Regularien. Interfraktionell ist vereinbart worden, dass die SPD-Fraktion in der ersten Fragerunde 25 Minuten Fragezeit hat, das schließt die Fragen und die Antworten immer mit ein. Die CDU/CSU-Fraktion hat 21 Minuten, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 10 Minuten, die FDP-Fraktion 7 Minuten und die PDS-Fraktion 5 Minuten zur Verfügung. Für die SPD-Fraktion, wer macht da den Anfang. Der Berichterstatter Dieter Dzewas, bitte.
Abg. Dieter Dzewas (SPD):
Frau Vorsitzende, schönen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Prof. Steinmeyer: Herr Prof. Steinmeyer, in Ihrer schriftlichen Stellungnahme weisen Sie darauf hin, dass sich Sozialversicherungs-schutz erleichternd auf eine Visaerteilung im außereuropäischen Auslandsdienst auswirken kann.
In anderen Stellungnahmen, zum Teil heute vorgetragen, aber auch schriftlich vorgetragen wird die Sozialversicherungs-pflicht und der damit verbundene arbeitnehmerähnliche Status aber immer wieder als Problem für Auslandsdienste dargestellt. Können Sie diesen - aus meiner Sicht erst mal Widerspruch - noch einmal versuchen zu erläutern? Zweite Frage, können Sie dann noch einmal gesondert auf die Ausnahmeverordnung nach Artikel 17 Nr. 140871 eingehen, denn die wird in einigen Gutachten als Möglichkeit dargestellt, Auslandsfreiwilligendienste verlängern zu können. Das leuchtet mir noch nicht ein.
Vorsitzende: Sie können sofort darauf antworten, Herr Prof. Dr. Steinmeyer, bitte.
SV Prof. Dr. Steinmeyer: Herzlichen Dank. Also zunächst einmal, was die Visa-Erteilung betrifft, und das weiß ich auch, wie die ausländischen Staaten das jeweils behandeln, ist die eine Frage. Aber ich weiß es aus eigenen Erfahrungen, wie wir Deutschen es behandeln und das können Sie übertragen. Das heißt also, wenn während eines Auslandsaufenthaltes der soziale Schutz sicher gestellt ist, dann ist der Empfangsstaat eher geneigt, das zu akzeptieren, weil er dann nicht mit Sozialhilfe antreten muss. Das ist der Grund. Die andere Problematik ? bei Arbeitnehmern - ist natürlich, dass ein Arbeitnehmer den Arbeitsmarkt bedrängen könnte, und dass man ihn deshalb nicht haben will. Und was ich eben gesagt habe, war: Wir arbeiten hier im Sozial-versicherungsrecht, nicht damit, dass sie Arbeitnehmer sind, sondern wir arbeiten in einer Beschäftigtenfiktion. Und Fiktion heißt für einen Juristen, dass bei etwas, was nicht so ist, so getan wird, als ob, um etwas salopp zu formulieren. Und von daher meine ich eben, dass die Sozialversicherung erleichternd ist, und dass die Frage der Beschäftigtenfiktion erläuterungsbedürftig für die Gastländer ist.
Und das Zweite, den Artikel 17 der Verordnung betreffend: Artikel 17 sieht vor, dass die Mitgliedstaaten untereinander Ausnahmen von den Vorschriften der Artikel 13 bis 16 vorlegen können. Diese Ausnahmen sind möglich. Das ist aber eine Ausnahmeregelung. Erstens müßte man diese Ausnahmeregelung, den Verweis darauf, ins Gesetz schreiben, was ausgesprochen ungewöhnlich wäre, weil man eine Ausnahme zu einer Regel machen würde. Das ist das eine. Das Zweite ist aber, und das halte ich für entscheidend, man müsste mit jedem betroffenen Staat eine Vereinbarung schließen. Das heißt also, Sie müssen mit allen 14 anderen Mitgliedstaaten entsprechende Übereinkommen schließen - die EWR-Staaten kämen hinzu, also Sie hätten eine ganze Menge Abkommen zu schließen. Und der einzelne Träger müsste dann jeweils genau sehen, wo sind welche Abkommen gemacht worden. Der Aufwand einmal, um die Abkommen zu schließen, ist hoch und der Aufwand für die Träger, den halte ich auch für recht hoch. Das ist eine praktische Erwägung. Ich bitte, dass auch ein Hochschullehrer mal praktische Erwägungen vorbringen darf, danke.
Vorsitzende: Die SPD-Fraktion ist weiter am Zuge. Frau Lehder bitte.
Abg. Christine Lehder (SPD):Ich habe zwei Fragen an Herrn Schmidt vom Deutschen Sportbund. Erste Frage: Gerade der Sportbereich könnte für jüngere Freiwillige ein interessantes und wohnortnahes Einsatzfeld sein. Die bestehenden Vereinsstrukturen bieten eine gute Möglichkeit, den Freiwilligendienst bekannt zu machen und Jugendliche aus den eigenen Reihen gezielt anzusprechen. Besteht in diesem Bereich die Bereitschaft, ein zusätzliches Platzangebot für jüngere Teilnehmer zu schaffen? Das war die erste Frage. Die Zweite: Sie sind seit September 2000 für das Modellprojekt "Freiwilliges soziales Jahr im Sport? verantwortlich, und in diesem auf drei Jahre geförderten Modellprojekt geht es um den Aufbau einer bundesweiten Struktur von neuen Trägern und Einsatzstellen in Vereinen, Verbänden, innerhalb des organisierten Sports im Deutschen Sportbund. Welche Erfahrungen konnten Sie in dem 3jährigen Modellprojekt im Sport bereits sammeln? Das waren meine beiden Fragen, danke.
Vorsitzende: Bitte schön, Herr Schmidt.
SVRudolf Schmidt Danke schön, ich nehme gern dazu Stellung. Ich hatte ja gesagt, dass ich auf Fragen antworten möchte, die Sie konkret stellen. Zunächst zum Thema Jugendliche. Natürlich ist die Struktur des Sports schon wegen ihrer Größe und der Jugendbezogenheit dessen, was sie tut geeignet, auch Jüngere aufzunehmen und diese in Aufgaben-gebiete einzubinden. Die Deutsche Sportjugend nennt das nicht Heranführung von Ehrenamtlichen oder anti-ehrenamtliche Arbeit, weil der Begriff ein bißchen antiquiert erscheint, sondern wir nennen das Gewinnung, Entwicklung und Förderung von jungen Talenten. So, wie junge Talente eben im leistungs-sportlichen Bereich gesucht und gefunden werden und gefördert werden müssen. So haben wir uns vorgenommen, eben auch soziale Talente zu suchen, die heran- geführt werden an die Strukturen des Sports, über Hilfstätigkeiten eine Qualifizierung erwerben und über diese Qualifizierung hinreichend auch in den Strukturen eingesetzt werden können, wo es um Betreuung von Kindern und Jugendlichen im gesamten Vereinswesen geht. Der Sport hat 87.000 Vereine, hat ein flächendeckendes Netz, also von daher ideale Bedingungen. Natürlich muss man sehen, dass die Amateurvereine - und von denen sollten wir hier nur sprechen - von den Beträgen leben die ihre Mitglieder bei ihnen einzahlen, und um die Verwaltung dieser Mittel wird natürlich gefeilscht. Und wenn ein Vereinsvorstand zu entscheiden hat, was mache ich mit diesen 1.000 Mark, die eine junge FSJ-lerin zum Beispiel kosten würde, 16 bis 17jährig, dann fragt er immer, welche Leistung erbringt die für mich. Und das muss gesehen werden. Also, um konkret darauf einzugehen. Ich bin der Meinung, es gibt gute Voraussetzungen, aber nicht unter den derzeitigen Bedingungen. Man müsste dieses motivieren. Motivieren, in dem man eben hier mit besonderen Aufwandzuschüssen oder dergleichen Plätze schafft, und die jungen Leute schaffen sich eigentlich selbst ihre Lobby, wenn sie erst einmal dran sind, wenn sie den Nachweis geliefert haben: Wir sind wichtig für die Kinder- und Jugendbetreuung in dem Verein. Dann ist die Bereitschaft, dieses dann auch zu vergüten eher gegeben. Das meine ich, scheint der richtige Weg zu sein, um in dieser Richtung weiter zu kommen, und ich möchte in diesem Zusammenhang an das erinnern, was das Bundesamt für den Zivildienst nach meiner Erkenntnis 25 Jahre lang gemacht hat. Immer dann, wenn es ein Problem hatte und dieses Problem beseitigen wollte, hat es mit Auslands-zuschüssen nachgeholfen und hat Plätze unter finanziell günstigeren Fortsetzungen geschaffen. Für diese Plätze dann, wenn sie im erforderliche Umfang da waren, wurde die Förderung zurückgenommen. Damit stand ein entsprechender Anteil an Plätzen dann noch zur Verfügung. Sind Sie damit einverstanden, ja, gut.
Das Thema "Modell". Sie haben es angesprochen. Die Deutsche Sportjugend möchte durch dieses 3jährige Modell in Abstimmung mit dem Ministerium, was dieses Modell ja hochrangig fördert, wofür wir sehr dankbar sind, erreichen, das Trägerspektrum zu erweitern, bewusst junge Leute in die sportliche Betreuung von Kindern und Jugendlichen auch hinein zu nehmen. Die Nachfrage bei den jungen Leuten, die das hören, ist außerordentlich hoch. Momentan ist es ja noch nicht besonders bekannt, aber in Nordrhein-Westfalen, wo es momentan 18 Plätze gibt, kommen in etwa 6 Bewerberinnen auf einen Platz. Also, wenn sich das weiter herumspricht, nehme ich an, dass es sich noch erheblich steigern wird. Von daher ist auch die Motivation der Sportvereine, solche Stellen einzurichten, sicherlich längerfristig gegeben. Wir haben zur Zeit knapp 50 Prozent der Plätze, die wir haben wollten. Das weist darauf hin, dass es nicht so ?Holter die Polter? geht, eine Struktur aufzubauen. Darauf muss man sich einrichten. Hier haben wir dazu lernen müssen, und wir sind immer noch dabei. Wir führen das unter anderem darauf zurück, dass es momentan dieses eben schon angesprochene Anerkennungs-verfahren der Träger gibt, was ja sehr schwierig ist.
Bevor die Deutsche Sportjugend dieses Modell auf die Füße stellen konnte und damit begann, mussten hier erst einmal Trägerstrukturen nach den jetzigen Bedingungen des Gesetzes - und die sollen ja beibehalten werden -, geschaffen werden. Das heißt, in jedem Bundesland eine eigene Trägeranerkennung. Hier gibt es keine Einheitlichkeit. Hier gibt es Bundesländer, die verweigern das oder haben das verweigert und brauchten lange, um mit unserer Nachhilfe dann zum Ziel zu kommen, dass die Anerkennung ausgesprochen wurde. In Sachsen haben wir immer noch keine Anerkennung. Wir haben also im Moment 11 von 16 Anerkennung und das reicht natürlich nicht aus.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass natürlich Personalkapazitäten in den Strukturen, wo Träger in Zukunft Betreuung gewährleisten, anleiten sollen etc., aufgebaut werden müssen Und es müssen Vereine gefunden werden, die dieses tun. Wir sind dabei, ich bin der Meinung wir schaffen das, aber es wird seine Zeit brauchen. Es gibt noch ein weiteres Problem und das will ich hier gleich noch dazu sagen. Es gibt in den neuen Bundesländern im Moment bessere Förderungsbedingungen, als die von denen das Modell momentan existiert oder die für das Modell momentan gelten. Es gibt in den neuen Bundesländern nach dem Job-Aktiv-Gesetz, zum Beispiel in Thüringen, die Möglichkeit, dass für eine Laufzeit von maximal 48 bzw. 60 Monaten, das sind ja immerhin 5 Jahre, Menschen eingestellt werden, die Langzeitarbeitslose waren und die können in der Seniorenbetreuung, in der Betreuung von Jugendarbeit im Sport eingesetzt werden. Und das natürlich unter günstigen Bedingungen, ich habe das ausgerechnet. Da gibt es eine Belastung der Dienststellen in Höhe von 3.000 Euro pro Jahr, das sind 250 Euro im Monat und das sind natürlich ideale Bedingungen für einen Verein, der jemanden hat, der hinreichend qualifiziert ist. Es kann ja ausgesucht werden, wer keine 25 Tage zusätzlich für eine Qualifizierung braucht. Ich will damit nicht sagen, dass das die besten Betreuer für die Kinder- und Jugendarbeit sind Aus der Sicht der rechnenden Vereine, und die müssen alle rechnen, sind es eben Gründe zu sagen, wir nehmen den, den wir für 5 Jahre haben, anstelle jemanden, der möglicherweise nach 14 Tagen wieder geht, was ja jetzt noch möglich ist oder nur 6 Monate bleibt - oder was auch immer. Hier haben wir jemanden, der langzeitgemäß eingesetzt werden kann, ohne dass wir ihn beaufsichtigen usw. müssen. Also, auch hier sehe ich nur die Möglichkeit, das in Zukunft so weit wie möglich eben auch finanziell so auszustatten, bis Strukturen geschaffen und entwickelt worden sind. Vieles von dem erledigt sich dann von selbst wenn die beschäftigten Personen nachweisen, wir werden gebraucht, wir sind gut, wir kommen gut an, dann sind die Vereine auch eher bereit Mittel dafür zur Verfügung zu stellen. Danke schön.
Vorsitzende:Vielen Dank. Frau Griese, bitte.
Abg. Kerstin Griese (SPD): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, ich habe eine Frage an Herrn Slüter vom Bundesarbeitskreis FSJ. Es ist ja in der Diskussion, eine allgemeine gezielte Werbekampagne für die Freiwilligen-dienste eventuell zu starten. Ich habe eben schon gehört, im Sportbereich gab es 6 Bewerberinnen auf einen Platz. Das ist ja eigentlich erfreulich, also wie erachten Sie eine solche Werbekampagne, was halten Sie davon. Es gibt ja auch Leute, die sagen es würden dann vielleicht sogar zu viele Bewerbungen kommen, was ja eigentlich in sofern kontraproduktiv wäre. Es ist ja gut, wenn mehr junge Leute sich da engagieren wollen. Also, die Bitte um Einschätzung einer solchen Werbe-kampagne. Meine zweite Frage, vielleicht könnte Herr Slüter dazu auch noch mal kurz etwas sagen. Ansonsten geht die Frage an Herrn Goos, weil ich glaube, dass im Bereich des ökologischen Jahres ja noch Jüngere stärker auch angesprochen werden und es ja auch ein Ziel ist, dass auch Haupt- und Realschüler für die Freiwilligendienste motiviert werden. In einem Gutachten wird darauf hingewiesen, dass Seminare in denen es eine Mischung zwischen sozialen Schichten zwischen Haupt-, Real-, Gesamtschülern, Gymnasiasten usw. gibt, dass es dort einen höheren personellen Aufwand geben müsste.
Meine Frage ist, ob Sie nicht eigentlich meinen, dass Seminare, die so angelegt sind, dass sie gerade soziale Integration fördern, dem Sinn des freiwilligen sozialen Jahres und ökologischen Jahres dienen, gegenseitige Toleranz, soziales Lernen zu fördern. Ob es nicht eher ein konzeptioneller Ansatz wäre, solche Seminare stärker zwischen verschiedenen Schulabgängerinnen, Schulabgängern ver-schiedener Altersgruppen zu mischen, ohne das direkt über den Personalschlüssel der Betreuung zu machen, sondern eher auf der konzeptionellen Ebene darüber nachzudenken.
Vorsitzende: Bitte schön Herr Slüter, Sie sind gefragt und eventuell dann noch Herr Goos.
SV Uwe Slüter: Auf die Frage einer allgemeinen Werbekampagne: Ich denke wir sind augenblicklich in der Situation, dass wir immer noch mehr Bewerbungen um Freiwilligenplätze haben als wir Plätze anbieten können. Allerdings hat sich die Bewerbungssituation in den letzten Jahren doch schon verändert. Das heißt also, früher hatten wir 6 Bewerbungen auf eine Stelle. Vielleicht sind es im Moment noch so 3 Bewerbungen auf eine Stelle, in einzelnen Regionen vielleicht noch 2 Bewerbungen auf eine Stelle. Das hat unter Umständen damit zu tun, das junge Leute durch Maßnahmen der Bundesregierung auch andere Alternativen haben, gerade jüngere Leute, wenn sie anstelle eines FSJ sofort in den Beruf oder in die Berufsausbildung oder in sonstige Programme gehen. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass das FSJ nur einer ganz bestimmten Klientel bekannt ist und ich glaube, wenn in einer Schule eine Umfrage gemacht würde: Wer von euch kennt denn das FSJ oder auch FÖJ? Dann würde ein Großteil einer Schulklasse antworten. Nein, kennen wir noch gar nicht.
Ich glaube, als erstes ist dringend erforderlich, dass alle jungen Leute zumindest von dem Angebot und von der Möglichkeit erfahren und dass wir zweitens als Träger mit unseren Möglichkeiten, natürlich mit unserem traditionellen Klientel, werben können. Das machen wir auch. Aber eine allgemeine gezielte Ansprache muss ein allgemeines Projekt von uns allen sein, und deshalb halte ich so eine Werbekampagne für gut. Mir schwebt an der Stelle vor, in einem Jahrgang jedem Schulabgänger und jeder Schulabgängerin ein Werbefaltblatt in die Hand zu drücken: es gibt die Möglichkeit, einen Freiwilligendienst zu machen. Also, das finde ich optimal und ich glaube, dass die Bundesregierung in meinen Augen auch gut beraten wäre, so eine Kampagne zu starten. Noch einmal auf den Altersdurchschnitt in den Freiwilligendiensten: Wie es im FÖJ ist, weiß ich nicht. Dazu wird der Kollege sich äußern können. Die Altersstruktur, und das ist auch sehr stark im Dialog mit der Bundesregierung passiert, haben wir in den letzten Jahren massiv verändert. Wir haben 35% Jüngere, also unter 18jährige. Wir haben einen Anteil von Hauptschülerinnen von 17%. Das bedeutet aber, je jünger die Freiwilligen werden desto höher ist der Betreuungsaufwand. Das ist keine Frage des Schulabschlusses. Das hat was damit zu tun, dass wir erstens Kursgruppen haben mit 15-, oder 16 bis 27jährigen, von Hauptschülern oder ohne Hauptschul-abschluss bis zu Gymnasiasten. Und ich glaube, dass das soziale Lernen, was in so einer Gruppe stattfindet, auch hauptamtlich pädagogisch begleitet sein muss. Ich glaube, dass das je mehr Jüngere in das FSJ kommen desto höher ist, zumindest der Aufwand, den die Träger betreiben müssen, was die pädagogisch Begleitung angeht. Und das ist, glaube ich, das, was wir damit meinen. Ich persönlich bin sehr dafür, dieses soziale Lernen in einer Kursgruppe stattfinden zu lassen. Ich weiß, dass es bei Trägern Modelle gibt nur 16 - 17jährige in Gruppen zusammen zu fassen. Ich glaube, da sollten wir den Trägern die Zeit geben Erfahrungen zu machen, das dann zu evaluieren und dann konzeptionell zu verankern. Danke.
SV Hinrich Goos: Bei uns war als erstes die Frage wie sich das auswirkt, dass im FÖJ tatsächlich Jüngere teilnehmen können als im FSJ.
Das sieht bundesweit schon so aus, dass wir eigentlich trotzdem den geringeren Anteil von Sekundarstufe-1-Absolventen bei uns haben. Ich denke, das hat aber auch andere strukturelle Gründe. Ich hatte vor-hin schon einmal angesprochen, dass die Einsatzstellen eben sehr weit im ländlichen Bereich verteilt sind - auf einsamen Inseln oder einsamen Einsatzstellen, Bauernhöfen usw. -, wo Aufsichtsfragen über die Einsatzstellen eine andere Rolle spielen, als wenn man z.B. noch zu Hause wohnt, was im FÖJ viel weniger vorkommt als im FSJ. Das ist die strukturelle Frage. Wir bewerben das, denke ich, von allen Trägern her, dass wir mehr aus dem Bereich Sekundarstufe 1 bekommen wollen, aber wenn, dann bitte freiwillig und nicht wie es teilweise geschieht, dass in der Arbeitsverwaltung gesagt wird, also liebe Leute hört mal her, da gibt?s nicht anderes, da gibt es noch so?n FÖJ oder FSJ und das ist der letzte Notnagel für euch. Solche Leute machen dann häufig die Motivation in unseren Seminaren kaputt oder machen es uns ganz besonders schwer, wenn wir dieses Klientel dann in den Freiwilligendiensten haben.
Ich kann also dem zustimmen, was Uwe Slüter gesagt hat, vom Aufwand her. Es gibt praktisch kaum Träger im FÖJ, die nicht wie von Ihnen angesprochen integrativ Arbeiten für alle Bildungs-abschlüsse und eben gerade auch bei uns in Schleswig-Holstein sogar noch mit Ausländern. Und es ist einfach, wenn man diesen jungen Leuten gerecht werden will, so nicht leistbar, Seminare abzuhalten die dann auch für alle Seiten, sage ich mal, zu einem Erfolg kommen.
Wir haben ja die Bandbreite. Nordrhein-Westfalen hat dieses Limit gesetzt, die haben 60% Sekundarstufe-1-Absolventen und da ist es häufig so, dass dann diejenigen, die Abitur haben, sozusagen als Co-Betreuer für die anderen laufen. Teilweise machen sie das gerne, teilweise wollen sie dann aber einen solchen Freiwilligendienst auch nicht machen, weil sie mit denen dann auch in den Einsatzstellen zusammen sind, und weichen in die anderen Bundesländer aus wo diese Auflage nicht besteht. Wir wollen integrativ arbeiten, aber mit einem Schlüssel von 1:40, wie das jetzt geht. Bei diesen zusätzlichen Anforderungen, die ja auch das Gesetz jetzt gibt, das Interkulturelle haben Sie in dem Entwurf ja festgeschrieben, das ist auch noch mal, eine höhere Anforderung. Und wenn dann auf der anderen Seite der Pädagogen-schlüssel geändert wird, dann kriegen Sie nicht die Qualität, die Sie haben wollen, denke ich.
Was die Werbung angeht. Dazu möchte ich auch kurz Stellung nehmen. Wir haben ja eine große Werbekampagne durch einen Film, des Bundesministeriums, und dieser Film hat eben kaum etwas gebracht.
Ich beobachte seit Beginn der Modellvorhaben FÖJ, das ist ja noch nicht so alt wie das FSJ, dass ein Wandel in den Zugängen der Informationen zu den Freiwilligendiensten stattgefunden hat. Ich will das ganz grob streifen: Es ist so, dass zu Beginn die Hälfte der jungen Leute über die Zeitschrift "Abi" von diesem Dienst gehört hatten und zu uns kamen. Das ist weit in den Hintergrund getreten. Jetzt ist es über die Hälfte, die über die persönlichen Kontakte mit jungen Leuten, die so einen Freiwilligendienst gemacht haben, in die Freiwilligendienste kommen. Und das bei steigender Platzzahl.
Man muss daraus die logische Konsequenz fordern, dass man nicht solche zentralen Aktionen macht, sondern dass man die Träger unterstützt, die Ehemaligen sozusagen als Botschafter dieses Dienstes noch gezielter einzusetzen, z. B. für Besuche in ihren alten Schulen oder Schulen überhaupt oder Berufsinfor-mationszentren, wie wir das zum Teil auch machen. Ich denke, das ist erfolgs-versprechender. Gleicherweise ist erfolg- versprechend - und auch da ist ein Wandel eingetreten -, dass der Zugang einfach über das Internet und die Internetpräsentation zugenommen hat. Z.B., gleichbleibende Bewerbungsanzahl - nur einmal die Zahlen aus Schleswig-Holstein, die ich jetzt greifbar habe -, weiterhin 300 im Jahr für die jetzt 100 Plätze. Früher resultierten diese aus 100 Anfragen. Die Anfragen sind mittlerweile auf die Hälfte zurück-gegangen, weil die Erstinformation aus dem Netz geholt wird, und wenn dann keine Briefe mehr hin und her gehen, das ist für uns ein Stück Arbeitserleichterung, was so das post mäßige angeht. Aber auch ein Internet will gepflegt sein, und da sollen eigentlich auch gute Informationen drin stehen. Da würden wir uns auch natürlich über Unterstützung freuen, wenn das möglich wäre. Das zu diesen beiden Punkten.
Vorsitzende: Jetzt schlägt die Uhr für die SPD-Fraktion. Die Zeit für die erste Fragerunde ist abgelaufen. Die CDU/CSU Fraktion hat jetzt 21 Minuten, Herr Dörflinger, bitte.
Abg. Thomas Dörflinger (CDU/CSU): Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen zunächst seitens der CDU/CSU für ihre Stellungnahmen danken. Ich habe zwei Fragen. Erste Frage an Herrn Wessels. In den schriftlichen Stellungnahmen, die uns vorliegen, kommt mit wenigen Ausnahmen ganz überwiegend der Eindruck zum Ausdruck, dass die abschnittsweise Ableistung eines Freiwilligendienstes wenig Sinn macht. In den mündlichen Stellungnahmen ist hierzu wenige vorgetragen worden. Mich würde noch einmal interessieren, ist es denn nicht so, dass eine abschnittsweise Ableistung einerseits für den Träger zu einer erhöhten Bürokratie, andererseits für den Freiwilligen oder die Freiwillige selbst eher zu einer Behinderung eines prozess- oder projektorientierten Arbeitens führt und kommt darüber hinaus nicht die Gefahr dazu, dass der Freiwilligendienst als eine Art - wenn auch ein kurzer eigenständiger Lebensabschnitt - verloren geht zugunsten einer Lösung, die dann heißt: das Auffüllen aus einer lückenhaften Erwerbsbiografie, was eigentlich nicht Sinn und Zweck der Übung sein kann.
Zweite Frage an Frau Salzmann und Herrn Slüter. Es sind in ihren Stellungnahmen zwar unterschiedliche, aber in der Summe ganz erhebliche Bedenken nach meinem Dafürhalten vorgetragen worden zur neuen Regelung § 14 c Zivildienstgesetz.
Sehen Sie denn eine Möglichkeit, diese Fülle von Problemen, die eben geschildert worden ist, von der grundsätzlichen Problematik der Verknüpfung eines Pflichtdienstes und eines Freiwilligen-dienstes, über die notwendige Ungleichbehandlung von Mann und Frau einerseits und von Männern, die über das Zivildienstgesetz und Männer die über das FSJ-Gesetz den Freiwilligendienst leisten, über die notwendig werdende unterschiedliche Behandlung bei den Entgeltpunkten der gesetzlichen Rentenversicherung bis hin zu einer zwar nicht gewünschten - aus nachvollziehbaren Gründen - trotzdem aber notwendig werdenden Zuständigkeit des Bundesamtes für Zivildienst in einem Teilbereich des Freiwilligendienstes. Sehen Sie eine Möglichkeit diese vielen Widersprüche aufzulösen oder wäre es nicht sinnvoller, einfach von dieser Regelung Abstand zu nehmen.
Vorsitzende: Die erste Frage geht an Herrn Wessels, bitte sehr.
SV Robert Wessels: Die Frage war fast so präzise gestellt, dass ich mit ja antworten könnte. Ich würde sagen Sie haben genau die Finger auf die Wunden gelegt. Es ist tatsächlich so, dass die Bildungs-maßnahmen natürlich auch einen prozess- haften Charakter haben, dass sich Kerngruppen herausbilden sollen, dass Gruppen auch begleitet werden sollen und es ist nicht zuletzt auch das, dass natürlich der Freiwilligendienst auch einen bestimmten Anspruch hat. Also das heißt, hier soll vielleicht nicht während der Semesterferien - einem Praktikum vergleichbar - abgeleistet werden, sondern es soll durchaus auch mal 6 Monat am Stück dauern. Es ist ein Lerndienst, ein Orientierungsdienst und dafür denke ich mal, das habe ich auch am Anfang versucht darzulegen, eine Stückelung. Ich sage mal, die spricht dem entgegen.
Vorsitzende: Als nächstes ist Frau Salzmann gebeten die Antworten zu geben.
SV Helga Salzmann: Bezüglich des § 14 c Zivildienstgesetz: Wir haben immer gut 90% junge Frauen im FSJ, und ich will mal als These voraus stellen, wir freuen uns auf junge Männer. Wir freuen uns auf junge Männer, wenn sie in den Strukturen des Freiwilligendienstes ein FSJ leisten können. Wir haben diese, wie ich vorhin auch gesagt habe, problematische Verknüpfung von Freiwilligendiensten und Zivildiensten so bei uns diskutiert und aufgenommen, dass wir sagen, wir möchten in der Zukunft, wenn eventuell die Wehrpflicht entfällt, einen Übergang schaffen zu Freiwilligendiensten. Dem wollen wir uns nicht in den Weg stellen. Und wir sehen auch eine, ich sage mal inhaltlich gute Möglichkeit für junge Männer, hier sich freiwillig für einen Dienst zu entscheiden und einen Freiwilligendienst von innen kennen zu lernen.
Für uns sind, Herr Slüter hat vorhin im einzelnen etwas mehr die Punkte aufgezählt, die Knackpunkte sind die: Wenn die Verknüpfung der Kostenerstattung für alle jungen Männer, die über § 14 c an die Zentralstellen kommen, die Struktur der Finanzierung über den KJP zur Zeit an die Zentralstellen gegeben werden, dann haben die Träger die Möglichkeit hier einen Prozess der Steuerung in Gang zu setzen. Nämlich der Steuerung, dass nicht nur gemeldet wird, wer junge Männer haben will, weil die billiger werden nachher in den Einsatzstellen, sondern auch der Steuerung, interne Kriterien zu erarbeiten, die diesen Verdrängungswettbewerb junger Frauen eingrenzen und eventuell aus einem Pool von Finanzen dann auch neue Einsatzstellen zu schaffen, die wir heute so nicht bekommen können, weil die Einsatzstellen die Kosten für FSJlerinnen, sage ich jetzt bewusst, nicht aufbringen können, so dass wir hier einen Ausgleich schaffen könnten, wenn dieses in den zentralen Stukturen der Träger geschieht.
Wir lehnen es den Zugriff des Bundesamtes für Zivildienst auf die einzelnen Einsatzstellen ab, wir lehnen die Anerkennung der Einsatzstellen über das Bundesamt des Zivildienstes ab. Wir denken, wir haben hier Träger in Verantwortung, deshalb ist die Trägerfunktion auch so wichtig die die Kontrollfunktion für das gesamten FSJ/FÖJ hat und sicherstellen muss, dass im Sinne der Freiwilligendienste auch Regelungen durchgeführt werden. Und da sagen wir, aufgrund auch unserer durchsichtigen Prozesse, die wir haben, es braucht eigentlich kein Bundesamt für den Zivildienst um diesen § 14c zu regeln.
Wir hoffen auf die Gespräche. Diese anderen Dinge sollen ja in einer Rechtsverordnung geregelt werden. Wir hatten schon zwei Gespräche, aber wir hoffen hier auf das weitest gehende, unsere Vorstellungen umsetzen zu können. Und dann würde es möglich sein so einen Übergang zu schaffen.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Slüter bitte.
SV Uwe Slüter: Ich möchte einmal anders herum anfangen. Ich selber bin hauptberuflich tätig in der katholischen Trägergruppe. Ich glaube, dass wir mit diesem Gesetz, mit der Aufmerksamkeit, die dieses Gesetz bekommt, wesentlich mehr Institutionen bekommen werden, die als Träger des FSJ tätig werden wollen. Das heißt, wir bekommen auf Dauer eine wesentlich breiter ausgefächerte Träger-vielfalt, die Anbieter sein wird. Und ich glaube, ein ganz maßgeblicher Anreiz für Einsatzstellen, sich als FSJ-Träger anerkennen zu lassen, ist dieser § 14 c, weil die Kostenerstattung, die von der Bundesregierung für den § 14 c in Aussicht gestellt wird, erheblich höher ist als die Kostenerstattung, die Träger für pädagogische Begleitung im FSJ bekommen.
Und wenn ein Träger, der jetzt als FSJ-Träger anerkannt ist, die Möglichkeit hat zu überlegen: Nehme ich den FSJ-Freiwilligen oder nehme ich den zivildienstpflichtigen jungen Mann, für den ich ja vielmehr Geld bekomme, dann werden die, wenn es keine Steuerungsmöglichkeiten gibt, sich zum Teil für den jungen Mann entscheiden. Und das ist unser Hauptpunkt wo wir sagen, wir brauchen eine Steuerungsinstanz und das sind die bundeszentralen Träger, weil die nämlich "mit einem ideologischen Handwerkszeug daran gehen". Wir wollen, dass es zu keinem Verdrängungswettbewerb von jungen Frauen durch junge Männer kommt. Das lässt sich aber nur verhindern, wenn wir auch dazu in die Lage versetzt werden und Träger vor Ort, wenn nicht eventuell sogar Einsatzstellenzusammen-schlüsse, Trägergesellschaften von Krankenhäusern als Träger anerkennen lassen, dann bekommen wir da Probleme, dann gibt es diesen Verdrängungswett-bewerb. Das sind die Bauchschmerzen, die wir mit dem §14 c an der Stelle haben. Aber das kann alles verhindert werden, wenn die Durchführungsverordnung an der Stelle vernünftig gestrickt wird in Zusammenarbeit mit uns Trägern. Ich kann nicht leugnen, dass wir im Bundes-arbeitskreis nicht einheitlich diese Möglichkeit begrüßen. Es gibt Träger dabei, die begrüßen dies und es gibt Träger, die haben erhebliche Bauch-schmerzen mit dieser Nähe zwischen Pflichtdienst und Freiwilligendienst. Deshalb haben wir uns dann zu der Sprachregelung durchgerungen: Wenn der § 14c kommt, setzen wir ihn um, wenn die Rahmenbedingungen für uns akzeptabel sind. Und die Rahmenbedingung werden in der Durchführungsverordnung gestrickt und nicht im Gesetz. Aber wir sind dazu bereit und wir wollen mithelfen, dass es Übergänge gibt auch für den gesamten sozialen Bereich vom Zivildienst hin auch zu Freiwilligendiensten, auch auf die Zukunft hin, im sozialen Bereich Freiwilligendienste noch stärker zu etablieren als bisher. Dafür brauchen wir aber Rahmenbedingungen.
Vorsitzende: Frau Eichhorn bitte für die CDU/CSU.
Abg. Maria Eichhorn (CDU/CSU): Meine zwei Fragen gehen sowohl an Frau Salzmann als auch an Herrn Wessels. Die erste Frage: Es ist von Herrn Slüter gesagt worden, dass jüngere Teilnehmer besonders pädagogisch begleitet werden müssen. Meine Frage an Sie beide: Gibt es Einsatzfelder, die für jüngere Teilnehmer nicht geeignet sind, wenn ich also sage ?Jüngere?, dann meine ich unter 18 Jahre, oder würden Sie unter 18 Jahre auch noch einmal differenzieren? Meine zweite Frage, auch an Herrn Wessels und Frau Salzmann, betrifft die pädagogische Begleitung: Es ist in § 2 die Rede, dass das Ziel der pädagogischen Begleitung ist, das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl zu stärken usw. und gerade auch im Zusammenhang mit den jüngeren Teilnehmern frage ich Sie: Gibt es genügend Spielraum zur Persönlich-keitsbildung im Rahmen dieser pädagogischen Begleitung? Denn es ist ja gerade für jüngere Teilnehmer nicht immer ganz einfach, sich auf die Erfordernisse einzustellen. Und daran im Anschluss noch eine Frage: Für eine zusätzliche Dienstzeit ist ja keine pädagogische Begleitung vorgesehen. Ist es nicht notwendig? Wenn Sie der Meinung sind, es wäre notwendig, welche Gründe sprechen dafür?
Vorsitzende: Frau Salzmann, bitte.
SV Helga Salzmann: Zur Frage nach den besonderen Einsatzfeldern, die sich entweder besonders für jüngere Teilnehmende eignen oder auch nicht eignen: Unsere Erfahrungen sind die, und das deckt sich eigentlich mit den Erfahrungswerten aller unserer regionalen Träger, dass geeignete Einsatzstellen für jüngere Leute die sind, wo eine sehr gute auch fachliche Anleitung geleistet werden kann, wo eine gute Betreuung in der Einsatzstelle stattfindet und ein relativ gut strukturierter Ablauf ist. Es eignen sich weniger Einsatzstellen - aufgrund der Erfahrungen unserer Träger -, die ein hohes Maß an Eigenverantwortung voraussetzen, wie z.B. in Jugendheimen oder in psychiatrischen Diensten, und da gibt es eine ganze Reihe anderer auch. Aber das sind so die Kriterien.
Jüngere Leute können gut eingesetzt werden in Einsatzbereichen, die gut strukturiert sind, das sind zum Teil auch die Pflegebereiche. Ich gehe jetzt nicht auf die Schwierigkeit ein, die im Moment sich in den Pflegebereichen tun, und füge ganz bewusst hinzu, dort eingesetzt, wo gute Begleitung möglich ist, und die ist nötig. Das entspricht dem Wunsch der jungen Teilnehmenden, was ihre Berufsorien-tierung anbelangt. Sie möchten zum Teil auch in den Bereich der Krankenpflege, in den Bereich der Altenpflege hineingehen. Und mit diesem Ansatz kommen sie zu uns und sind natürlich dann auch von uns, wenn ihr Wunsch das ist, zu vermitteln in solche Art von Einsatzstellen.
Wir haben auch über die Anschlussmöglichkeiten, die dann gerade für Hauptschülerinnen und Hauptschüler schwierig sind, geschrieben, aber das war jetzt nicht Ihre Frage, da gehe ich mal drüber hinweg.
Zur Frage, Verantwortungsbewusstsein, Spielraum für Persönlichkeitsentwicklung: Wir haben im evangelischen Bereich unterschiedliche Konzepte, Konzepte für die Bildungsarbeit für jüngere Menschen. Das haben Träger ausprobiert und sind auch dabei Konzepte des integrativen Ansatzes innerhalb der Seminargruppe durchzuführen. Sie machen sehr gute Erfahrungen damit. Es gibt einen Träger, der angefangen hat und gesagt hat, ich möchte jetzt 16jährige oder die unter 18jährigen für sich nehmen in der Bildungsarbeit, weil er dadurch näher auf sie eingehen kann und hat dann festgestellt, dass sich Probleme, die in dieser Altersgruppe vorhanden waren, potenzierten.
Diese Kollegin hat die Seminararbeit umgestellt und ist zum integrativen Ansatz übergegangen. Es gibt Erfahrungen genau in die andere Richtung. Es gibt Träger, die sagen, wir können uns sehr viel besser auf die jüngeren Teilnehmer einstellen, wenn wir hier spezielle Gruppen auch mit ihnen machen, die Entwicklung zur Persön-lichkeit hier dann auch fördern.
Ich kann dem nur zustimmen, was vorhin schon einmal gesagt wurde. Ich denke, wir sollten den Trägern die Möglichkeit geben, hier ihre Konzepte zu finden. Die Konzepte müssen auch nicht fest geschrieben werden für die Ewigkeit, sondern es richtet sich auch danach, welche jungen Leute ich bekomme und ob sie nun das integrative Konzept machen, was die meisten machen. Oder, ob sie auch ausprobieren mit Gruppen von unter 18jährigen, sollten wir in der Freiheit der Träger lassen.
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, wir haben den Qualitätssicherungsprozess im FSJ und wir haben ein Standardgesetz für pädagogische Begleitung, die auch unsere Träger einhalten und einhalten müssen. Und innerhalb dieser Qualitätsstandards spielt das Bildungsziel oder das Ziel zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und persönlichkeits-orientierte Anteile eine sehr große Rolle. Um diese Ziele herum wird auch das Konzept gebaut und das kann jeweils dann auch unterschiedlich aussehen.
Vorsitzende: Herr Wessels, bitte.
SV Robert Wessels: Ich will die erste Frage nur ganz knapp ergänzen. Die meisten Stichworte sind ja schon gefallen. Ich will mal die Stichworte nennen: natürliche Autorität, Aufsicht, Führer-schein.
Also ich denke, das gibt es schon wieder ein bisschen. Natürlich, jüngeren Freiwilligen, denen fehlt es etwas an natürlicher Autorität. Frau Salzmann hat erwähnt, der Einsatz in Jugendclubs wird schwieriger. Dann ein ganz praktisches Beispiel, der Führerschein. Wenn ein Führerschein benötigt wird, das ist natürlich für unter 18jährige auch problematisch.
Dann die Frage der Aufsicht. Wir haben eben vom FÖJ gehört, wenn Sie überlegen, dass auf einigen Vogelschutzinseln die Vögel gezählt werden, da sind die Freiwilligen auch relativ oft mit Zivildienstleistenden alleine. Das ist zwar aufregend, ist aber vom Gesetzgeber so nicht vorgesehen.
Was die Verlängerung angeht: Wir haben ja im Eckpunktepapier einen noch sehr viel längeren Dienst für das Ausland vorgesehen, sogar bis 24 Monate Laufzeit. Und auch dort haben wir dann eine weitere Begleitung vorgesehen, allerdings verkürzt. Sie ist dann im zweiten Jahr nicht mehr so ausgeprägt wie im ersten Jahr. Darüber könnte man sich ja Gedanken machen. Ich verhehle nicht, dass es bei uns im katholischen Raum durchaus darüber Streit gibt, ob diese Überlappungszeit, also der letzte Monat bis zum Studium, ob man da nicht sagen sollte: Okay, also in Gottes Namen, da verlängern wir lieber den Freiwilligendienst. Jetzt von unserer Seite her sage ich ein striktes Nein, also da gibt es Möglichkeiten, Arbeitsverträge zu verlängern oder befristete Arbeitsverträge einzugehen. Da gibt es andere Möglichkeiten und die sollten dann eben auch genutzt werden. Der freiwillige Dienst ist irgendwo auch an eine Begleitung geknüpft und die sollte dann eben auch gegeben werden. Eins gebe ich noch zu bedenken. Natürlich läuft auch der freiwillige Dienst in einem bestimmten Turnus ab. Verlängere ich jetzt Freiwilligendienste, könnte ich möglicherweise auch wieder Stellen damit blockieren.
Vorsitzende: Frau Blumental, die CDU hat jetzt noch 2 Minuten.
Abg. Antje Blumenthal (CDU/CSU): Da werde ich jetzt ganz schnell reden und nur die Fragen einmal an Frau Salzmann und Herrn Slüter und ein mal an Herrn Fischer richten.
Vorsitzende: Entschuldigung, die zwei Minuten bedeuten nicht, dass Sie in der Zeit die Fragen stellen, sondern Fragen und Antworten.
Abg. Antje Blumenthal (CDU/CSU): So habe ich es im Moment verstanden, dann entschuldige ich mich und frage ganz schnell. Auf welche Art und Weise kann die Benachteiligung junger Frauen im Freiwilligendienst im Ausland verhindert werden?
Es sind ja ganz kurz die Steuerungs-kriterien und die Raumbedingungen in der Durchführungsverordnung angesprochen worden. Dann noch einmal zu der Anzahl der Freiwilligenplätze im nicht-europäischen Ausland. Wie kann hier eine Ausweitung erreicht werden?
Vorsitzende: Und wer ist jetzt in der Lage, in einer Minute darauf zu antworten, Frau Salzmann? Wir haben nachher noch einen Moment Zeit in der offenen Runde, aber jetzt ist es ganz einfach so.
SV Helga Salzmann: Ich werde mich bemühen, weil ich eben die Antwort auf die letzte Frage nicht gegeben habe, habe ich jetzt vielleicht die Zeit.
Also, auf welche Weise kann die Benachteiligung für junge Frauen im Auslandsdienst aufgehoben werden? Die kann unseres Erachtens auf zwei Wegen aufgehoben werden. Einmal auf dem, dass der Bund auch für die jungen Frauen die Sozialversicherung übernimmt oder auf der anderen Seite durch eine andere Sozialversicherungsregelung. Ihre andere Frage, sagen Sie die noch einmal schnell, die zweite.
Abg. Antje Blumental (CDU/CSU): Die Ausweitung der Freiwilligenplätze im nichteuropäischen Ausland.
SV Helga Salzmann: Für uns stellt sich das so dar, dass, wenn die Kosten in diesem Bereich geringer werden, und die hängen halt auch sehr stark an der Sozialversicherung, dass hier eine Ausweitung durchaus auch möglich wäre. Wir haben das diakonische Jahr im Ausland als nicht gesetzlich geregelten Auslandsdienst. Wir haben, ich glaube jetzt 300 bis 400 Bewerbungen vorliegen und vermitteln 110 bis 120 Leute zu unseren Partnerorganisationen ins jetzt noch europäische Ausland.
Wir haben keine Möglichkeit, auf der Grundlage der gesetzlichen Regelung dieses diakonische Jahr im Ausland, z.B. auf die Ebene des geregelten FSJ Auslandsdienstes, umzusetzen. Das hätten wir sehr gerne getan, um auch die Jugendlichen in den Genuss der gesetzlichen Vergünstigungen zu bringen. Wir müssen jetzt weiter so arbeiten wie bisher. Werden aber unsere politischen Anstrengungen da auch nicht hinten anstellen, dieses dann doch noch zu ändern.
Und diese 120 werden nicht mitgezählt, wenn FSJ/Ausland gezählt wird. Also das muss man auch sehen. Entwicklungs-möglichkeiten werden gegeben, wenn man sich nur auf die Zahlen beruft, die heute im Ausland sind, dann gibt es eigentlich keinen Spielraum für Entwicklungs-möglichkeiten.
Vorsitzende: Vielen Dank. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bitte schön. Sie haben 10 Minuten.
Abg. Christian Simmert (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Herzlichen Dank auch von meiner Fraktion natürlich noch einmal für die Statements und für das rege Interesse. Wir bewegen uns mit dieser Novellierung des FSJ und FÖJ-Gesetz und den Auswirkungen im Zivildienst natürlich in mehreren Spannungsfeldern. Das ist einmal, einen Interessensausgleich herzustellen zwischen den Trägern auf der einen Seite und den jungen Menschen auf der anderen Seite, eine Absicherung junger Menschen zu erzielen, die sich bereit erklären, über ein Jahr hinaus Freiwilligendienste im FSJ/FÖJ zu machen. Und auf der anderen Seite, sozusagen den Trägern nachzukommen, um das Angebot entsprechend zu gestalten und auch durchführbar zu halten. Von daher frage ich Herrn Slüter, inwiefern es eine Möglichkeit gibt, oder wie er es bewertet, bezogen auf die Evaluation und Qualitätssicherung von Trägern unter den jetzigen Bedingungen bzw. den Bedingungen nach der Novellierung und bezogen auf die Frage von Integrationspotential von jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Wie sind dort die Erfahrungen? Wie ist die Einschätzung bezogen auf die Novellierung?
Wir haben dann natürlich auch noch ein Spannungsfeld in Bezug auf den Zivildienst. Das ist vorhin ja angesprochen worden. Es ist kein Geheimnis, dass meine Fraktion sich sehr stark dafür einsetzt, die Wehrpflicht abzuschaffen.
Natürlich haben wir, ja deshalb bin ich ja Grüner und kein Sozialdemokrat, also es ist so, dass wir natürlich auch darin einen kleinen Schritt sehen in Richtung Konversion. Wobei ich auch anmerken muss, dass es sehr begrüßenswert ist, dass wir hier Zertifikate haben, um auch Kompetenzen festzuhalten, die junge Menschen dort erwerben. Aber ich möchte auch deutlich sagen, es darf keine dritte Säule im dualen System geben, eine verdeckte nämlich, sozusagen eine klare Abgrenzung zwischen Lerndienst auf der einen Seite und ich sage mal "Arbeitsdienst" auf der anderen Seite. Da müssen wir alle miteinander aufpassen, dass das nicht passiert.
Zur Frage. Ich würde gerne Herrn Wessels, bezogen auf die Situation im Zivildienst, fragen. Die Stückelung ist ja freiwillig, das heißt, es handelt sich hier nicht um eine zwangsweise Flexibilisierung der Dienste, sondern es geht um ein freiwilliges Angebot im Gesetz. Wie bewerten Sie die Aufnahme der Träger, dass diese Freiwilligkeit in Anspruch genommen wird?
Zur letzten Frage, die geht an Herrn Staffa. Ich würde gerne fragen, was ja auch immer nicht so sehr im Mittelpunkt der politischen Debatte steht. Es geht auch um einen Freiwilligendienst, bzw. die Möglichkeiten, dass junge Menschen aus dem außereuropäischen Ausland und dem europäischen Ausland bei uns Freiwilligendienst machen. Also, wie ist das Potential einzuschätzen, über das sogenannte "incoming", also die jungen Menschen, die von ausländischen Diensten bzw. Trägern oder auch insgesamt aus dem außereuropäischen Ausland hier her kommen. Wie sind die Möglichkeiten? Was gibt es da auch an Regelungsbedarf?
Vorsitzende: Bitte schön, Herr Wessels und dann Herr Staffa, Herr Slüter auch? Ich sage dazu, dass die drei Herren sich jetzt 3 Minuten teilen müssen, wenn es nicht noch weitere Fragen gibt.
SV Uwe Slüter: Ich denke, dass dieses Gesetz eine wichtige Innovation hat, indem nämlich interkulturelles Lernen als ein Ziel des Gesetzes auch definiert wird. Interkulturelles Lernen hat für mich auf zwei Ebenen stattzufinden.
Zum einen die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, also in die bestehenden Dienste und zum anderen auch die Integration von Personen aus dem Ausland kommend, die bei uns dann einen Freiwilligendienst leisten wollen. Ich glaube, dass das in der Qualitätssicherung oder als Evaluationsfrage an dieses Gesetz in zwei Jahren auch gestellt werden muss. Gelingt mit diesem Gesetz diese Integration bzw. auch das interkulturelle Lernen. Die Integration mit Migrations-hintergrund, da müssen Sie die Träger fragen. Wir erheben diese Zahlen, also wir jetzt im katholischen Trägerbereich, erheben diese Zahlen nicht explizit, aber es ist so und es ist steigend, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund in unserem Programm mit dabei sind. Und ich denke, das wird auch noch zunehmen in der nächsten Zeit. Ein Problem hatten wir in der Vergangenheit immer damit, dass junge Menschen aus dem außereuropäischen Ausland in unsere Freiwilligendienste kommen wollten, aber diese keine Arbeitserlaubnis bekamen bzw. keine Visabefreiung. Da müsste die Regierung, da müssten auch Sie sehr stark darauf achten, dass keine Durchführungsverordnungen gemacht werden, die es dann wieder unmöglich machen, dass aus dem außereuropäischen und europäischen Ausland kommende junge Menschen auch ins FSJ kommen können. Die müssen arbeitserlaubnis- und visafrei kommen können, dann ist das für uns auch ohne Verwaltungsaufwand möglich. Und wir würden sie sehr gerne nehmen, um nämlich die Intention des Gesetzes "interkulturelles Lernen" zu ermöglichen.
Vorsitzende: Herr Wessels, bitte und dann anschließend Herr Staffa.
SV Robert Wessels: Ich hoffe, ich treffe jetzt ihre Frage schnell und knapp. Also, wenn es darum geht zu sagen, wie wir den § 14 c grundsätzlich einschätzen, dann haben wir das in der Stellungnahme versucht darzulegen, dass wir das begrüßen bei allen Bedenken.
Wenn Sie jetzt die Frage der Stückelung noch einmal in dem Zusammenhang aufwerfen und sagen, das ist ein freiwilliges Moment und das kann für den Zivildienstleistenden sehr attraktiv sein, sage ich, wenn wir diese Frage praktisch vor die Klammer ziehen, dann bleibt unsere Antwort die selbe. Also, egal, ob das FSJ als Zivildienst dann irgendwann einmal anerkannt werden soll, es bleibt erst einmal FSJ. Und, wenn wir sagen, für das FSJ halten wir eine Stückelung für nicht glücklich, dann bezieht es sich automatisch auf die Übertragung auf den Zivildienst.
Abg. Christian Simmert (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Wenn ich eine Nachfrage stellen darf: Die Frage war zum Potential. Sehen Sie überhaupt, dass das Angebot der Stückelung, der Flexibilisierung, was es ja gibt, wahrgenommen wird vom Träger?
SV Robert Wessels: Das kann ich im Moment wirklich nicht einschätzen, da müssten wir noch einmal Rücksprache halten, da habe ich keine Informationen.
Vorsitzende: Vielen Dank. Herr Staffa, bitte.
SV Dr. Christian Staffa: Aus meiner Perspektive ist das "incoming" tendenziell nicht im Blickpunkt der Gesetzgeber gewesen. Deswegen habe ich vorhin dazu auch gar nichts gesagt. Wir werden als Träger überhaupt gar keine Veranlassung sehen, ausländische Freiwillige, in Deutschland, in Einsatzstellen unter FSJ-Bedingungen hier anzulanden. Dafür taugt es einfach nicht, also ich wüßte nicht warum eine US-amerikanische Freiwillige, die bei uns arbeitet, Sozialversicherung entrichten sollte. Da fehlt schlicht das Motiv, uns das Geld, und wenn man sozusagen nicht das Interesse von Herrn Riester, sondern von den Freiwilligen in den Mittelpunkt stellt, über das FSJ das "incoming" zu verstärken. Und es wird auch nicht darüber laufen. Gleichwohl sind die Forderungen, glaube ich von Herrn Slüter ausgesprochen, berechtigt. Also, - wobei ich es für ASF sagen muss -, dass wir überhaupt keine aufenthaltsrechtlichen Probleme haben, auch mit mittel-osteuropäischen Menschen oder eben aus Israel und USA, wo wir sonst Freiwillige her haben. Das ist aber bei anderen Trägern anders, dass liegt möglicherweise an unseren guten Ruf. Aber jedenfalls das Potential, gerade im mittelosteuropäischen Bereich, ist unglaublich. Wir haben, wie gesagt ein Programm für polnische Freiwillige, die Nachfrage war irrsinnig groß, und die Nachfrage nach Freiwilligen- plätzen, das weiß Herr Gerstberger auch, ist unglaublich groß und fast nicht zu befriedigen.
Wie gesagt, unter FSJ-Gesichtspunkten glaube ich überhaupt nicht. Wir stützen uns da auf das EVS, weil das EVS sozusagen in der Schräge existiert, dass sie mehr raus schicken als rein holen, und da ist ein Verhältnis von 1300 zu 800 - wenn ich das richtig im Kopf habe. So dass die auch in Zukunft verstärkt das "incoming" fördern werden, und das ist auch für uns als Träger sozusagen die attraktive Variante.
Vorsitzende: Vielen Dank. Die FDP hat jetzt 10 Minuten Frage- und Antwortzeit.
Abg. Ina Lenke (FDP): Herzlichen Dank für ihre Stellungnahmen. Ich habe zwei Fragen an Herrn Gerstberger und eine Frage an Herrn Prof. Steinmeyer:
Herr Gerstberger, Sie plädieren für grundsätzliche Veränderungen des geltenden Trägerprinzips bei Freiwilligen-diensten. Welche Möglichkeiten sehen Sie innerhalb des vorliegenden Gesetz-entwurfes, hierzu bereits erste Verbesserungen vorzusehen, vor allem im Hinblick auf eine größere Trägervielfalt bei gleichzeitiger Qualitätssicherung? Das ist meine erste Frage. Die zweite Frage: Wenn auf Basis eines eigenen Gesetzes gelingen sollte, eine Vielfalt und Vielzahl von Freiwilligendiensten ins Leben zu rufen, wie kann einmal die Finanzierung gesichert werden und wie erreichen wir Trägervielfalt, z.B. durch Nichtfest-schreibung bestimmter Träger, sondern durch die Erweiterung der Rahmen-bedingungen? Das ist meine zweite Frage. Und eine Frage noch an Prof. Steinmeyer: Herr Professor, welche andere Sozialver-sicherungsregelung, als die von Ihnen vorgeschlagene ist als Alternative möglich?
Denn wir haben ja hier gehört, dass gerade das deutsche Sozialversicherungsrecht, was Sie ja heute auch ganz speziell und sehr, sag? ich mal, einspurig als Grundlage Ihrer Stellungnahme vorgeschlagen haben, hohe Hürden für neue Freiwilligen-dienstplätze bringt. Sie haben ja selber hier auch gehört, wie schwierig das ist. Ich würde Sie bitten, dass Sie heute hier eine Alternative vorschlagen.
Vorsitzende: Bitte schön, Herr Gerst-berger.
SV Günter Gerstberger: Auf der Grundlage des vorliegenden Gesetzesentwurf wird es in der Tat schwierig sein, die Trägerlandschaft gewaltig zu erweitern und wir haben auch die Stellungnahmen der zentralen Träger hier gehört, die darauf bedacht sind, vielleicht auch darauf bedacht sein müssen, eine zentrale Steuerungs- und Kontrollfunktion wahr zunehmen im Blick auf die neuen Mittel, die jetzt vielleicht über den Zivildienst hier her fließen.
Ich fürchte, wenn es bei dieser Regelung bleibt, dass wir dann diese Trägervielfalt nicht herstellen können, aber ich will konstruktiv sein. Man kann innerhalb des vorliegenden Entwurfes sehr wohl darauf achten, eine Basiserweiterung zu schaffen. Dass man z.B. in dem Gesetz festschreibt, dass bei der Beschreibung, bei der Festlegung der Einsätze der Freiwilligendienste, die Einsatzstellen herangezogen werden. Dass sie in einem höchstmöglichen Maße herangezogen werden, um beispielsweise ein Bildungspaket für die jungen Leute vorzulegen, wo sie auch angeregt werden, verpflichtet werden, örtliche Ressourcen dafür mit einzuspannen.
Dieses sehe ich als Möglichkeit, aber innerhalb der jetzt vorliegenden Regelung - Anerkennung der Träger auch noch über Landesbehörden - wird das außerordentlich schwierig sein.
Die zweite Frage: Wenn es gelingt, eine Vielfalt und Vielzahl von Freiwilligen-diensten ins Leben zu rufen, wie kann da die Finanzierung gesichert werden? Ich sage es mal sehr deutlich, die Finanzierung kann eigentlich nicht gesichert werden. Sie kann nicht gesichert werden, wenn wir an einen bürgergesellschaftlichen Dienst, staatsfernen Dienst denken, der sich nicht primär ausrichtet an staatlicher Alimentierung, an staatlicher Finanzierung, denn er zwingt dann natürlich die Träger. Er zwingt sie geradezu, nach diesen Quellen Ausschau zu halten und ihr Angebot danach zu richten. Diese Finanzierung kann in der Form nicht gesichert sein. Was wir tun können, ist, langfristig Geldquellen zu erschließen, Geldquellen, die bisher noch gar nicht in den Blick genommen worden sind, die es gibt. Denken Sie an die kleinen Stadtstiftungen, an die Bürgerstiftungen, denken Sie auch an die Unterstützerkreise. Ich will das nicht überstrapazieren, Herr Staffa, die Unterstützerkreise, die in den deregulierten Diensten natürlich existieren. Wie wollten Sie sonst ihren Dienst finanzieren? Ich will nur sagen, man muss verschiedene Quellen hierzu erschließen und natürlich auch Privatpersonen, die Geld haben, hierfür interessieren. Das geht aber nur, wenn wir Freiwillige und Private in eine Verbindung miteinander bringen. Die Öffentlichen sind dabei natürlich nicht ausgenommen. Öffentliche Mittel müssen mit dazu und im Blick auf Reduzierung, Aussetzung Zivildienst ist es völlig klar, dass diese Mittel nicht in den großen Topf zurückfließen, sondern dass sie zur Verfügung stehen müssen.
Die Frage ist nur, wie stehen sie zur Verfügung? Und da würden wir plädieren, nicht über Kanalisierung in die zentralen Trägerverbände, sondern am offenen Tisch ein Aushandlungsverfahren herbei zu führen. Aushandlungsverfahren öffentlich, transparent, übrigens auch für die Qualifizierung von Trägern, für die Qualitätssicherung von Trägern. Diese Qualifizierung ist aber nicht schon im Sack. Nicht die Dienste ändern sich, die Qualität ändert sich, die Ansprüche ändern sich. Da muss offen diskutiert werden, welche Qualitätsmaßstäbe wir alle haben und wie wir die auf Dauer sichern. Der Vorschlag der Kommission des Manifestes war, und ich kann das nur wiederholen, dass man anstrebt, unabhängige Agenturen einzurichten, wo die ganz unterschied-lichen Träger, die alten und die neuen, zusammen kommen und sich einem solchen Zertifizierungsverfahren unter-werfen. Danke.
Vorsitzende: Herr Prof. Dr. Steinmeyer, bitte. Sie haben jetzt das Kunststück zu vollbringen, in gut einer Minute einen völlig neuen Entwurf vorlegen zu können.
SV Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer: Ich möchte deshalb das beste dafür tun, aber kann das jetzt nur auf Skizzen beziehen. Zunächst einmal: Wenn man sich überlegt, woran es eben immer gescheitert ist und wo die Probleme waren, ging es ja letztlich, salopp gesagt, um das liebe Geld. Das ist die Frage, wie es zu finanzieren war. Die andere Frage, die man genauso sehen muss, ist nämlich die Frage: welchen Schutz will man für die Leute eigentlich haben. Und wenn man diese Leute schützen will, dann muss man das entweder über die Sozialversicherung machen oder man muss es über die Privatversicherung machen. Aber ich glaube nicht, dass die Privatversicherung unbedingt billiger sein wird. Man kann es machen.
Eine Sache ist auch noch die, dass man natürlich sehen muss: Wenn man die Frage hier so löst, dann muss man sie gleichzeitig grundsätzlich in beiden Gesetzen neu regeln. Das heißt also, Sie müssen alles neu machen, auch für die Inlandstätigkeit. Sie können nicht die Inlandstätigkeit und die Auslandstätigkeit ungleich behandeln, dann kommen Sie in größere Schwierigkeiten.
Wenn die Leute im Ausland sind, sollten sie eben, aus meiner Sicht, den Schutz auch entsprechend erhalten. Da brauchen sie ihn möglicherweise besonders.
Vorsitzende: Vielen Dank. Die PDS hat jetzt 5 Frage- und Antwortminuten.
Abg. Monika Balt (PDS): Ein Kunststück. Auch von mir ausdrücklichen Dank an die Herren Sachverständigen und die Frau natürlich, ist klar, ein bisschen unterrepräsentiert, für die Statements und die Stellungnahmen.
Meine Fragen richten sich an Herrn Fischer. Ich will noch einmal eingehen auf: Wie wirkt das Gesetz im Hinblick auf die internationalen Freiwilligendienste? Also ganz konkret und wirklich. Mich würde interessieren, wie Sie bei der Bewertung auf die Verordnung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft auch noch einmal eingehen, aber auch, welche Folgen hat dies für die jungen Freiwilligen aus dem Ausland hier dann wirklich? Und meine zweite Frage wäre: Welche Alternativen sehen Sie als einer, der live vor Ort ein freiwilliges soziales Jahr gemacht hat, auch aus Sicht eines Betroffenen oder der Betroffenen und der Freiwilligen selbst? Vielen Dank.
Vorsitzende: Bitte schön, Herr Fischer.
SV Jörn Fischer: Trotz der Kürze der Zeit möchte ich auch noch ein Lob nicht vergessen, was ich im ersten Statement nicht angebracht habe, und zwar zu §14c. Das ist aus Sicht der Freiwilligen zu begrüßen. Trotzdem sollte dieser Standard sozusagen genommen werden, um auch zu versuchen, für die jungen Frauen einen gleichen Standard zu erreichen. Wie gesagt, das Gesetz fördert die internationalen Dienste nur ganz gering, das habe ich in der ersten Stellungnahme dargelegt. Es gibt eine Reihe von Regelungen in dem jetzigen Vorschlag, die nicht den Anforderungen der internationalen Dienste entsprechen, und auf die möchte ich zunächst eingehen.
Die praxisfremdeste Regelung des Gesetzes ist wohl der Zwang, einen notwendigen Sprachkurs in Deutschland durchzuführen. Da wird jeglicher sprachpraktischer und pädagogischer Erfahrung widersprochen. Die Fremd-sprache lässt sich naturgemäß eben besser in dem Land lernen, wo sie auch auf der Straße gesprochen wird. Es ist bereits vielfach erwähnt worden, aber es zeigt ja auch die Dringlichkeit dieses Anliegens. Die vorgesehene Begrenzung des Dienstes im Ausland auf 12 Monate steht im Widerspruch auch zu den tatsächlichen Anforderungen dieser grenzüber-schreitenden Dienste. Gerade im Ausland ist ein längerer Dienst vielfach erforderlich. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Interkulturelle Lernerfolge brauchen ihre Zeit, und für mich waren die wertvollsten Monate das letzte halbe Jahr, sprich die Monate 10 bis 15. Es besteht eine Vielzahl von unterschiedlichen pädagogischen Konzepten, die eben auch auf die Gegebenheiten vor Ort eingestellt sind. Durch die Begrenzung der Dienstzeit auf 12 Monate sind auch Strukturen gefährdet, wobei ja auch darauf zu achten ist, dass nach Abzug von Seminar und Urlaub der Freiwillige tatsächlich nur noch ungefähr 9,5 Monate in seinem Projekt verbringt. Und auch eine Einarbeitung der nachfolgenden Freiwilligen durch ihre Vorgänger wird dadurch auch praktisch nicht mehr möglich sein. Diese Begrenzung der Dienstzeit wird mit der EWG Verordnung 140871 begründet, wonach eben Arbeitnehmer innerhalb der EU für nicht mehr als 12 Monate von ihrem Arbeitgeber in ein anderes Mitgliedsland entsandt werden können, wenn das heimische Sozialversicherungs-recht Anwendung finden soll. Wohl gemerkt, es ist in der EU-Verordnung. Der Rest der Welt ist davon nicht betroffen und es geht auch nicht darum, Herr Steinmeyer, eine EU-Verordnung sozusagen im deutschen Alleingang zu ändern, sondern nach meiner Einschätzung schließe ich die Einhaltung der EWG Verordnung und andererseits die im Gesetz fest geschriebene Möglichkeit, einen Dienst von 18 bis 24 Monaten leisten zu können, nicht aus.
Daher könnte im FSJ-Gesetz die Möglichkeit einer längeren Dauer fest geschrieben werden, die dann eben nur in den wenigen EU-Ländern nicht zum Tragen kommt, wo keine Ausnahme-vereinbarungen nach Artikel 17 geschaffen werden, wobei diese Ausnahme-vereinbarungen nach unserer Information nicht so kompliziert sind, wie jetzt anderswo dargestellt. Vielleicht auch die Visaproblematik: Den hohen Standard der Sozialversicherungsysteme in Deutschland, den kann man sicher nicht so ohne weiteres auf die ganze Welt übertragen, auch insbesondere nicht auf die Entwicklungsländer, in denen auch viele Freiwilligendienste geleistet werden. Es gibt Regionen in Bolivien, da treten sich die Freiwilligen auf die Füße, also es sind nicht nur ein, zwei Leute. Mich hat das uruguayische Konsulat in Hamburg ausdrücklich gewarnt, bei der Einreise auch nur irgend etwas von Arbeits- oder Arbeitnehmerverhältnis in den Mund zu nehmen. Noch ein Wort zum geplanten Anerkennungsverfahren für die Träger der internationalen Dienste: Das stellt sich aus unserer Sicht auch problematisch dar. Eine Anerkennung auf Landesebene ist nicht nur dann praktikabel, wenn diese auch gleichzeitig mit einer bundesweiten Möglichkeit verbunden ist. Die Dienste im Ausland werden eben gerade nicht im geographischen Einzugsbereich des Trägers geleistet, und alles andere wäre nicht praxisgerecht. Auch noch eine Bemerkung zu den ausländischen Freiwilligen, die den Dienst in Deutschland leisten möchten. Für diese Jugendlichen ist ein Freiwilligendienst in Deutschland aus aufenthaltsrechtlichen Gründen oft doch nicht so einfach möglich. Es ist da oft problematisch gewesen, eine Aufenthaltsgenehmigung für diese Gruppe der Freiwilligen zu erhalten. Ein Freiwilligendienst ist nach unserer Definition keine Berufstätigkeit und ist auch von festgelegter und begrenzter Dauer. Daher denke ich, gibt es keine Begründung, Ausländern einen freiwilligen Lerndienst zum Wohle der Gemeinschaft nicht zu ermöglichen. Ohnehin leisten vielmehr Deutsche einen Freiwilligen-dienst im Ausland als es Ausländer in Deutschland tun, und deren Anzahl ist auch in absoluten Zahlen relativ gering.
Dieses Problem ließe sich durch eine Änderung der entsprechenden Verordnung lösen, vielen Dank.
Vorsitzende: Vielen Dank, jetzt sind wir am Beginn der offenen Runde. Frau Lörcher hat sich gemeldet, Herr Dörflinger, Frau Diemers, Frau Rupprecht, Frau Lenke und Frau Balt. Wollen wir es so machen, dass wir die ersten drei Fragen nehmen und dann eine Antwortrunde, danach die nächsten drei Fragen, ist das in Ordnung? Dann Frau Lörcher, Herr Dörflinger und Frau Diemers.
Abg. Christa Lörcher (fraktionslos) Vielen Dank. Ich habe drei Fragen an Herrn Staffa.
Die erste Frage: In manchen Stellungnahmen wird die Begleitung oder Betreuung durch Ehrenamtliche angesprochen. Ich wollte Sie fragen, sehen Sie das für sinnvoll an durch Ehrenamtliche oder müssen es Hauptamtliche sein mit fachlicher und pädagogischer Qualifikation? Die zweite Frage geht auch in Richtung Bildung, die Bildungstage oder das Bildungspaket, wie auch mancherorts gesagt wird. Welche Mindestanforderungen sehen Sie da für sowohl den Freiwilligendienst im Inland als auch im Ausland? Ich meine, da sind sicherlich große Unterschiede, könnte ich mir vorstellen. Und die dritte Frage geht auch in die gleiche Richtung: Interkulturelles Lernen wird ja als großes Ziel gesagt und wird auch immer wichtiger. Kann man das nur im Ausland lernen oder kann man das nicht auch sehr wohl im Inland lernen, auch wenn natürlich im Ausland zusätzlich andere Erfahrungen dazu kommen? Dann wollte ich noch sagen, zur Ableistung in Abschnitten: Wenn ich das richtig verstehe, ist das doch nur eine Wahlmöglichkeit und nicht die Regel, also weil das von einigen immer so kritisch genannt wurde, also eine zusätzliche Möglichkeit. Und dann noch eine Frage, wo ich nicht weiß, wer etwas dazu sagen kann. Der Einfluss des FSJ und des FÖJ auf die Berufswahl: Gibt es da Untersuchungen dazu, wo man tatsächlich was sagen kann? Vielen Dank.
Vorsitzende: So, die drei Fragen waren jetzt an Herrn Staffa? Die letzte, da weiß ich nicht, wer da etwas zu sagen kann.
Abg. Thomas Dörflinger (CDU/CSU): Ich habe noch eine Frage an Herrn Wessels. Und zwar es gibt nach meinem Kenntnisstand im Bereich der katholischen Kirche eine Reihe von Angeboten an Freiwilligendiensten, die dem Standard, wie er jetzt durch die Gesetzesnovelle aufgelegt wird, nicht genügt. Können Sie eine Angabe darüber machen: Erstens, in welcher Größenordnung wir uns da bewegen? Und was das möglicherweise generell an Auswirkungen hat, was den Freiwilligendienst im Ausland angeht?
Vorsitzende: Frau Diemers, bitte.
Abg. Renate Diemers (CDU/CSU):Ich habe eine Nachfrage zur Erweiterung der Einsatzbereiche. Ich denke da an den Bereich Familie, wobei ich nicht unbedingt allein nur die kinderreiche Familie sehe, ich sehe auch die Familie mit einer pflegebedürftigen Person, ob Kind, Jugendlicher oder älterer Mensch. Ich denke da an die Seniorenhaushalte, ich denke aber auch an die landwirt-schaftlichen Haushalte. Ich glaube, dass es da bei den Jugendlichen durchaus eine Zielgruppe gibt, die Interesse hätte, so einen Dienst für ein Jahr anzutreten. Hier ist vorhin auch das Stichwort gefallen "Private und Freiwillige zusammen bringen". Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ich würde mich freuen, wenn Herr Kohler und Frau Salzmann darauf antworten könnten, und wenn dann noch Zeit wäre, eine Antwort wegen der Versicherung, von Prof. Dr. Steinmeyer. Meine eigentliche Frage war: Gibt dieser Gesetzentwurf hier genügend Spielraum dafür?
Vorsitzende: Jetzt sage ich noch etwas zum Vorgehen: Es gab jetzt drei Fragen von Frau Lörcher an Herrn Staffa, von Herrn Dörflinger an Herrn Wessels, von Frau Diemers an Herrn Kohler, Frau Salzmann und Herrn Prof. Dr. Steinmeyer.
Die Bitte ist jetzt, dass Sie es so kurz wie möglich machen, damit die anderen drei Abgeordneten, die auch noch Fragen haben, es noch schaffen. Wir haben jetzt noch insgesamt Zeit bis 13.30 Uhr, das heißt, noch eine gute Viertelstunde. Bitte schön, Herr Staffa.
SV Dr. Christian Staffa: Ich gebe mir Mühe, obwohl diese Ehrenamtlichen- Frage natürlich eigentlich ein bisschen Ausführlichkeit erfordern würde. Es ist so, und das ist auch mein ständiger Dissens mit Herrn Gerstberger. Wir arbeiten mit Ehrenamtlichen. Es ist ja überhaupt nicht so, dass wir unsere Arbeit nur auf Hauptamtliche stützen. Unsere gesamte Vorbereitung und Nachbereitung läuft über Ehrenamtliche. Tatsächlich braucht man zur Begleitung dieser Ehrenamtlichen Profis und Qualifizierungsangebote. Diese sind öfter vernachlässigt worden, aber ich denke, dass das ein extrem wichtiger Aspekt ist, weil man die mit den Erfahrungen auch nicht allein lassen darf. Allein der Druck bei der Auswahl von Freiwilligen, die bei uns auch von Ehrenamtlichen gemacht wird, diese Entscheidung zu treffen, das verlangt nach einer Supervision.
Insgesamt denke ich, dass die Begleitung im Ausland auch noch einmal etwas anderes ist, als die Begleitung im Inland. Ich kann mir im Inland stärker auch noch einmal eine Rekurrierung auf das Mentorenmodell, nicht als alleiniges Modell, vorstellen. Im Ausland ist es sehr viel schwieriger, wobei man sagen muss, dass die Leiter von Einsatzstellen oder die Begleiter von Freiwilligen in Einsatzstellen im Ausland sowieso schon 40% dieser Begleitung ehrenamtlich gestalten. Die kriegen von uns ja dafür kein Geld. Das heißt, es ist ein bisschen ideologisiert, die Debatte. Wenn man da sachlich drauf guckt, sieht man wie hoch der ehrenamtliche Anteil, insbesondere im Auslandsdienst ist, obwohl wir uns professionelle Begleitung auch erlauben und sie für absolut notwendig halten. Das kann man sich auch aufgrund der Geschichte, der Erfahrungen in so fremden Kontexten wie z.B. in einem Kinderkrebskrankenhaus in Minsk usw., ausmalen, was man da an Begleitungsaufwand betreiben muss. Bildungstage: wie viele sind nötig? Ich denke, dass das, was da im Gesetz fest geschrieben ist, sinnvoll ist. Ich habe eine ähnliche Einschätzung, dass ein Großteil der Bildungstage eigentlich im Ausland stattfinden sollte, und dass man da etwas flexibler herangehen könnte und sollte, weil gerade nicht nur die Vorbereitung in Deutschland wichtig ist, sondern auch direkt nach der Ankunft im Ausland. Da müsste man ein bisschen Flexibilität rein bringen, aber da bin ich auch optimistisch.
Interkulturelles Lernen kann man natürlich auch im Inland praktizieren. Das hat natürlich ein ganz anderes Gewicht und die Fremdheitserfahrung, und das sich selbst Fremdwerden im Ausland ist eine ganz andere Dimension, die will ich gar nicht gewichten. Aber es ist eine andere Art der interkulturellen Erfahrung, und ich glaube, dass wir im Inland sehr viel mehr Einsatzstellen in dem Bereich schaffen sollten. Das ist gar keine Frage, aber beides wiederum braucht auch tatsächlich eine sehr kompetente Begleitung, danke.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Wessels bitte. Das war die Frage von Herrn Dörflinger.
SV Robert Wessels: Die BAG erhebt tatsächlich die Zahl wie viele langfristige, mittelfristige Freiwillendienste im europäische, außereuropäischen Ausland abgeleistet werden. Ich habe leider nur die Zahlen von 1997/ 1998 heute hier. Es gibt jährliche Umfragen, da waren es 164, die über katholische Träger solche Dienste gemacht haben, dass war aber damals die Anlaufphase. Es hatten da noch nicht alle geantwortet, es wird also etwas höher liegen. Die Alternativen, was bleibt übrig. Entweder man arrangiert sich, also wenn das neue Gesetz jetzt kommt, mit dem neuen Gesetz und muss dann entsprechend anpassen, oder das Gesetz wird nicht in Anspruch genommen werden und man wird dann weiter so arbeiten wie bisher. Die Möglichkeit besteht auch noch. Ich möchte vielleicht noch eine Sache zur Sozialversicherungspflicht sagen. Ich habe das Gutachten von Prof. Dr. Steinmeyer bisher eigentlich immer so verstanden, dass hier der sicherste Weg gesucht wird, also: was ist nach dem derzeitigen Regelungsstand auf jeden Fall sicher, dass ein deutsches Sozialversicherungsrecht zur Anwendung kommt. Herr Prof. Steinmeyer zeigt selbst Ausnahmen auf, erwähnt den Artikel 17, der dann, ich glaube über die AOK, in Deutschland geltend zu machen ist, wo sich dann Unternehmen hervor tun. Also, solche Ausnahmegenehmigungen zu bekommen, da ist dann die Frage, ob es wirklich so kompliziert ist. Also, es ist hier der sicherste Weg, es ist nicht der einzige Weg, und vielleicht wäre da noch die Möglichkeit, ein bisschen weiter zu denken, vielleicht noch etwas kreativer zu sein. Das Gutachten von Prof. Steinmeyer gibt ja durchaus Ansätze, danke.
Vorsitzende: Vielen Dank. Herr Kohler, Frau Salzmann und Herr Prof. Dr. Steinmeyer. Sie sind jetzt noch kurz gefragt zu Frau Diemers.
SV Walter Kohler: Ich will es auch kurz machen. In Baden Württemberg haben wir einen Träger, einen einzigen, und ich denke, das ist auch der einzige im ganzen Bundesgebiet, der Einsätze in den Familien anbietet, für internationale Jugendarbeit. Es ist nach der bisherigen Regelung kein Problem gewesen, einen solchen Träger zu installieren oder eine solche Aufgabe. Und wir gehen auch davon aus, dass es nach der neuen Fassung kein Problem sein wird, das Angebot beizubehalten. Wie sehr dieses Angebot gefragt ist, sehen wir momentan darin, der Verein für internationale Jugendarbeit gibt diesen Zweig auf aus Gründen im Bereich der Mitarbeiter. Wir sind bemüht, ein Ersatzangebot zu finden, und wir bekommen eine Flut von Anfragen und von Schreiben von Familien, denen bereits geholfen worden ist durch dieses Angebot, und wir bekommen aber mindestens genau so viele Schreiben und Meinungsäußerungen von FSJlerinnen, die in Familien gearbeitet haben und alle bestätigen uns deutlich, dass vor allem gerade für jüngere Teilnehmerinnen dies ein ganz hervorragendes Angebot sei, das dringend weiter bestehen sollte. Also, von daher werden wir alles daran setzen, dieses Angebot weiter zu halten, und wir gehen davon aus, dass dieses Angebot wahrscheinlich auch weitere Nachahmer finden muss. Danke schön.
SV Helga Salzmann: Hier haben wir eine echte Kontroverse. Wir lehnen Familieneinsätze oder Familien als Einsatzstelle ab. Wir haben ja auch bisher 90 % Frauen im Programm gehabt. Es wurde zu leicht auch verstanden als Hausmädchenprogramm, Hausvermitt-lungsprogramm. Wir haben auch unterschiedliche Informationen offen-sichtlich, was den Verein für Internationale Jugendarbeit anbelangt, der jetzt gerade sein Sonderprogramm eingestellt hat. Der Verein hat mir mitgeteilt, aufgrund von Problemen mit dem Aufhören von Kolleginnen und Kollegen kann das Programm so nicht weitergeführt werden. Aber auch aufgrund fehlender Nachfrage junger Freiwilliger, die bereit wären, in diesen Bereich hineinzugehen. Dass Anfragen von Familien sehr stark kommen, das scheint mir auch klar zu sein. Dieses Ganze allerdings, heißt für uns nicht, dass junge Freiwillige nicht in Familien arbeiten könnten. Wir lehnen sie nur in der Form als Einsatzstelle ab. Sondern es gibt andere Formen, die wir praktizieren, und die sehr gute Erfahrungen bringen. Nämlich, entweder eine Familienbetreuung über eine bestimmte Anzahl von Nachmittagen zu gewährleisten, und die Einsatzstelle ist dann entweder die Sozialstation in dem Bereich dort - der die Meldung von den Familien bekommt, familienunterstützende Dienste wahrzunehmen, in diesen zu arbeiten oder z.B. in einer Kirchengemeinde zu arbeiten und dort dann auch zu bestimmten Zeiten in bestimmte Familien zu gehen und zu arbeiten und sein Engagement dort zur Verfügung zu stellen. Aber wir halten das 1:1-Verhältnis, eine junge Freiwillige, ein junger Freiwilliger in eine Familie als Einsatzstelle für nicht gut, weil hier die Verfilzung so stark werden kann, dass da kein Spielraum mehr ist. Ich kann das nur so ganz kurz sagen. Aber wir unterstützen die Arbeit und die Hilfe für Familien, nicht dass da jetzt etwas Falsches herüberkommt, aber in einem anderen System.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Steinmeyer, bitte.
SV Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer: Ich kann es sehr kurz machen. Die Frage, die an mich gerichtet war, war die Sozialversicherungspflicht in dem Fall. In dem Augenblick, wo es sich um einen Freiwilligendienst im Sinne von § 2 Abs. 2 handelt, also, wo in den Einrichtungen die entsprechende Voraussetzung erfüllt ist, ist die Sozialversicherungspflicht sicher gestellt. Wenn es etwas außerhalb ist, dann ist sie nicht sicher gestellt. Also ist schlicht die Frage, ob es sich hier um eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege handelt, die dann tätig wird und diese betreffende Person dort hin entsendet. Dann hätten wir wiederum eine Sozialversicherungspflicht.
Vorsitzende: Vielen Dank, jetzt kommt die letzte Fragerunde. Herr Dzewas, Frau Lenke und Frau Balt.
Abg. Dieter Dzewas (SPD) Eine kurze Frage noch einmal an Herrn Slüter. Es gibt ja zwei unterschiedliche Positionen. Einmal zu dem Zeugnis, das ist auch gerade bei Herrn Gerstberger noch einmal deutlich geworden, der durchaus auf ein qualifiziertes Zeugnis abgehoben hat, und dass es ein wichtiges Interesse, auch junger Menschen ist. Andererseits höre ich häufig auch wieder von anderen Trägern, das soll aber nicht zu leistungsbezogen sein, sondern eher eine Teilnahme-bescheinigung. Wie kann man diesen Widerspruch auflösen, weil ich persönlich auch eher der Meinung von Herrn Gerstberger anhänge und denke, dass die jungen Menschen schon Interesse daran haben, möglichst viele von den erworbenen Qualifikationen dokumentiert zu bekommen, um damit auch weiter etwas anzufangen. Das war Punkt eins. Punkt zwei geht noch einmal an Herrn Kohler: Sie haben das mit dem Sozialguthaben in Ihrer Stellungnahme noch einmal ausgeführt. Können Sie sich vorstellen, angesichts unserer derzeitigen Wehrverfassung, und nur auf der Grundlage ist ja dieses Konstrukt § 14 c, Zivildienst usw. auch denkbar, dass auf der Grundlage der Wehrverfassung ein solches Konstrukt Bestand haben könnte, wie Sie das mit dem Sozialguthaben angefügt haben?
Abg. Ina Lenke (FDP): Herr Professor Steinmeyer, ich möchte noch einmal auf die Sozialversicherungspflicht im Ausland eingehen. Ich habe mir jetzt die Stellungnahmen der EKD, der AWO und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege angeschaut, die nicht nur wie er oder ich von der FDP sagen, man solle wirklich überlegen, ob dieser Hemmschuh nicht etwas niedriger gehängt werden kann. Um auch richtig verstanden zu werden, ich will natürlich nicht die Sozialversicherungspflicht abschaffen, wir brauchen eine Versicherung für die jungen Leute. Aber eben hat einer Ihrer Kollegen gesagt, in Ihrer Stellungnahme sei es ja auch schon möglich, Ausnahmereglungen für diesen Bereich auch zu sehen. Ich möchte Sie bitten, können Sie mir Ausnahmeregelungen nennen, um den Forderungen der EKD, der AWO und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege nachzukommen? Mir geht es, und sicher uns allen auch, um die Möglichkeit der Erweiterung der Plätze im Ausland. Ich sehe hier einen closed shop, und deshalb möchte ich Sie doch bitten, noch einmal auf diesen Bereich einzugehen.
Abg. Monika Balt (PDS): Zwei kurze Fragen: Die erste an Herrn Fischer. Herr Fischer, wie bewerten Sie die vorgesehene pädagogische Begleitung aus Sicht der Betroffenen selbst? Da können Sie sicher noch einmal etwas dazu sagen. Eine Frage an Herrn Professor Steinmeyer. Teilen Sie die Auffassung, nach der sich die Einhaltung der EWG-Verordnung, von der vorhin schon einmal die Rede war, und eine im Gesetz fest geschriebene Möglichkeit einer Dauer von bis zu 24 Monaten nicht widersprechen?
Vorsitzende: Herr Slüter, bitte. Das war die Frage von Herrn Dzewas.
SV Uwe Slüter: Die Frage nach dem Zeugnis, es ist ja so, dass wir bisher im FSJ schon ein Zeugnis ausstellen, Anfangsbescheinigung, Endbescheinigung und auf Wunsch der Freiwilligen unsere Träger das soziale Engagement, das gemeinwohlorientierte Engagement bescheinigen, im Sinne von: Welche Schlüsselqualifikation haben die Freiwilligen im Dienst erworben. Dieses jetzt gesetzlich festgeschriebene Zeugnis geht uns zu sehr in den berufs-qualifizierenden Kreis, weil es ein Zeugnis im Sinne eines Arbeitnehmerzeugnisses für geleistete Tätigkeit in einer Einrichtung ist. Ich will nicht verhehlen, dass die jungen Freiwilligen berufsorientierende Merkmale auf ihren Zeugnissen für weitere Jobs, in die sie anschließend gehen wollen, haben wollen, da ist auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Unsere Befürchtung ist nur, dass, wenn Sie ein Zeugnis in Anlehnung an ein Arbeitszeugnis gestalten, dass dann auch Klagemöglichkeiten da sind, und dass sich dann - die Freiwilligen und die Einsatzstellen, die Träger - vor dem Arbeitsgericht wiederfinden, wenn die Freiwilligen mit dem Zeugnis nicht zufrieden sind.
Vorsitzende: Herr Kohler, bitte. Das war auch die Frage von Herrn Dzewas.
SV Walter Kohler: Die Frage mit dem Sozialguthaben ist natürlich zu sehen in unserem Gesamtprogramm, das wir vorschlagen für die Entwicklung der Freiwilligendienste und insgesamt der Dienste für die Allgemeinheit. Es ist denkbar, und da bin ich jetzt im Moment nicht ganz sicher, dass die derzeitige Wehrverfassung hier Probleme machen würde. Aber, wenn man nur an der derzeitigen Rechtslage festhalten würde, dann kommen wir natürlich hier nie zu einer Veränderung. Sinnvoll ist es aber sicherlich, dass in dem Moment, wo wir jetzt schon ein Stück weit weg gehen beim Zivildienst, dass wir sagen: Es kann auch ein besonders strukturierter freiwilliger sozialer Dienst sein, von dem wir auf der anderen Seite aber auch wieder sagen, alle unsere freiwilligen sozialen Dienste sind in einer ähnlichen Struktur, wie das, was vom Zivildienst verlangt wird, denn auch da spielen natürlich irgend welche Bildungsüberlegungen mit eine Rolle. Dass man dann sagt, und dann wollen wir doch auch tatsächlich erreichen, dass beide Dinge, die im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres geleistet werden, dass diese gleichwertig anzusehen sind. Und mit Blick auf eine Anforderung an alle Bürgerinnen und Bürger ein Beitrag in die gesellschaftliche Gemeinschaft hinein-zugehen, macht es sicherlich einen Sinn, dass man sagt: Und dann sollen diese Beiträge gleichwertig sein, egal, wann sie geleistet werden, ob sie nun vor dem 17. Lebensjahr oder vor dem 16,5. Lebensjahr geleistet werden, oder danach.
Vorsitzende: Vielen Dank. Herr Fischer, bitte auf die Frage von Frau Balt.Und am Ende dann Herr Steinmeyer auf die Fragen von Frau Lenke und Frau Balt.
SV Jörn Fischer: Zur Frage der pädagogischen Begleitung: Auch aus Sicht der Freiwilligen sollten Seminare integraler Bestandteil eines Freiwilligendienstes sein. Trotzdem wundert es uns immer doch, wie viel Wert tatsächlich von Seiten der Träger und auch der entsprechenden Politiker auf die Seminare und die pädagogische Begleitung gelegt wird, weil aus unserer Sicht ist es so, dass sich der Lerneffekt letztendlich nicht aus einer bestimmten Anzahl von Bildungstagen, sondern vielmehr durch das Leben und Arbeiten - sei es im Ausland oder auch im Inland - in der täglichen Arbeit ergeben. Diese Lerneffekte können durch Seminare mit Sicherheit noch verstärkt und gefestigt werden. Als früherer Teilnehmer und heute auch manchmal Leiter von Seminaren möchte ich darauf hinweisen, dass für viele Teilnehmer allein die Tatsache, dass sich auf solchen Seminaren die anderen Freiwilligen in der gleichen Situation begegnen, dass da ein Austausch stattfinden kann, dass das eigentlich auch ein ganz zentraler Aspekt dieser Seminare ist, egal in welcher Form diese stattfinden. Noch auf die Dauer eingehend, ich denke, 25 Tage sind im Gesetz festgeschrieben - das ist in Ordnung, aber viel mehr muss es dann auch nicht sein.
Vorsitzende: Vielen Dank. Herr Professor Steinmeyer, bitte auf die Fragen von Frau Lenke und Frau Balt.
SV Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer: Ich nehme die Chance wahr, auf beide Fragen gleichzeitig zu antworten. Wir müssen uns da zunächst einmal einigen, es gibt da eine politische Grundsatzfrage, die ich nicht beantworten möchte, nämlich die Frage der hohen Sozialversicherungs-beiträge. Das ist etwas, worüber man lange diskutieren kann. Darum geht es mir hier nicht, das kann ich nicht beantworten. Ich muss auch sagen, mein Glaubens-bekenntnis geht dahin, wenn man im Inland die Leute in die Sozialversicherungen hinein nimmt, dann muss man es im Ausland genau so machen. Das gebe ich ja zu, das ist vielleicht eine politische Aussage. Aber daran lässt sich nichts ändern. Es gibt keine anderen Systeme, wo man im Inland sagt, sozialversichert und wenn man ins Ausland geht, nicht mehr sozialversichert. Ich kenne das nicht. Das zweite ist, man kann natürlich im inländischen Recht beispielsweise die Rentenversicherung raus streichen. Das kann man machen, das muss man nur wollen, aber das ist eine Frage, die mit dem Gesetzentwurf hier jetzt nichts zu tun hat. Und die andere Frage, man kann es natürlich bis zu 24 Monaten verlängern. Ob sich das widerspricht, das ist juristisch nun eine heikle Frage. Aber, wenn Sie es auf 24 Monate verlängern, dann haben Sie schlicht das Ergebnis, dass sofort das ausländische System eingreift, vom ersten Tag an. Und das mag teurer sein, das mag auch keinen Schutz gewährleisten, das Risiko müssen Sie dann eingehen. Das ist die Konsequenz daraus. Wenn Sie halbwegs das sicher stellen wollen, dass es weiter geht, wie es bei den deutschen Diensten ist, dann müssen Sie den anderen Weg beschreiten.
Vorsitzende: Vielen Dank, im Moment gibt es von Seiten der Abgeordneten keine Fragen mehr. Es gibt dann sicherlich noch Fragen, wenn wir sitzen, und es wird jetzt unsere Aufgabe sein, das Protokoll in den Fraktionen auszuwerten, welche Antworten wir bekommen haben, wo Änderungen möglich sind. Ganz am Anfang wurde von Herrn Fischer gesagt, er sieht keine Chance mehr, dass hier noch Änderungen sind, aber dafür sind Anhörungen da, dass dann auch geschaut wird, wo kann noch etwas geändert werden. Das bewegt sich manchmal im engen Rahmen, das gestehe ich Ihnen schon zu, aber in der Regel ist es so , dass ein Gesetz das Parlament nicht so verlässt, wie es ins Parlament hineingekommen ist.
An die Sachverständigen ein herzliches Dankeschön, den Abgeordneten auch und vor allem auch den Frauen und jungen Männern, die - wenn ich das richtig sehe ? hier sind, die ein freiwilliges soziales Jahr oder ökologisches Jahr machen. Sie haben sich das angehört, oder z.T. auch angetan, denn wenn man die ganze Zeit ruhig oben sitzen muss und zuhört, ist das auch nicht so einfach. Ich möchte noch einen Satz los werden. Die sich leerenden Plätze bei den Abgeordneten haben nichts damit zu tun, dass sie jetzt essen oder spazieren sind, es hat um 13.00 Uhr schon wieder das Plenum begonnen, und eigentlich haben wir eine Ausnahmeregelung, dass wir bis jetzt hier überhaupt tagen durften, weil eigentlich um 13.00 Uhr Schluss sein muss, damit wir Abgeordneten die Chance haben, ins Plenum zu gehen bzw. zu anderen Anhörungen und Veranstaltungen, die jetzt parallel dazu laufen. Also dort sind jetzt die Kolleginnen und Kollegen der unterschiedlichen Fraktionen. Nichts desto trotz ein herzliches Dankeschön.
Aber hier gibt es noch eine Wortmeldung eines Sachverständigen.
SV Hinrich Goos: Ich wollte mich noch kurz zum Sprecher der Bundessprecher FÖJ machen, die haben in der Kürze der Zeit auch eine Stellungnahme erarbeitet. Ich habe sie für jede Fraktion zumindest eine hier und ich gebe sie der Vorsitzenden, die sie dann bitte weiter in die Fraktionen verteilt.
Vorsitzende: Die Unterlagen werden verteilt. Nochmals vielen Dank.
Ende: ca. 13.45 Uhr
Christel Riemann-Hanewinckel, MdB
Vorsitzende