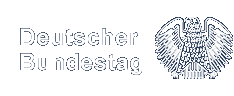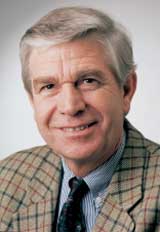|
FORUM Zukunft der LandwirtschaftÖko-Bauern – eine kleine Minderheit
Thema des Forums ist dieses Mal die seit dem Ausbruch der Rinderkrankheit BSE heftig diskutierte Zukunft der deutschen Landwirtschaft. Massentierhaltung und Mastmethoden sind in die Kritik geraten. Viele empfehlen als Ausweg den ökologischen Landbau. Doch das kann noch nicht die Lösung der aktuellen Probleme bedeuten. Denn die Ökobauern stellen bisher nur eine winzige, allerdings wachsende Minderheit dar. Von den 1999 rund 429.000 landwirtschaftlichen Betrieben mit mehr als 2 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche wirtschafteten 1998 nur rund 9.200 Betriebe auf 416.500 Hektar Fläche ökologisch nach den Bestimmungen der Öko-Verordnung. Das waren nur 1,8 Prozent der Betriebe auf etwa 2,4 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche. Immerhin vergrößerte sich gegenüber dem Vorjahr die Zahl der Betriebe um etwa 1.000 (+ 12,6 Prozent) und die ökologisch bewirtschaftete Fläche um gut 26.800 Hektar (+ 6,9 Prozent).
Inzwischen hat auch die EU die Bedeutung des ökologischen Landbaus erkannt. Eine erste Verordnung von 1991 regelt Mindeststandards des ökologischen Pflanzenbaus und gibt Rahmenvorschriften über Erzeugung, Etikettierung und Kontrollen im Ökologischen Landbau. Eine zweite Verordnung von Mitte 1999 befasst sich mit Mindeststandards für die ökologische Tierhaltung. Die Richtlinien der meisten deutschen Verbände im Öko-Landbau gehen über die europäischen Vorschriften hinaus.
Die wichtigsten Grundregeln sind: Ökologischer Landbau hat einen geschlossenen Betriebskreislauf zum Ziel. So soll das Tierfutter ganz oder überwiegend aus eigenen ökologisch erzeugten Futtermitteln bestehen. Die Felder wiederum werden vorwiegend mit betriebseigenem Dünger versehen. Durch eine vielseitige Fruchtfolge wird die Bodenfruchtbarkeit gestärkt. Auf mineralischen Stickstoffdünger und chemisch-synthetisches Pflanzenschutzmittel wird verzichtet. Auch in der Tierhaltung geht der ökologische Landbau eigene Wege. Artgerechte Tierhaltung heißt zum Beispiel, dass (mit wenigen Ausnahmen) nur Tiere aus ökologischer Züchtung aufgezogen werden dürfen. Vorgeschrieben wird ökologisch produziertes Futter, überwiegend vom eigenen Hof. Die Tiere müssen Bewegungsfreiheit mit Mindestflächen und Auslauf im Freien haben. Im Winter ist Laufstallhaltung mit Liegemöglichkeiten vorgesehen. Vorbeugende Behandlung mit chemischen Medikamenten ist verboten. Bei Erkrankungen sollen – wenn möglich – Naturheilverfahren angewendet werden. Das alles hat seinen Preis – vor allem, weil ökologischer Landbau arbeitsintensiver ist, geringere Erträge bringt und der Umfang der Tierhaltung direkt an die verfügbare Fläche gebunden ist. Hinzu kommt, dass es noch keine flächendeckende professionelle Vermarktung der Ökoprodukte gibt. Das erhöht die Preise weiter. Dennoch verdienen Ökobauern im mehrjährigen Vergleich nicht mehr als vergleichbare konventionelle Betriebe. Agenda 2000Agenda 2000 ist ein Aktionsprogramm, das darauf abzielt, die Gemeinschaftspolitik in den verschiedenen Bereichen (u.a. Agrarpolitik) wirksamer zu gestalten und einen neuen Finanzrahmen für den Zeitraum 2000-2006 festzulegen. Die Europäische Union soll damit für die bevorstehende Erweiterung gerüstet werden. Weitere Infos im Internet unter: BSEDie Abkürzung BSE steht für Bovine Spongiforme Enzephalopathie ("schwammartige Hirnerkrankung"). Diese Krankheit von Rindern äußert sich anfangs durch Verhaltensstörungen, Aggressivität, Torkeln, Einknicken und führt nach etwa sechs Monaten zum Tod. In den Gehirnen der erkrankten Tiere findet man kleine Löcher, die von abgestorbenen Nervenzellen stammen. Das Hirngewebe sieht dann unter dem Mikroskop "schwammartig" aus. Krankheitsbild und die Übertragbarkeit der Rinderseuche ähneln dabei Gehirnerkrankungen von Menschen (Creutzfeldt-Jakob-Demenz). Weitere Infos im Internet unter: Gute Produkte haben ihren Preis
Durch den Nachweis von BSE ist die Verbreitung der Rinderseuche auch in Deutschland offenbar. Dies hat zu einem tief greifenden Bewusstseinswandel geführt – sowohl über unser Ernährungsverhalten als auch über die Form der Erzeugung sowie der Be- und Verarbeitung von Nahrungsmitteln. Die Landwirtschaft erleidet durch die BSE-Seuche, die dadurch bedingten Absatzprobleme und Kostensteigerungen tief greifende Einbrüche. BSE wird für die Entwicklung der Landwirtschaft Folgen haben. Harter Wettbewerb bei der Nahrungsmittelproduktion hat den Trend zu industriellen Produktionsmethoden beschleunigt und das Ausbreiten der Seuche wie auch die vielen Lebensmittelskandale der Vergangenheit mit verursacht. Dies ist keine Frage der Größe landwirtschaftlicher Betriebe, sondern der Bedingungen, unter denen sie produzieren und unter denen Lebensmittel vermarktet und nachgefragt werden. Agrarpolitik von der Ladentheke aus denkenDie bisherige Agrarpolitik muss grundlegend überprüft und verändert werden. Belange des Verbraucher- und Umweltschutzes müssen in die gemeinsame europäische und in die nationale Agrarpolitik viel stärker als bisher integriert werden, Agrarpolitik muss von der Ladentheke aus gedacht werden. Hier sind nicht nur der Gesetzgeber und die Bundesregierung gefordert, sondern auch die Landwirte, die Ernährungsindustrie und der Handel sowie vor allem die Verbraucher selbst. Um Vertrauen beim Verbraucher zurückzugewinnen, muss Lebensmittelproduktion zuallererst Qualitätsproduktion sein, die auf einer naturnahen, ressourcenschonenden Landwirtschaft basiert, in der die natürlichen Kreisläufe wieder mehr Berücksichtigung finden und in der dem ökologischen Landbau ein höheres Gewicht als bisher zukommt. Nur eine flächengebundene Landwirtschaft, die das Futter für ihre Tiere weitgehend selbst erzeugt, braucht nicht mit industriellen Abfallprodukten unbekannter Herkunft und Zusammensetzung Produkte herzustellen, für die sie letztlich nicht geradestehen kann. Handel und Verbraucher müssen diese Umkehr unterstützen. Ein überschaubares System von geschützten Qualitätssiegeln und Herkunftsbezeichnungen zur Stärkung der regionalen Identität mit klaren, nachvollziehbaren Anforderungen an eine umwelt- und naturverträgliche Produktionsweise, an eine artgerechte und flächengebundene Tierhaltung, an die Zusammensetzung der Lebensmittel und ihrer Behandlung sind daher Voraussetzung für einen bewussten Einkauf der Verbraucher. Allerdings ist auch klar: Gute Produkte haben ihren Preis. In der EU wurde die Kurskorrektur eingeleitetMit der Agenda 2000 wurde bereits eine Kurskorrektur in der EU-Agrarpolitik eingeleitet. Wesentliche Elemente sind die Rückführung produktbezogener Subventionen, vor allem aber auch die stärkere Verknüpfung von Ausgleichszahlungen für die Landwirtschaft mit Umwelt- und sozialen Kriterien sowie die Umschichtung von EU-Mitteln aus dem Marktbereich in die Bereiche ländlicher Entwicklung und Umwelt. Die bestehenden Gestaltungsspielräume müssen genutzt und durch weitere Reformen erweitert werden. Neben der Nahrungsmittelproduktion werden Dienstleistungen für den ländlichen Raum, wie etwa die Honorierung von Leistungen im Umweltschutz und in der Landschaftspflege, bei der Erzeugung regenerativer Energien sowie im sanften Tourismus, eine höhere Bedeutung erlangen. Nur so werden Perspektiven für die Landwirtschaft eröffnet und Landwirte ein ausreichendes Einkommen erzielen. Der Weg dahin ist noch weit, aber schaffbar. Landwirte nicht an den Pranger stellen
Die Auswirkungen der BSE-Krise verunsichern die Verbraucher und bedrohen Landwirte in ihrer Existenz. Auch wir haben uns in der Vergangenheit zu lange der Illusion hingegeben, Deutschland sei frei von BSE. In dieser Situation muss Verbraucherschutz absolute Priorität haben. In der jetzigen Situation ist es denkbar falsch, wenn die rot-grüne Bundesregierung die Landwirte an den Pranger stellt und einen Sündenbock sucht. Die Landwirte arbeiten nach festgelegten Standards, die in den letzten Jahren kontinuierlich weiter entwickelt wurden und auch in Zukunft weiter entwickelt werden müssen. Sie erbringen unverzichtbare Leistungen für die Erzeugung von Nahrungsmitteln und Rohstoffen, die Entwicklung der ländlichen Räume, die Erhaltung der Kulturlandschaft und den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Bündnis von Verbrauchern, Landwirten und WissenschaftStatt also wie Bundeskanzler Schröder mit dem bewusst unklaren Begriff der "Agrarfabriken" ein neues Feindbild aufzubauen, brauchen wir ein Bündnis von Verbrauchern, Landwirten und Wissenschaftlern. Nur so kann die Bekämpfung der BSE-Seuche tatsächlich wirkungsvoll angegangen werden. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Politik die Landwirte sowie die der Landwirtschaft vor- und nachgelagerten Bereiche in dem notwendigen Veränderungsprozess nicht alleine lässt. Eine zukunftsfähige Landwirtschaft darf und kann nicht gegen die Landwirte durchgesetzt werden, sondern muss mit ihnen erfolgen. Dabei sind die Auswirkungen auf den ländlichen Raum zu berücksichtigen. Gezielte Maßnahmen als wirksamer VerbraucherschutzDie CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert ein Programm gegen BSE:
Krise bietet Chance zur Umgestaltung
Die BSE-Krise hat überdeutlich gezeigt, dass die Agrarpolitik der vergangenen Jahrzehnte den notwendigen Wandel in eine moderne Gesellschaft nicht vollzogen hat. Sie hat die Landwirte in eine unsinnige und gefährliche Massenproduktion von Lebensmitteln zu immer niedrigeren Preisen gezwungen – bei gleichzeitig steigenden staatlichen Aufwendungen – und richtet heute mehr volkswirtschaftlichen Schaden als Nutzen an. Die heutige Lebensmittelproduktion genießt beim Verbraucher kein Vertrauen mehr. Bündnis 90/Die Grünen halten es für erforderlich, die gesamte Landwirtschaftspolitik neu zu orientieren. Die Bundestagsfraktion hat dazu erste Eckpunkte beschlossen. Antibiotika im Tierfutter umgehend verbietenDie Lebensmittelerzeugung muss das Vorsorgeprinzip konsequent in den Vordergrund stellen. Die Verbraucher müssen sicher auf die Qualität und die gesundheitliche Unbedenklichkeit landwirtschaftlicher Produkte vertrauen können. Einige besonders gefährliche Praktiken, wie die Gewinnung von Separatorenfleisch oder die Beimischung von Antibiotika als Leistungsförderer zum Tierfutter gehören umgehend verboten. Der Verbraucherschutz muss gestärkt, besser ausgestattet sowie schlagkräftiger organisiert werden. Regionale Vermarktung soll stärker gefördert werden. Von zentraler Bedeutung ist, dass für die Verbraucher Transparenz hergestellt wird. Wir schlagen daher vor, dass es zwei staatlich kontrollierte Siegel gibt: Ein leicht erkennbares, bundesweit einzuführendes Öko-Qualitätssiegel für ökologischen Landbau nach den Anbaurichtlinien der EU. Ein Qualitätssiegel für eine Lebensmittelproduktion, das die Einhaltung neu definierter Mindeststandards für eine umwelt- und verbrauchergerechte Landwirtschaft garantiert. Dazu gehören: umwelt- und naturschonende Produktionsweise, artgerechte und flächengebundene Tierhaltung, Standards für und klare Kennzeichnung von Futtermitteln, lückenlose Herkunfts- und Inhaltskennzeichnung für Fleisch und alle Fleischprodukte vom Stall bis zur Ladentheke, Verzicht auf den Einsatz von Gentechnik. Produktion und Vermarktung von Ökoprodukten fördernDie Agrarförderung soll gezielt neu ausgerichtet und umgewidmet werden, damit die Wettbewerbsbedingungen für Landwirte verbessert werden, die auf verbraucher- und umweltorientierte Qualitätsprodukte setzen. In der Praxis heißt das: Fördermittel der EU und des Bundes werden an die Einhaltung von Kriterien des Verbraucher-, Umwelt- und Tierschutzes sowie an Arbeitsplätze gebunden. Die EU-Verordnung "Ländlicher Raum" soll zum zentralen Element der EU-Agrarpolitik mit der Ausrichtung auf ökologischen Landbau, regionale Vermarktung, Vertragsnaturschutz und Bodenerosionsschutz ausgebaut werden. Der ökologische Landbau ist unser Leitbild für eine moderne, zukunftsfähige Landwirtschaft, weil er die Erzeugung gesunder Lebensmittel mit dem Schutz der natürlichen Ressourcen und tiergerechten Haltungsformen verbindet. Der Anteil des ökologischen Landbaus an der landwirtschaftlichen Produktion in Deutschland muss massiv erhöht werden. Die zentrale Rolle kommt dabei der Marktnachfrage zu. Deshalb sollen Bund und Länder besonderes Gewicht auf bessere Vermarktung von Öko-Produkten und auf eine breit angelegte Imagekampagne legen. Allein im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz sollten zur Förderung des ökologischen Landbaus zweckgebunden 500 Millionen DM bis 2005 zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Ökologischer Landbau allein ist kein Schutz
Eine in die Zukunft orientierte Agrarpolitik muss einen umfassenden Verbraucherschutz beinhalten. Durch die BSE-Krise wurde das Vertrauen der Verbraucher in landwirtschaftliche Produkte schwer erschüttert. Da die konventionelle Landwirtschaft jedoch nicht die Ursache für diese Krise ist, ist eine völlige Abkehr der Politik von fast 98 Prozent unserer Landwirte fachlich nicht gerechtfertigt. Die Forderung nach einem Ende "der industriellen Landwirtschaft" ist falsch: Eine Politik, die allein den ökologischen Landbau fördert, kann den Schutz der Verbraucher nicht gewährleisten. Das Nahziel der Agrarpolitik muss das erschütterte Vertrauen der Bürger durch breite Information über die Ursachen von BSE wiederherstellen. Dazu ist ein ganzes Bündel von nationalen und europaweiten Sofortmaßnahmen notwendig. Bessere Kontrolle durch Herkunfts- und QualitätszeichenNeben der konventionellen Landwirtschaft, die nach wie vor die größte Bedeutung hat, steigt der Einfluss von regionalen Qualitätszeichen. Die Nähe zwischen Landwirt und Verbraucher wird durch ein neues Qualitätsverständnis gestärkt. Die Chancen für die heimische Landwirtschaft, das Fleischerhandwerk, die Ernährungswirtschaft und Gastronomie müssen durch regionale Herkunftszeichen, wie das Herkunfts- und Qualitätszeichen in Baden-Württemberg (HQZ), genutzt und ausgebaut werden. Die Politik hat Möglichkeiten, die regionale Vermarktung zusätzlich zu fördern und so die Zukunft der Landwirte zu sichern. Der ökologische Landbau, der für die F.D.P. einen wichtigen Beitrag in der Angebotspalette für Nahrungsmittel leistet, ist unter der derzeitigen Sensibilisierung der Verbraucher weiter zu stärken. Jedoch darf diese Förderung nicht in die Produktion gehen, sondern in die Verbesserung der Produktionsstruktur und in die Vermarktung. Eine steigende Nachfrage und Zahlungsbereitschaft der Verbraucher hat auch eine Stärkung und Ausweitung des ökologischen Landbaus zur Folge. Eine einseitige Subventionierung ökologischer Produkte dagegen vergrößert die Wettbewerbsverzerrungen und gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft insgesamt. Die Landwirtschaft und auch die Agrarpolitik in Deutschland ist eingebunden in die Landwirtschaft und Agrarpolitik der EU. Der offene Binnenmarkt und die Verpflichtungen der Welthandelsorganisation erfordern eine international wettbewerbsfähige Landwirtschaft. Die Subvention von landwirtschaftlichen Produkten sowie dirigistische Markteingriffe müssen mittelfristig abgebaut werden. Vielfalt in der Landwirtschaft muss erhalten bleibenDer Landwirt sollte für seine gesellschaftlichen Leistungen, wie z.B. die Erhaltung unserer Kulturlandschaft und seinen Beitrag zur Stabilisierung der ländlichen Räume, ein entsprechendes Honorar erhalten. Diese Leistungen, die die Gesellschaft bisher als öffentliche Güter wahrnimmt, brauchen die finanzielle Anerkennung der Verbraucher und des Staates. Hierfür muss die zweite Säule der Agenda 2000 gestärkt werden, die umwelt- und landschaftspflegerische Maßnahmen berücksichtigt. Parallel dazu sind Programme der Länder, wie das Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsprogramm in Baden-Württemberg, die besonders Umwelt- und Kulturleistungen beinhalten, einzurichten und auszubauen. Die F.D.P. misst dem Vertragsnaturschutz eine entscheidende Bedeutung zu. Die Zukunft der Landwirtschaft liegt in ihrer Vielfalt. Ein gleichberechtigtes Nebeneinander von konventionellen und ökologischen, von kleinen und großen Betrieben kann dem Verbraucher auch eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Produkten anbieten. Krise ist nicht Schuld der Bauern
Was für ein Schock: Rinderwahn auch bei "Milka"-Kühen. Urplötzlich stimmt nichts mehr am offiziell gepflegten Bild von der heilen deutschen Landwirtschaft. Durch das Auftreten von BSE wurde auch einer breiten Öffentlichkeit klar: Die Landwirtschaft steckt in einer tiefen Krise. Und das nicht erst seit heute. Der jetzt beschworene Neuanfang ist überfällig. Die Krise ist nicht Schuld der Bauern. Diese befinden sich im festen Zangengriff der Agrochemie-, Futtermittel- und Landmaschinenindustrie sowie Großhandelsketten und Banken. Seit Jahrzehnten bestimmen deren Kapitalverwertungsinteressen die Art und Weise der Agrarproduktion und deren Entwicklung. Der auf den Landwirten lastende Wettbewerbsdruck, der durch Globalisierung und Liberalisierung verschärft wird, hat eine Intensivierung und Rationalisierung befördert, die zu den bekannten Umweltproblemen geführt hat. Wie die Lebensmittelskandale zeigen, ist der Kunde zwar König, aber längst nicht der Souverän. Er hat bisher kaum Einfluss noch Einsicht, was die Lebensmittel beinhalten. Über Billigpreise wird Kaufverhalten manipuliert. Natur und Gesundheit nicht dem Profit opfernGesellschaftlicher Konsens sollte sein, dass eine Agrarpolitik, die das Prädikat "neu" verdient, Bedingungen zu schaffen hat, dass die Bauern im Einklang mit der Natur wirtschaften können. Es geht um eine Landwirtschaft von ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Nachhaltigkeit, auch im Interesse der ländlichen Räume. Ohne Abkehr von der neoliberalen Politik ist das nicht machbar; der Allmacht des Marktes sind staatliche Schranken zu setzen. Profite auf Kosten von Umwelt, Natur und Gesundheit gilt es gesellschaftlich zu ächten. Infolge der fortschreitend liberalisierten Agrarmärkte bedarf es hierfür auch internationaler Regelungen. Kernaufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die gesamte Landwirtschaft umwelt- und gesundheitsgerechter produzieren kann. Das betrifft zuerst die konventionell produzierenden Betriebe, denn aus ihnen kommt derzeit die große Masse der Erzeugnisse. Zugleich ist die angestrebte vorrangige Entwicklung des ökologischen Landbaus zu bewerkstelligten. Modernisierung im Einklang mit Natur und UmweltWarnen möchte ich vor einem Neuanfang, der von nostalgischen Idealen geprägt wird. Ein Zurück zur Landwirtschaft der Großmütter und -väter würde ins Abseits führen. Eine Landwirtschaft ist nur zukunftsträchtig, wenn sie sich auf moderne Technologien, wissenschaftliche Grundlagen, gläserne Produktion und durchgängiges Qualitätsmanagement stützt, sich von der allgemeinen Entwicklung nicht abkoppelt. Der Schlüssel heißt Modernisierung in Einklang mit Natur und Umwelt. Das gilt für den konventionellen Landwirt wie für den Biobauern. Wichtig für die Zukunft der Landwirtschaft ist, dass sie nicht länger als ein Bereich mit geringer und abnehmender Wertschöpfung angesehen wird, der dazu noch erhebliche Subventionen verschlingt. Dem Agrarwirtschaftsbereich gebührt eine wachsende Rolle beim unabdingbaren sozialökologischen Umbau der Gesellschaft: als Basis für eine hochwertige und gesunde Ernährung, zur Gewinnung nachwachsender Rohstoffe und erneuerbarer Energien, bei der Reproduktion der Naturressourcen Boden, Wasser, Luft und Artenvielfalt sowie der Kulturlandschaften und der Sicherung und Neuschaffung von Arbeitsplätzen auf dem Lande. Die Agrarpolitik der heutigen und erst recht der künftig größeren EU muss deshalb weitaus stärker auf die Regionalisierung ausgerichtet werden. Gelingt das nicht, drohen weitere Verwerfungen. |