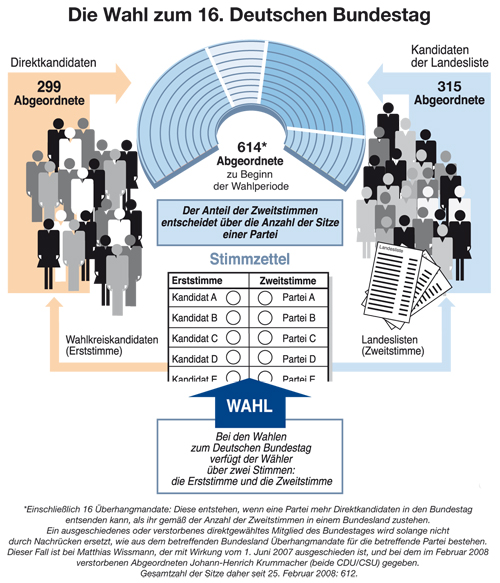Kandidatenkür und Bundestagswahl
Wie wird man Abgeordneter?
Abgeordneter — das ist ein oft sehr schwerer Job. Aber noch viel schwerer kann es sein, Abgeordneter zu werden. Das zeigen zwei Zahlen aus dem letzten Wahlkampf: Für die 598 Bundestagsmandate gab es offiziell 3.648 Kandidaten. Und für diese Kandidaturen hatte es zuvor noch weit mehr Bewerber gegeben.
Ein Parlament kann in einer Demokratie
grundsätzlich nach zwei verschiedenen Verfahren zu einer
repräsentativen Volksvertretung werden.
Entweder: Die Wähler bestimmen in ihrer jeweiligen regionalen
Umgebung, welcher der regionalen Bewerber ihre Interessen im
Parlament vertreten soll. Wer vor Ort die meisten Stimmen
erhält, ist gewählt. Das heißt
Mehrheitswahlrecht.
Oder: Die Wähler entscheiden sich für eine Partei mit
einer Vielzahl aufgelisteter Kandidaten. Je nach Stimmenanteil
ziehen von den einzelnen mal mehr, mal weniger Kandidaten ins
Parlament ein. Das heißt Verhältniswahlrecht.
Deutschland hat sich für eine Kombination entschieden, eine
personalisierte Verhältniswahl. Jeder Wähler hat zwei
Stimmen. Die Hälfte der 598 Sitze wird nach dem
Mehrheitswahlrecht mit der Erststimme vergeben. Über die
grundsätzliche Stärke der Parteien entscheidet der
Wähler nach dem Verhältniswahlrecht mit der Zweitstimme,
wobei jedoch eine Sperrklausel gilt: Parteien, auf die weniger als
fünf Prozent der Stimmen entfallen, werden nicht
berücksichtigt.
Eine Demokratie muss grundsätzlich jedem die Möglichkeit
eröffnen, andere zu vertreten. Es gibt nur einige wenige
Bedingungen: Der Bewerber für den Bundestag muss
volljährig und Deutscher sein, 200 Unterschriften von
Unterstützern vorlegen, bestimmte Formen und Fristen bei der
Anmeldung einhalten. Das reicht. Dann steht sein Name auf dem
Stimmzettel. Und er kann mit der Erststimme gewählt werden.
Sein Arbeitgeber hat ihn auf Verlangen bis zu zwei Monate vor der
Wahl freizustellen (ohne Anspruch auf Bezüge) und darf ihn
wegen der Bewerbung nicht benachteiligen.
Aber ob dieser Einzelbewerber damit auch Chancen auf den Einzug in
den Bundestag hat, steht auf einem anderen Blatt. Denn die einfache
Mehrheit in einem Wahlbezirk, das können je nach
Wahlbeteiligung schnell 40.000 Stimmen sein, oft auch 50.000,
60.000 oder mehr. 200 Unterstützer mögen noch
überzeugt werden können. Aber die vielfache Menge an
Menschen für sich zu gewinnen — das ist ohne
professionelle Unterstützung durch eine erfahrene Organisation
kaum hinzukriegen.
Deshalb führt der aussichtsreichere Weg in den Bundestag
über eine Parteikandidatur. Doch in eine Partei einzutreten,
den Mitgliedsbeitrag zu zahlen und dann zu sagen: „Hallo,
bringt mich in den Bundestag”, das dürfte auf die
anderen Parteimitglieder etwas vermessen wirken. Zumeist steht am
Anfang die „Ochsentour”. Die unermüdliche Arbeit
vor Ort, das Mitwirken in den verschiedenen Gremien, die
allmähliche Profilierung, so dass die Parteimitglieder den
Eindruck gewinnen, mit diesem Bewerber im Wettstreit der Parteien
punkten zu können. Nicht von ungefähr haben viele
Bundestagsabgeordnete ihre ersten Erfahrungen als Volksvertreter in
den Stadt- und Gemeinderäten gesammelt, sich dort bewährt
und so für „Höheres” qualifiziert.
Der Gewinn des Direktmandats im Wahlkreis ist oft eine knappe
Angelegenheit, manchmal entscheiden wenige hundert Stimmen. Deshalb
sind auch die Direktkandidaten interessiert daran, ihre Bewerbung
„abzusichern”. Sprich: Parallel auch auf derLandesliste
ihrer Partei anzutreten. Wer in einem sogenannten
„sicheren” Wahlkreis antritt, also in einer Region, in
der bei den vorangegangenen Wahlen die Bewerber seiner Partei mit
großem Abstand gewonnen haben, der wird wenig Anspruch auf
eine zusätzliche „Absicherung” haben. Es sei denn,
er ist ein prominentes „Aushängeschild” für
die ganze Partei. Und auch die Kandidaten aus
„unsicheren” Wahlkreisen sowie diejenigen, die sich
allein um einen Listenplatz, nicht um einen Direktwahlkreis
bemühen, müssen durch ein Nadelöhr. Das heißt
„Landesparteitag” oder
„Landesdelegiertenversammlung”, besteht aus den
innerparteilichen Vertretern aus allen Regionen des jeweiligen
Bundeslandes und beschließt die Platzierungen auf der Liste.
Vorschläge vom jeweiligen Parteivorstand können
vorbestimmend sein, sind aber nicht davor gefeit, von den
Delegierten kräftig durcheinandergewirbelt zu werden. Da
entscheidet oft auch die „Tagesform”, in der sich die
Bewerber in kurzen Vorstellungsreden dem Parteitag empfehlen.
Natürlich haben auch bei der Wahl für die Landeslisten
diejenigen Bewerber die besten Chancen, denen am ehesten zugetraut
wird, im politischen Wettbewerb besonders erfolgreich zu sein.
Gleichzeitig achten die Parteigremien aber auch darauf, dass die
Liste die Regionen gerecht berücksichtigt und unter anderem
auch die Anzahl von männlichen und weiblichen Kandidaten in
einem vernünftigen Verhältnis steht. Immer wieder
bemühen sich die Parteien auch, „Quereinsteigern”
bei der Listenaufstellung eine Chance zu geben, also
Persönlichkeiten, von denen man erfolgreiche parlamentarische
Arbeit erwartet, die aber keine „Ochsentour” absolviert
haben.
Und wer zieht dann in den Bundestag ein? Am Wahlabend werden
zunächst die Zweitstimmen gezählt, die für das
Kräfteverhältnis der Parteien im neuen Parlament
ausschlaggebend sind. Daraus ergibt sich die Anzahl der Kandidaten,
die aus den einzelnen Bundesländern von den verschiedenen
Parteien in den Bundestag kommen. Die im Wahlkreis mit der
Erststimme Erfolgreichen sind auf jeden Fall gewählt. Ihre
Zahl wird gesondert für jedes Bundesland von der Zahl der dort
auf die jeweilige Partei nach dem Zweitstimmenanteil entfallenden
Mandate abgezogen. Bleiben dann beispielsweise noch fünf
Mandate übrig, sind die Bewerber auf den ersten fünf
Listenplätzen gewählt. Steht auf diesen fünf
Plätzen der Name eines Kandidaten, der bereits im Wahlkreis
erfolgreich war, „zieht” die Liste einen Platz weiter.
Dann ist auch der Sechstplatzierte gewählt. Aber auch Bewerber
auf den weiteren Plätzen können hoffen. Wenn ein
gewählter Abgeordneter aus ihrer Partei und ihrem Bundesland
im Verlauf der Wahlperiode ausscheidet, rückt der Nächste
von der Liste nach und wird Abgeordneter.
Eine Ausnahme gilt bei Überhangmandaten. Die kommen zustande,
wenn in einem Bundesland von einer Partei mehr Kandidaten per
Erststimme direkt gewählt worden sind, als der Partei nach
ihrem Zweitstimmenanteil zustehen. Die Überhangmandate
erhöhen die Gesamtzahl der Sitze im Bundestag. Ausscheidende
Überhangmandate können nicht mit einem Nachrücker
von der Landesliste neu besetzt werden.
Die Wahl begründet das Verhältnis zwischen Bürgern und Abgeordneten — sie ist der entscheidende Akt der Legitimation. Inwieweit das bestehende Wahlsystem den Parteien zu große Macht bei der Kandidatenauswahl im Rahmen der Listenaufstellung einräumt, wird immer wieder diskutiert. Bei einigen Regionalwahlen können die Wähler mehr Einfluss auf die Listenplatzierungen nehmen. In Frankfurt etwa hat jeder Wähler 93 Stimmen, die er auf die verschiedenen Listen verteilen kann (Panaschieren) und von denen er einige auf einzelne Kandidaten konzentrieren kann (Kumulieren). Gegen eine Übertragung auf die Bundestagswahl wird angeführt, dass die Stimmzettel riesige Ausmaße annähmen. Und es entstünde die Frage, ob die Wähler sich ein Bild von allen Listenkandidaten machen können.
« Vorheriger Artikel Nächster Artikel »
Text: Gregor Mayntz
Aktualisiert am 7. Juli 2008

Aktuelle Ausgabe
Die aktuelle Ausgabe von BLICKPUNKT BUNDESTAG können Sie hier als PDF-Datei öffnen oder herunterladen.
» PDF-Datei

Aktuelle Ausgabe SPEZIAL
Die aktuelle Ausgabe von BLICKPUNKT BUNDESTAG SPEZIAL können Sie hier als PDF-Datei öffnen oder herunterladen.
» PDF-Datei
Mitmischen
Mitmischen.de ist das Jugendforum des Deutschen Bundestages im Internet mit Chats, Diskussionsforen, Abstimmungen, Nachrichten und Hintergrund-
berichten.
» Zur Website
Europa
Europa ist überall — Europäische Gesetze regeln den Alltag, Euro-Münzen klimpern im Portemonnai. Aber was bedeutet es eigentlich, zu Europa zu gehören? GLASKLAR hat sich in Europa umgesehen.
» Zur Website