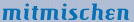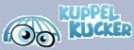183. Sitzung
Berlin, Donnerstag, den 16. Oktober 2008
Beginn: 9.01 Uhr
* * * * * * * * V O R A B - V E R Ö F F E N T L I C H U N G * * * * * * * *
* * * * * DER NACH § 117 GOBT AUTORISIERTEN FASSUNG * * * * *
* * * * * * * * VOR DER ENDGÜLTIGEN DRUCKLEGUNG * * * * * * * *
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nehmen Sie bitte Platz. Die Sitzung ist eröffnet.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle herzlich und darf, wie häufig vor Eintritt in unsere Tagesordnung, einige wenige Hinweise geben.
Wir haben interfraktionell vereinbart, die verbundene Tagesordnung um die in der Zusatzpunktliste aufgeführten Punkte zu erweitern:
ZP 1 Abgabe einer Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin
ZP 2 Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU und der SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes (Finanzmarktstabilisierungsgesetz - FMStG)
- Drucksache 16/10600 -
Überweisungsvorschlag:
Haushaltsausschuss (f)
Rechtsausschuss
Finanzausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
(ZP 1 und 2 siehe 182. Sitzung)
ZP 3 Beratung des Antrags der Abgeordneten Renate Künast, Bärbel Höhn, Hans-Josef Fell, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Energiesparen für alle - Kosten senken, Klima schützen
- Drucksache 16/10585 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie (f)
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(f)
Rechtsausschuss
Finanzausschuss
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Haushaltsausschuss
Federführung strittig
ZP 4 Weitere Überweisungen im vereinfachten Verfahren
(Ergänzung zu TOP 39)
a) Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes
- Drucksache 16/10175 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (f)
Rechtsausschuss
b) Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Weingesetzes
- Drucksache 16/10552 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
c) Erste Beratung des von den Abgeordneten Jerzy Montag, Volker Beck (Köln), Kai Gehring, weiteren Abgeordneten und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur ? Änderung des Urheberrechtsgesetzes
- Drucksache 16/10566 -
Überweisungsvorschlag:
Rechtsausschuss (f)
Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung
Ausschuss für Kultur und Medien
d) Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU und der SPD eingebrachten Entwurfs eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes
- Drucksache 16/10569 -
Überweisungsvorschlag:
Rechtsausschuss (f)
Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung
Ausschuss für Kultur und Medien
e) Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU und der SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Entlastung der Rechtspflege
- Drucksache 16/10570 -
Überweisungsvorschlag:
Rechtsausschuss
f) Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU und der SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung ?Deutsches Historisches Museum?
- Drucksache 16/10571 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Kultur und Medien (f)
Auswärtiger Ausschuss
Innenausschuss
Rechtsausschuss
Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung
Ausschuss für Tourismus
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen
Union
Haushaltsausschuss
g) Erste Beratung des von den Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung der Strafprozessordnung - Erweiterung des Beschlagnahmeschutzes bei Abgeordneten
- Drucksache 16/10572 -
Überweisungsvorschlag:
Rechtsausschuss (f)
Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und
Geschäftsordnung
h) Beratung des Antrags der Abgeordneten Renate Blank, Dirk Fischer (Hamburg), Dr. Klaus W. Lippold, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU
sowie der Abgeordneten Annette Faße, Sören Bartol, Uwe Beckmeyer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD
Infrastruktur und Marketing für den Wassertourismus in Deutschland verbessern
- Drucksache 16/10593 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (f)
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Ausschuss für Tourismus
Haushaltsausschuss
ZP 5 Beratung des Antrags der Abgeordneten Frank Schäffler, Dr. Hermann Otto Solms, Carl-Ludwig Thiele, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
Mitarbeiterbeteiligung - Eigenverantwortliche Vorsorge stärken
- Drucksache 16/9337 -
Überweisungsvorschlag:
Finanzausschuss (f)
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Arbeit und Soziales
ZP 6 Beratung des Antrags der Abgeordneten Hans-Josef Fell, Kerstin Andreae, Bärbel Höhn, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stromnetze zukunftsfähig ausbauen
- Drucksache 16/10590 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie (f)
Rechtsausschuss
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
ZP 7 Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU und der SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes (Finanzmarktstabilisierungsgesetz - FMStG)
- Drucksache 16/10600 -
Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)
- Drucksache 16/... -
Berichterstattung:
Abgeordnete ...
Von der Frist für den Beginn der Beratungen soll, soweit erforderlich, abgewichen werden.
Die Tagesordnungspunkte 18, 19, 32, 33 und 40 h werden abgesetzt und in der Folge die Tagesordnungspunkte 34 und 35 getauscht.
Außerdem mache ich auf zwei nachträgliche Ausschussüberweisungen im Anhang zur Zusatzpunktliste aufmerksam:
Die in der 179. Sitzung des Deutschen Bundestages überwiesenen nachfolgenden Gesetzentwürfe sollen zusätzlich dem Rechtsausschuss (6. Ausschuss) zur Mitberatung überwiesen werden.
Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen
- Drucksache 16/10289 -
überwiesen:
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f)
Rechtsausschuss
Ausschuss
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Energieeinsparungsgesetzes
- Drucksachen 16/10290, 16/10331 -
überwiesen:
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (f)
Rechtsausschuss
Ausschuss
für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Ich vermute, dass Sie mit diesen Änderungen einverstanden sind. - Das ist offensichtlich der Fall. Dann ist das so beschlossen.
Dann rufe ich die Tagesordnungspunkte 3 a und 3 b auf:
a) Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG)
- Drucksache 16/10486 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f)
Rechtsausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
b) Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen
- Drucksache 16/10485 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f)
Rechtsausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 90 Minuten vorgesehen. - Ich höre keinen Widerspruch. Dann haben wir das so vereinbart.
Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Bundesminister für Arbeit und Soziales, Olaf Scholz.
Olaf Scholz, Bundesminister für Arbeit und Soziales:
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Staat hat eine Rolle in wirtschaftlichen Prozessen. Wenn selbst wirtschaftsliberale Banker staatliche Interventionen loben, dann kann daran kein Zweifel bestehen. Dass es für diese Erkenntnis erst eine weltweite und tiefgreifende Kredit- und Börsenkrise geben musste, ist mehr als nur bedauerlich. Wenn daraus aber alle lernen, dass die Forderung ?Hands off!? - Staat, halte dich da heraus! - falsch ist, dann wäre wenigstens etwas gewonnen.
Denn aus der richtigen Erkenntnis, dass sich der Staat in einer Marktwirtschaft nicht in alles einmischen soll, folgt noch lange nicht der Schluss, dass er sich aus allem heraushalten soll.
Wir wissen, dass ökonomische Krisen voll auf die Legitimation unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verfassung durchschlagen. Deswegen kann der Staat nicht nach dem Prinzip des Laisser-faire danebenstehen. Ein kluger Ordnungsrahmen und manchmal auch gezielte Interventionen sind wichtig. Wenn wir aber die Akzeptanz für unsere Wirtschaftsordnung erhalten wollen, dann muss auch erkennbar sein, dass sie das liefert, was sie verspricht. Die Milliardengarantien in Richtung Finanzwirtschaft sind wichtig, um den Kollaps zu verhindern. Aber darin erschöpft sich soziale Verantwortung nicht.
Zu einer klugen Rahmung des wirtschaftlichen Geschehens gehören auch die beiden Gesetze, die wir heute beraten. Durch das Arbeitnehmer-Entsendegesetz und das Mindestarbeitsbedingungengesetz sollen überall dort Mindestlöhne ermöglicht werden, wo sie von den Sozialpartnern, aber auch von Experten und den jeweiligen Branchenvertretern für richtig gehalten werden. Mindestlöhne gehören zu einer modernen Marktwirtschaft dazu.
Ich glaube, dass wir eines ganz klar sehen sollten: Gäbe es noch heute eine Tarifbindung, wie wir sie in früheren Jahrzehnten gekannt haben, und wäre es noch heute so, dass Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände gemeinsam fast alle sozialen Bedingungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern regelten, dann würden wir heute nicht über diese Gesetze diskutieren.
Dass es zu einer Mindestlohndebatte gekommen ist, ist auch das Verdienst derjenigen, die in den letzten 25 Jahren durch alle möglichen Talkshows gezogen sind, die immer wieder gefordert haben, es müsse Schluss sein mit der Sozialpartnerschaft, die Tarifverträge für schlecht gehalten haben und die das Ende der Kompromisse verlangt haben.
Wer den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft infrage stellt, der darf sich nicht wundern, was dabei herauskommt. Wenn man es nicht der Selbstregulierung von Gewerkschaften und Arbeitgebern überlassen will, dann bekommt man den staatlichen Schutz als Ersatz dazu. Deshalb sind die Mindestlohndebatten, die wir heute führen, das Ergebnis des Handelns derjenigen, die die Sozialpartnerschaft infrage gestellt haben.
Meine Damen und Herren, wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften alleine nicht in der Lage sind, in einer Branche für stabile Verhältnisse zu sorgen, dann dürfen wir nicht danebenstehen, genauso wenig wie im Falle einer Bank, die in die Insolvenz trudelt. Hier müssen wir etwas tun und Haltelinien einziehen.
Politik ist handlungsfähig. Und ich sage: Aus der Akzeptanzkrise unserer Wirtschaftsordnung wird eine Legitimationskrise der Demokratie, wenn wir nicht bereit sind, sozial regulierend einzugreifen und das Schlimmste zu verhindern. Wir als Politikerinnen und Politiker müssen dafür sorgen, dass die Löhne nicht ins Kellergeschoss gedrückt werden.
Meine Damen und Herren, moderne Industriegesellschaften haben ausgeweitete Sektoren mit Niedriglöhnen. Aber fast alle haben Mindestlöhne als ein notwendiges Korrektiv. Sie sind keine sozialromantische Idee, sondern eine ordnungspolitische Grundlage, die für unsere soziale Marktwirtschaft unverzichtbar ist. Denn sie sollen auch verhindern, dass Unternehmen einen Wettbewerb mit Lohndumping betreiben, indem sie mit staatlichen Sozialleistungen kalkulieren.
Paul Krugman, der in diesem Jahr den Nobelpreis für Wirtschaft bekommt, hat kürzlich darauf hingewiesen, dass die Debatte über Mindestlöhne in Deutschland sinnvoll sei, und in diesem Zusammenhang von einem großen politischen Gewinn gesprochen. Recht hat er, meine Damen und Herren.
Die Mindestlohndebatte ist nicht nur volkswirtschaftlich sinnvoll, sondern sie ist auch gut für diejenigen, um die es geht. Ich will darauf hinweisen, dass es nicht in Ordnung ist, dass eine Friseurin in Sachsen Vollzeit arbeiten geht und nach der Gesellenprüfung am Ende des Monats mit 755 Euro brutto dasteht und dann zur Arbeitsagentur muss, um ihre Familie zu ernähren.
Es ist auch nicht in Ordnung, dass ein Wachmann im Revierwachdienst in Brandenburg in Vollzeit in der untersten Tarifgruppe mit unter 1 000 Euro dasteht und seine Miete nicht ohne staatliche Hilfe bezahlen kann.
Solche Löhne - und ich kann dafür viele weitere Beispiele nennen - verletzen die Ehre hart arbeitender Bürgerinnen und Bürger.
Dass es Tariflöhne sind, macht die Sache nicht besser, meine Damen und Herren.
Auch wenn wir diese individuellen Probleme nicht alle mit den beiden Gesetzen lösen können - das starke Signal, dass Löhne eine ordentliche Höhe haben müssen, können und müssen wir mit diesen Gesetzen auch senden.
Ein großer Teil unseres wirtschaftlichen Erfolgs beruht schließlich darauf, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Arbeit gut machen wollen. An gute Arbeit, an Engagement und Leistung knüpft sich das Versprechen, dass sich individuelle Anstrengung auch lohnen wird. Dieses Versprechen muss auch in Zukunft gelten.
Wer etwas leistet, wer sich reinhängt, wer sein Bestes gibt, der muss wissen, dass sich das auszahlt. In der angemessenen Entlohnung von Arbeit drückt sich eine Wertschätzung aus, die der Würde der Arbeit entspricht.
Mit den Entwürfen zum Arbeitnehmer-Entsendegesetz und zum Mindestarbeitsbedingungengesetz, die wir jetzt beraten, ermöglichen wir aus all diesen Gründen die Festsetzung von branchenspezifischen Mindestlöhnen. Sie lösen zwar nicht alle Probleme, aber doch einige sehr wesentliche.
Beide Gesetze sind das Ergebnis einer Lösung, auf die sich die Koalition im Sommer des letzten Jahres verständigt hat. Was wir hier weiterentwickeln, hat sich bewährt; denn beide Gesetze gibt es schon lange. Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz hat Auswirkungen auf die Praxis. Für das Baugewerbe gibt es schon Mindestlöhne, die sich dort positiv ausgewirkt haben. Viele loben das nach dem Motto: Es ist nicht alles Gold, aber Bronze ist auch eine Menge. Nachdem nun auch das Gebäudereinigerhandwerk und die Briefdienstleistungsbranche aufgenommen wurden, ist es uns mittlerweile gelungen, dafür zu sorgen, dass 1,8 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Mindestlöhne geschützt sind. Das ist eine gute Sache.
Wir sorgen dafür, dass weitere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diesen Schutz erhalten. Acht weitere Branchen haben sich gemeldet. Eine Arbeitsgruppe unter meiner Leitung beschäftigt sich mit dem Thema. Wir werden prüfen, ob die Kriterien, auf die wir uns in der Koalition verständigt haben, bei diesen jeweiligen Branchen erfüllt sind.
Es ist ganz klar: Wir haben gesagt, dass nur diejenigen aufgenommen werden können, bei denen eine Tarifbindung von mindestens 50 Prozent gegeben ist. Die Mehrheit der Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Branche muss also bei Arbeitgebern beschäftigt sein, die der Tarifbindung unterliegen. Das werden wir prüfen. Die Branchen, bei denen wir feststellen, dass das so ist, werden aufgenommen werden.
Als Zweites gibt es das Gesetz über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen, das auch schon lange existiert. Mit diesem Gesetz wird ermöglicht, dass wir dort, wo eine geringe Tarifbindung herrscht, ebenfalls schützen können. Dort, wo Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften keine Möglichkeit haben, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen, können wir dann mithilfe einer staatlichen Gesetzgebung dafür sorgen, dass sie nicht alleine bleiben und schlimmsten Ausbeutungsbedingungen ausgesetzt sind.
Ich will gerne ergänzen: Aus meiner Sicht hat es Sinn, dass diese beiden Gesetze von einer Großen Koalition beraten werden; denn beide Gesetze stammen aus Zeiten, in denen beide Parteien jeweils etwas dazu beigetragen haben.
Das Mindestarbeitsbedingungengesetz stammt aus dem Jahre 1952.
Es gab damals einen Antrag der SPD-Fraktion, und mit der Mehrheit der CDU/CSU-Stimmen im Deutschen Bundestag wurde es dann beschlossen. Insofern steht es in einer guten Tradition, dass wir es jetzt mit Leben erfüllen und dafür sorgen, dass es endlich auch zur Anwendung kommt.
Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz wurde während der Koalition von CDU/CSU und FDP verabschiedet. Es wurde damals zwar so geschrieben, dass es nicht zur Anwendung kommt, aber als Gerhard Schröder die Regierung übernommen hatte, war es dann doch so weit. Für die Bauwirtschaft hat es geklappt.
An diese gute Tradition knüpfen wir an, indem wir Gesetze auf den Weg bringen, mit denen wir dafür sorgen, dass das, was die Tarifvertragsparteien vor Ort und diejenigen, die in der Branche engagiert sind, richtig finden, zur Geltung kommen kann. Wir schützen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor einer schlimmen Ausbeutung. Ich glaube, das ist eine gute Tradition, die wir hier weiterentwickeln.
Meine Damen und Herren, wenn über Mindestlöhne gesprochen wird, dann gibt es eine ganze Reihe von Argumenten, die vorgetragen werden, aber nicht immer sehr stichhaltig sind. Das am häufigsten vorgetragene Argument lautet, dass Mindestlöhne Arbeitsplätze kosten.
Ich kann Ihnen nur sagen: Dafür gibt es keinerlei empirische Belege.
Es gibt eine ganze Reihe von Büchern, die mit abstrakten Berechnungen vollgeschrieben werden, aus denen sich ergeben soll, dass Mindestlöhne Arbeitsplätze kosten. Wenn wir uns aber in der Welt umschauen, dann sehen wir, dass alle möglichen Staaten über Mindestlohnregelungen verfügen,
dass sie dort, wo sie in jüngster Zeit eingeführt worden sind, keine Arbeitsplätze gekostet haben und dass dort vielmehr ein Aufwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt zu verzeichnen war. Das kann man am Beispiel Großbritannien sehen.
Deshalb will ich auch ausdrücklich sagen, dass ich mir sicher bin, welches Schicksal diese Berechnungen und Bücher haben werden: Sie werden in den Regalen verstauben. Die gleichen Professoren und Politiker, die jetzt sagen, dass Mindestlöhne eine Bedrohung für die Marktwirtschaft sind, werden in zehn Jahren sagen, dass es in der Marktwirtschaft schon immer Mindestlöhne gegeben hat und dass sie eines der besten Argumente für eine soziale Marktwirtschaft sind. Recht haben sie dann - in zehn Jahren.
Ich glaube, dass wir hier etwas voranbringen, durch das die Tarifautonomie in Deutschland gestärkt wird und das dazu beitragen kann, dass die Sozialpartnerschaft, die in unserem Lande eine gute und lange Tradition hat, wieder eine größere Rolle spielt. Am Ende dieses Prozesses werden Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser als heute dastehen, und sie werden unmittelbar spüren, dass es Sinn hat, dass sich der Deutsche Bundestag, der Gesetzgeber, mit ihren Angelegenheiten befasst und dazu beigetragen hat, dass es besser geht. Sie werden nicht alleingelassen. Das ist ein wichtiger Beitrag zur politischen Stabilität in unserem Lande und zur Verbesserung der Situation dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wenn wir in diesen Zeiten, in denen alles ein bisschen drunter und drüber geht, dazu beitragen würden, dass viele wieder daran glauben, dass die soziale Stabilität in unserer Gesellschaft noch funktioniert, dann hätten wir damit einen großen Beitrag geleistet.
Ich bin davon überzeugt, dass wir dabei sind, wichtige Gesetze voranzubringen und dass wir mit dem, was wir heute beschließen wollen, für die soziale Marktwirtschaft werben. Ich bin mir sicher, dass das sehr wichtig ist. Denn wenn sich die Bürgerinnen und Bürger alleingelassen fühlen und das Gefühl haben, dass ihr Schicksal allen egal ist, man zynische Reden hält und ihnen nicht konkret hilft, dann ist das wirklich eine Bedrohung für unser soziales Zusammenleben. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass das, was wir hier tun, für den Fortschritt in unserer Gesellschaft, für den sozialen Zusammenhalt und für die soziale Marktwirtschaft wichtig ist.
Was ich gerade ausgeführt habe, ist sozusagen ein Gegenargument zu einem Argument, das ich gestern gehört habe und das mich empört hat. Deshalb will ich zum Schluss noch darauf eingehen. Ein Redner der Linksfraktion hat gesagt, das sei doch keine Demokratie.
Das hat er in den Mittelpunkt seiner Ausführungen gestellt. Ich finde, dass man sehr vorsichtig sein muss.
- Er hat gesagt, das sei doch keine Demokratie. Er hat das rhetorisch mehrfach wiederholt.
- Ja, selbstverständlich. Wir haben ein Problem, und es geschehen Dinge, die nicht in Ordnung sind und uns alle empören müssen.
Aber dann müssen wir, der Bundestag, als demokratisch Verantwortliche und als Gesetzgeber dafür sorgen, dass die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung eine Rolle spielen.
Aber man darf nicht die Demokratie und die Handlungsmöglichkeiten, die wir haben, infrage stellen und ein bisschen den Eindruck erwecken, dass die Alternative zu dem, was wir vorhaben, eine Art Volksdemokratie wäre.
Danach klang die Äußerung gestern viel zu stark. Von jemandem, der sich in der Linkspartei verortet, ist das ein bisschen geschichtsvergessen.
Schönen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nächster Redner ist der Kollege Dr. Heinrich Kolb für die FDP-Fraktion.
Dr. Heinrich L. Kolb (FDP):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich teile Ihre Auffassung, Herr Minister Scholz, dass Mindestlöhne sozusagen das Gebot der Stunde sind, nicht. Im Gegenteil: Unser Land steht mit den heute zu beratenden Gesetzesinitiativen an einem Scheideweg. Die Einführung eines flächendeckenden Systems von Mindestlöhnen - darum geht es Ihnen doch letzten Endes, Herr Scholz - durch die Ausweitung des Entsendegesetzes und die Wiederbelebung des in Vergessenheit geratenen Mindestarbeitsbedingungsgesetzes ist eine strategische Fehlentscheidung, die geeignet ist, unser Land und unsere Volkswirtschaft auf Jahrzehnte hinaus schwer zu belasten und zu schädigen,
und die vor allem diejenigen, die arbeitslos sind oder werden und die über eine geringe Qualifikation verfügen, auf Dauer faktisch vom ersten Arbeitsmarkt ausschließt.
Diese Fehlentscheidung ist in ihrer Wirkung allenfalls mit dem Irrweg der Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich vergleichbar, der dazu geführt hat, dass durch die sprunghafte Verteuerung von Arbeit viele einfache Tätigkeiten - damals hat man von Hilfsarbeitertätigkeiten gesprochen - faktisch aus den Unternehmen verschwunden sind. Aber es ist ungleich schwerer zu korrigieren. Denn während gerade in den letzten Jahren in den Betrieben der in den 80er-Jahren begangene Fehler Zug um Zug geheilt wurde, wird es sehr schwer werden, Mindestlöhne - wenn sie erst einmal eingeführt sind - durch gesetzgeberisches Handeln wieder zurückzunehmen.
Ich rufe den Menschen, die diese Debatte heute an den Bildschirmen verfolgen, zu: Glauben Sie nicht den Politikern mit den einfachen Botschaften,
etwa der Art: ?Wer Vollzeit arbeitet, muss auch davon leben können!?. Milton Friedman, der Wirtschaftsnobelpreisträger, hat einmal gesagt: ?There?s no such thing as a free lunch?. Frei übersetzt heißt das: Es gibt kein freies Mittagessen. Irgendjemand zahlt immer die Zeche.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege Kolb, möchten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Steppuhn beantworten?
Dr. Heinrich L. Kolb (FDP):
Gerne. Bitte.
Andreas Steppuhn (SPD):
Sehr geehrter Herr Kolb, es ist richtig, dass wir in diesem Hohen Hause den Menschen im Land sagen, wer für welche Politik steht. Wenn ich nach Europa blicke, dann stelle ich fest - das wissen Sie sicherlich besser als wir Sozialdemokraten -: Nach dem Ablauf der Übergangsfristen werden Freizügigkeit und Dienstleistungsfreiheit herrschen.
Halten Sie es für richtig, dass sich dann zum Beispiel ein Friseur aus einem osteuropäischen Land auf einen Marktplatz in Deutschland stellt und die Haare für 1 Euro schneidet? Was soll dann der deutsche Friseurladen machen? Soll er Insolvenz anmelden?
Dr. Heinrich L. Kolb (FDP):
Herr Kollege Steppuhn, Sie werden die europäische Einigung und ihre Konsequenzen nicht aufhalten können. Wenn wir uns entschieden haben, einen gemeinsamen europäischen Markt zu schaffen, werden wir erleben, dass auch Selbstständige aus anderen europäischen Ländern zu uns kommen und versuchen werden, uns ihre Dienstleistungen und Produkte zu verkaufen, und zwar zu den Preisen, die auf dem Markt erzielt werden können.
Ich sehe ein anderes Problem, das Minister Scholz bereits angesprochen hat. Es gibt schon heute niedrige Löhne zum Beispiel im Bereich der Friseurdienstleistungen. Diese werden zwar beklagt, sind aber das Ergebnis der Abschlüsse der Tarifparteien; das hat Herr Scholz jedoch unterschlagen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben ihre Unterschrift unter einen Tarifvertrag geleistet und sich darauf verständigt, dass zum Beispiel für Friseurinnen und Friseure in Sachsen, im Erzgebirge 4,50 Euro in der Stunde gezahlt werden. Wenn wir uns zur sozialen Marktwirtschaft und zur Tarifautonomie bekennen, dann werden wir auch mit den Konsequenzen leben müssen, selbst wenn sie uns im Einzelfall nicht gefallen. - Herr Steppuhn, Sie können gerne noch stehen bleiben. Dann läuft die Uhr weiterhin nicht zu meinen Lasten.
Ich will sehr deutlich und unmissverständlich sagen: Mindestlöhne sind nicht frei von Risiken und Nebenwirkungen. Sie verteuern Produkte und Dienstleistungen, Herr Kollege Steppuhn. Sie verringern die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen. Sie kosten Arbeitsplätze. Das IWH in Halle geht davon aus, dass ein Mindestlohn in Höhe von 7,50 Euro zu einem Verlust von rund 620 000 Arbeitsplätzen im Niedriglohnsektor führen wird, und zwar insbesondere in den neuen Bundesländern wegen der dort größeren Bedeutung des Niedriglohnsektors für die Gesamtzahl der Beschäftigten, Herr Kollege Dreibus.
Herr Minister Scholz, ich wundere mich über die Sprunghaftigkeit der politischen Diskussion. Es war doch die SPD, die gemeinsam mit den Grünen erst vor wenigen Jahren die Einrichtung eines Niedriglohnsektors zu einem wesentlichen Ziel ihrer Politik erhoben hatte. Jetzt haben Menschen mit geringer Qualifikation Beschäftigungschancen zu niedrigeren Löhnen. Aber wieder ist das Geschrei groß: Skandal! Wie kann es sein, dass man von seiner Arbeit nicht leben kann? - Kollege Steppuhn, wir lassen Sie da nicht aus der Verantwortung. Denn Sie haben genau dafür die Voraussetzungen geschaffen; Sie wollten genau das. Wenn Sie das nun wieder ändern wollen, dann werden wir Sie nicht daran hindern können. Schließlich haben Sie zusammen mit der Union die Mehrheit. Aber Sie sollten wissen: Die Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor werden genauso schnell verschwinden, wie sie entstanden sind.
Damit wende ich mich an die Kollegen der Union. Ihnen habe ich im Dezember 2007 von dieser Stelle aus prophezeit, dass Sie nach Ihrer Zustimmung zum Mindestlohn in den Bereichen Gebäudereinigung und Postdienstleistungen Zug um Zug bei weiteren Branchen über den Tisch gezogen werden. Heute kommt es erneut zum Schwur. Heute werden Sie sich erneut in die falsche Richtung bewegen.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege Kolb, darf auch der Kollege Ernst eine Zwischenfrage stellen?
Dr. Heinrich L. Kolb (FDP):
Ja, bitte.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Dann muss es aber auch gut sein, weil die Redezeiten durch Zwischenfragen eigentlich nicht vervielfacht werden sollen.
Klaus Ernst (DIE LINKE):
Das ist auch nicht meine Absicht. Danke, dass Sie meine Zwischenfrage zulassen. - Meine Frage ist leicht zu beantworten, Herr Dr. Kolb. Sie stellen immer einen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Mindestlöhnen her. Glauben Sie denn, dass das Pferd nicht vom Traktor ersetzt worden wäre, wenn es versprochen hätte, weniger zu saufen und zu fressen? Letztendlich läuft das darauf hinaus. Natürlich ist es eine Tatsache, dass Arbeitsplätze abwandern. Das hat aber teilweise gar nichts mit den Löhnen zu tun, sondern mit dem technischen Fortschritt. Des Weiteren ist es eine Tatsache, dass über die Länder, in denen es Mindestlöhne gibt, das Gegenteil von dem berichtet wird, was Sie sagen. Meine Frage: Kann man Jobs erhalten, wenn man die Löhne so stark senkt, dass man davon nicht mehr leben kann?
Dr. Heinrich L. Kolb (FDP):
Herr Kollege Ernst, ich bin davon überzeugt, dass auf Dauer die gezahlten Löhne und der Wert der in einer Zeiteinheit hergestellten Produkte und erbrachten Dienstleistungen korrespondieren müssen. Kein Arbeitgeber kann auf Dauer Löhne zahlen, die nicht durch die Erlöse aus dem gedeckt sind, was produziert wurde. Wer das auf Dauer tun würde, würde unweigerlich in den Konkurs, in die Insolvenz geraten und mit der Existenz seines Unternehmens bezahlen. Davon bin ich überzeugt. Das ist der erste Punkt.
Der zweite Punkt betrifft - das ist vorhin schon angesprochen worden - die Mindestlöhne in den anderen europäischen Ländern. Ich habe mir das übrigens einmal anhand einer Schrift, die vom DGB verlegt wurde, angeschaut. In den allermeisten Fällen liegen die Mindestlöhne in den anderen EU-Staaten unter 3,50 Euro.
- Ich sagte, in den allermeisten Fällen liegen sie unter 3,50 Euro. Darunter sind viele osteuropäische Staaten. Das ist keine Frage. - Es gibt insgesamt sieben Staaten in Europa - -
- Lassen Sie mich doch einmal zu Ende reden. Ich gehe davon aus, dass das alles nicht auf meine Redezeit angerechnet wird, Herr Präsident.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Mit Ausnahme der Rückfragen, nicht.
Dr. Heinrich L. Kolb (FDP):
Herr Kollege Ernst, es gibt insgesamt sieben Staaten in Europa, die einen Mindestlohn etwa in der Größenordnung von 7,50 Euro haben, die von Ihnen zumindest in der Vergangenheit gefordert wurde. Mittlerweile ist der Benchmark eher bei 9 Euro bis 9,80 Euro. Dann muss man aber auch sehen, dass beispielsweise Großbritannien ganz andere Lohnnebenkosten hat, als wir sie in Deutschland haben, und dass die Arbeitsmarktregulierung in Großbritannien eine vollkommen andere ist, als wir sie in Deutschland haben. Sie dürfen nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern es müssen gleiche Sachverhalte verglichen werden. Wenn man glaubt, man könne die Löhne anheben und die starke Regulierung beibehalten, dann - das sage ich Ihnen - wird man am Ende genau das erleben, was ich hier prophezeit habe, nämlich dass in großer Zahl - da stehe ich nicht alleine als Kassandra, sondern alle bedeutenden Wirtschaftsinstitute in Deutschland kommen zu ähnlichen Ergebnissen - Arbeitsplätze verloren gehen.
Nun zurück zur Union. Es ist uns nicht verborgen geblieben, wie Sie sich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ein Ringer beim Kampf auf der Matte gewunden haben. Wie Sie versucht haben, Herr Kollege Straubinger, sich aus dem Klammergriff des politischen Gegners zu lösen.
Aber so sehr Sie sich auch bemüht haben: Aus dem Schwitzkasten, in den die SPD Sie beim Thema Mindestlohn genommen hat, konnten Sie sich nicht mehr befreien.
Herr Kollege Lehrieder, es leuchtet mir nicht ein, wie man auf der einen Seite - wie die Kanzlerin höchstpersönlich - gegen einen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn sein kann, auf der anderen Seite aber die Hand dafür heben kann, Branche für Branche spezifische Mindestlöhne einzuführen.
Es gibt nicht gute und weniger gute Mindestlöhne. Auch die branchenspezifischen Mindestlöhne sind ein Irrweg, wie Claus Hulverscheidt in der Süddeutschen Zeitung zu Recht ausgeführt hat. Er wirft die Frage auf:
Wie eigentlich will die SPD - und ich füge hinzu: wie will die CDU - erklären, dass ungelernte Postboten mindestens 9,80 Euro, ausgebildete Friseurinnen aber vielleicht nur 6,50 Euro erhalten sollen? Ist das gerecht?
Ich sage: Nein, gerecht ist das nicht. Vieles spricht dafür, dass die vorgesehenen Regelungen zudem ein verfassungswidriger Eingriff in die grundgesetzlich garantierte Tarifautonomie sind.
Diesen Fragen werden wir in der Anhörung zu Ihren Gesetzentwürfen besondere Bedeutung zukommen lassen.
Ich meine, der Spuk muss ein Ende haben. Die Party der letzten Jahre, in denen Sie sich an mehr oder weniger verdienten Arbeitsmarkterfolgen selbstzufrieden gesonnt haben, ist vorbei. Was den Mindestlohn angeht, so gilt angesichts des Übergreifens der Finanzmarktkrise auf die Realwirtschaft: Nie war er so falsch wie heute.
Der Kollege Wend hat gestern in der Debatte zu den Turbulenzen an den Finanzmärkten und mit Blick auf die zu erwartende konjunkturelle Abschwächung mit sorgenvollem Gesicht gefragt: Was können wir tun, um dem Mittelstand zu helfen? - Herr Wend, ich kann Ihnen sagen, was Sie nicht tun sollten, wenn es Ihnen wirklich um den Mittelstand geht: Sie sollten diese Mindestlohngesetze nicht verabschieden. In den Unternehmen, in denen der Mindestlohn wirklich greifen würde, ist die zwangsweise Anhebung von Löhnen durch den Gesetzgeber bei einer rückläufigen Konjunktur so wirksam wie die Verabreichung von K.-o.-Tropfen. Dass die Warnung einen realen Hintergrund hat, haben wir bei der Postdienstleistungsbranche sehen müssen, in der innerhalb von wenigen Monaten 6 000 Arbeitsplätze verschwunden sind.
Ich komme zum Schluss. Wir sollten nicht länger über Mindestlöhne reden, sondern über ein Mindesteinkommen. Wer seinen Bedarf nicht aus dem Ergebnis eigener Arbeit decken kann, der muss zur vollen Bedarfsdeckung einen staatlichen, steuerfinanzierten Zuschuss bekommen. Die FDP hat dazu das Konzept -
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege.
Dr. Heinrich L. Kolb (FDP):
- des liberalen Bürgergeldes entwickelt, das mein Kollege Niebel in seinem Redebeitrag näher erläutern wird. Das empfehle ich Ihrer Aufmerksamkeit.
Ich bedanke mich, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit haben zuteil werden lassen.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nun erhält der Kollege Dr. Ralf Brauksiepe das Wort für die CDU/CSU-Fraktion.
Dr. Ralf Brauksiepe (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Arbeitsmarktpolitik der Regierung Merkel ist erfolgreich wie keine andere zuvor. Keine andere Bundesregierung hat es geschafft, die Zahl der Arbeitslosen in drei Jahren um fast 2 Millionen zu reduzieren. Wir erleben gegenwärtig gleichzeitig Tarifabschlüsse, die deutlich über den Tarifforderungen der Gewerkschaften früherer Jahre des wirtschaftlichen Abschwungs liegen. Das zeigt uns und bestätigt: Hohe Beschäftigung ist das beste Mittel gegen niedrige Löhne, und deswegen haben wir mit guter Politik etwas gegen niedrige Löhne in diesem Land getan.
Hohe Beschäftigung bleibt auch das beste Mittel gegen niedrige Löhne.
Gleichzeitig werden wir als Große Koalition und wird die Bundesregierung ihrer Verantwortung gerecht, ergänzend einen rechtlichen Rahmen dafür zu setzen, dass in diesem Land gerechte Löhne gezahlt werden. Dazu gehört die Ausweitung des Entsendegesetzes, und dazu gehört das doppelte Angebot, das wir für die Branchen machen, die eine hohe Tarifbindung haben und die die Aufnahme in das Entsendegesetz wollen. Denjenigen, die nicht die Chance haben, eine solche Tarifbindung zu erreichen, dient die Modernisierung des Mindestarbeitsbedingungengesetzes aus der Zeit von Konrad Adenauer und Ludwig Erhard. Meines Wissens war auch die FDP damals an der Regierung beteiligt.
Dieses Gesetz stammt also aus einer Zeit, in der wir ebenfalls eine gute Regierung hatten.
Wir setzen damit den Weg tariflicher Mindestlöhne fort. Unser Grundsatz ist: Wir wollen die Tarifvertragsparteien stärken; wir wollen sie nicht ersetzen. Die Tarifautonomie lebt davon, dass nicht jeder von dem Recht auf negative Koalitionsfreiheit Gebrauch macht. Dass man davon Gebrauch macht, das gibt es auch. Tarifautonomie kann nur wirklich lebendig sein, wenn es auch welche gibt, die bei der Tarifautonomie mitmachen.
Dieses Land ist nicht durch einen Wettbewerb um die niedrigsten Löhne wirtschaftlich groß und stark geworden, sondern durch vernünftige Lohnuntergrenzen im Wettbewerb um Innovationen und Qualität.
Einen anständigen Lohn für eine anständige Arbeit zu zahlen, das ist ein urchristliches Anliegen. Die Päpste, die das schon vor Jahrhunderten gefordert haben, waren keine Sozialisten.
Es ist ein urchristliches Anliegen, dass man für eine anständige Arbeit einen anständigen Lohn bekommt. Das ist in einer sozialen Marktwirtschaft möglich, und es ist die beste Voraussetzung für eine soziale Marktwirtschaft.
Es ist unverkennbar, dass die Regelungen, auf die wir uns in der Konsequenz dessen, was wir schon früher vereinbart haben, verständigt haben, viele Gegner haben. Da gibt es die FDP, die sagt: Das soll alles so weitergehen; der Staat soll sich da heraushalten. Wir sagen: In einer Situation, in dem die Tarifbindung in unserem Land leider sinkt - sie ist mittlerweile bei rund 52 Prozent angekommen -, kann man nicht so tun, als könnte alles so weitergehen wie bisher. Wir brauchen in diesem Land eine Renaissance der Tarifautonomie, wenn wir keine staatliche Lohnfestsetzung wollen. Wir wollen keine staatliche Lohnfestsetzung; deswegen wollen wir die Tarifautonomie stärken.
Genauso klar ist für uns, dass es auf der anderen Seite in einem Land, in dem die Situation in den verschiedenen Branchen und Regionen so unterschiedlich ist, wie sie es bei uns ist, keinen einheitlichen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn geben kann. Die Lage ist differenziert, und wir brauchen deswegen auch den Mut zu differenzierten - nicht zu einfachen - Lösungen. Daher legen wir diese Gesetzentwürfe vor.
Was ich meine, will ich an der unterschiedlichen Situation, die wir in diesem Land haben, verdeutlichen. Die wirtschaftliche Situation in Nordrhein-Westfalen, woher ich komme, ist natürlich mit der seiner Nachbarländer, beispielsweise Belgien und Niederlande, vergleichbar. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine - sozial sehr verantwortungsvolle - Landesregierung, die dafür gesorgt hat, dass bereits in drei Branchen Flächentarifverträge landesweit für allgemeinverbindlich erklärt werden können, und zwar mit Löhnen, wie sie auch hier in Debatten um flächendeckende gesetzliche Mindestlöhne gefordert werden.
Karl-Josef Laumann hat beispielsweise im Friseurgewerbe einen von Tarifvertragsparteien vereinbarten Mindestlohn von 7,60 Euro für allgemeinverbindlich erklärt. Sie werden doch nicht sagen, dass die FDP in NRW dabei nur wegen der schönen Dienstwagen der Landesregierungsmitglieder mitgemacht hat. Sie waren doch aus voller Überzeugung für einen tariflichen Mindestlohn für Friseure in Nordrhein-Westfalen.
Wir machen eine gute, soziale Politik in NRW, und Sie machen sogar mit. Stellen Sie sich doch hier nicht dümmer an, als Sie in NRW regieren.
So machen wir es doch vernünftig in Nordrhein-Westfalen.
Gleichzeitig ist klar: Wir machen hier nicht nur Politik für Nordrhein-Westfalen; wir machen hier Gesetze, die in Aachen genauso gelten können müssen wie in Frankfurt/Oder.
In den verschiedenen Teilen unseres Landes ist die Situation unterschiedlich. In unserem Nachbarland Polen beträgt der gesetzliche Mindestlohn umgerechnet 1,92 Euro, in Tschechien 1,97 Euro. Da soll niemand so tun, als würde der Markt nicht merken, wenn die Lohnunterschiede so groß sind. Bei uns sind die Löhne, von Tarifvertragsparteien vereinbart, deutlich höher. Wir unterstützen mit einer Vielzahl von Maßnahmen, dass es möglich ist, westlich der Oder deutlich höhere Löhne zu zahlen als östlich der Oder.
Wenn die Tarifvertragsparteien, die auch in den neuen Ländern vielfach gute Löhne vereinbart haben, erklären: ?Wir trauen uns zu, dass wir viermal besser sind als unsere polnischen Konkurrenten, und wir trauen uns zu, dass wir viermal höhere Tariflöhne zahlen können als die 1,92 Euro östlich der Oder?, dann sagen wir als Politik doch nicht: Das darf nicht sein. Wir wollen doch, dass die Tarifverträge gelten. Aber wenn beispielsweise die Tarifvertragsparteien im Sicherheitsgewerbe erklären: ?6 Euro können wir verkraften - in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern und anderswo?
und das so vereinbaren, dann wären wir doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir sagen würden: 7,50 Euro muss gesetzlich vorgeschrieben werden. Es wäre doch Hybris, sich so über die Tarifvertragsparteien hinwegzusetzen. Das machen wir nicht.
Das ist der entscheidende Unterschied zwischen einem gesetzlichen Mindestlohn und einer branchenspezifischen Regelung von Tarifvertragsparteien, die wir akzeptieren und zu stärken bereit sind.
Wir sind jetzt - darauf hat der Bundesarbeitsminister zu Recht hingewiesen - am Beginn ergebnisoffener parlamentarischer Beratungen über die Frage, welche der Branchen, die einen entsprechenden Antrag gestellt haben, in das Entsendegesetz aufgenommen werden können. Es gibt bei der SPD eine Vorabfestlegung: alle Branchen. Wir kennen das. Seit Monaten erzählt der Kollege Struck - er schaut mich gerade an -: Wir treiben die Union von Branche zu Branche zum Mindestlohn.
Das ist euer politisches Ziel. Das ist legitim. Klappen wird es nicht.
Wir haben uns nur an einer Stelle festgelegt, nämlich: Die Voraussetzungen für die Aufnahme der Zeitarbeitbranche ins Entsendegesetz sind nicht erfüllt. Dort besteht seit mehreren Jahren dieselbe Situation. Deswegen ist das entscheidungsreif. In dieser Branche besteht eine Tarifbindung von annähernd 100 Prozent. Wenn wir sagen: ?Wir wollen die Tarifvertragsparteien stärken, aber nicht ersetzen?, dann macht es bei einer Tarifbindung von bundesweit nur noch etwas über 50 Prozent keinen Sinn, bei einer Branche anzusetzen, die fast 100 Prozent Tarifbindung hat. Das ist die Lage. Deswegen haben wir das so erklärt.
Ich will nur noch einmal daran erinnern, wie die Lage ist. Es gibt einen Tarifvertrag des DGB mit einer unteren Lohngruppe von 7,31 Euro im Westen. Es gibt einen CGB-Tarifvertrag mit 7,21 Euro. Grundsätzlich können wir Tarifverträge verdrängen - das ist wahr -, aber es muss Güter von Verfassungsrang geben, die das rechtfertigen. Niemand kann uns erzählen, dass zwischen 7,21 Euro und 7,31 Euro die Grenze liegt, von der an beispielsweise die Berufsfreiheit - Art. 12 Grundgesetz - oder die Menschenwürde verletzt ist. Herr Sommer, der DGB-Vorsitzende, hat im letzten Jahr auf einer Mai-Kundgebung, als wir das Angebot gemacht hatten, die Regelung über sittenwidrige Löhne im Gesetz noch weiter zu verschärfen, gesagt, Löhne unter 7,50 Euro seien sittenwidrig. Das heißt, aus DGB-Sicht hat der DGB selbst einen sittenwidrigen Tarifvertrag abgeschlossen. Ich schließe mich dieser Einschätzung ausdrücklich nicht an. Für uns gilt die Richtigkeitsgewähr von Tarifverträgen. Ich sage klipp und klar: Es ist kein Rechtsgut von Verfassungsrang erkennbar, das es wegen 10 Cent Unterschied rechtfertigen würde, an der Stelle einen Tarifvertrag über den anderen zu erstrecken und zu verdrängen. Deswegen machen wir das nicht.
Ich möchte mich bei all denjenigen, die den Grundstein für die Gesetzentwürfe gelegt haben, die wir jetzt beraten, herzlich bedanken. CDU und CSU haben die Position, Tarifvertragsparteien zu stärken, aber nicht zu ersetzen, durchgesetzt. Das gilt für die Bundesregierung. Das gilt für die CDU/CSU-Fraktion. Wir waren als Fraktion sehr eng in die Entwurfserstellung eingebunden. Ich freue mich, dass wir zu diesem Ergebnis gekommen sind. Ich freue mich auch, dass es möglich ist, dass wir dies als Koalition gemeinsam machen, nachdem Kurt Beck, an den sich die Älteren in diesem Hause sicherlich noch erinnern, seinerzeit gesagt hat, es sei eine große Niederlage für die SPD, den flächendeckenden Mindestlohn nicht durchgesetzt zu haben. Es ist gut, dass wir uns gemeinsam auf diesen Weg der Stärkung der Tarifvertragsparteien begeben haben, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ehre, wem Ehre gebührt: Ich erinnere daran, dass wir auf den Schultern derer stehen - darauf hat Olaf Scholz zu Recht hingewiesen -, die in den 90er-Jahren das Entsendegesetz geschaffen haben. Norbert Blüm, der damalige Bundesarbeitsminister, und Heinrich Kolb, der damalige Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, sind die Väter dieses Gesetzes. Auf den Schultern von Norbert Blüm und Heinrich Kolb bauen wir heute auf.
Sie haben das Entsendegesetz auf den Weg gebracht; das ist die Wahrheit. Die Grünen dagegen haben in sieben Jahren Mitregierung keine einzige Branche ins Entsendegesetz aufgenommen. Alle Branchen sind unter CDU-Kanzlerinnen und -Kanzlern ins Entsendegesetz aufgenommen worden. CDU/CSU und FDP sind in diesem Hause die Parteien für tarifliche Mindestlöhne.
Diese sozial gerechte Politik für die arbeitenden Menschen werden wir fortsetzen, auch wenn Sie die Vaterschaft im Nachhinein bestreiten. Damals waren Sie gut, und wenn Sie wieder gut sind, dann können Sie auch wieder mitregieren, Herr Kolb.
Schönen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege Brauksiepe, da Sie die Gruß- und Glückwunschadressen an die vermeintlichen Väter einschlägiger Gesetzgebung heute Morgen nur an einen von beiden persönlich haben richten können, werden Sie sicherstellen, dass es der andere in geeigneter Weise erfährt.
Nun hat der Kollege Werner Dreibus für die Fraktion Die Linke das Wort.
Werner Dreibus (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit den vorliegenden Gesetzentwürfen räumt die Bundesregierung immerhin ein, dass Armut trotz Arbeit in Deutschland ein gravierendes - ich betone: gravierendes - Problem ist und dass Politik endlich handeln muss.
Das ist ein Fortschritt, den wir begrüßen, auch wenn er - das ist schon bitter - für die Menschen, die seit Jahren für Stundenlöhne von 3, 4 oder 5 Euro arbeiten müssen, viel zu spät kommt. Die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen, lautet aber: Reicht das, was die Bundesregierung hier vorlegt, aus, um das Problem tatsächlich in den Griff zu bekommen?
Rund 6,5 Millionen Menschen verdienen in Vollzeitarbeit weniger als drei Viertel des durchschnittlichen Bruttoeinkommens. Das ist ein Viertel aller abhängig Beschäftigten, Tendenz steigend. Von diesen 6,5 Millionen Menschen verdienen rund 3,8 Millionen weniger als 50 Prozent des Durchschnittslohns, also weniger als 50 Prozent von 1 470 Euro im Monat. Wir sprechen, wie gesagt, über Stundenlöhne von 3, 4 oder 5 Euro. Das sind Armutslöhne. Von diesen Armutslöhnen sind in besonderer Weise, nämlich zu 70 bis 80 Prozent, Frauen betroffen. Die Folgen werden regelmäßig nicht nur von uns beklagt: sinkende Reallöhne, Nachfrageschwäche, sinkender Anteil der Erwerbseinkommen, wachsende Lücke zwischen niedrigen und hohen Einkommen, eine wachsende Zahl von Familien und Kindern in Armut usw.
Wir brauchen eine Untergrenze für Löhne, die gewährleistet, dass ein Lohn für Vollzeittätigkeit auch tatsächlich zum Leben reicht. Deshalb muss - egal, wie das Gesetz letztendlich heißt - an erster Stelle die Festlegung einer allgemeinen Lohnuntergrenze liegen, die sicherstellt, dass Menschen, die Vollzeit arbeiten, davon tatsächlich auch leben können.
In dieser Hinsicht sind leider die Gesetzentwürfe der Bundesregierung substanzlos. Die wesentliche Frage, die wir uns heute stellen und die sich Millionen Menschen stellen, wie hoch der Lohn sein sollte, wird in den beiden Gesetzentwürfen noch nicht einmal gestreift. Stattdessen konzentrieren Sie sich auf Verfahrensfragen; sie sind auch wichtig, kommen aber immer an zweiter Stelle. Vorschläge zum Verfahren können die fehlende Substanz nicht ersetzen.
Was soll nach den Vorstellungen der Koalition passieren? Sie wollen die untersten Tariflöhne zu Mindestlöhnen erklären. In vielen Bereichen ist dies nichts anderes als Etikettenschwindel. In Deutschland gibt es massenweise Tariflöhne von 3, 4 oder 5 Euro pro Stunde: im Einzelhandel, im Fleischerhandwerk, im Bewachungsgewerbe usw. Keinem Mann und keiner Frau - betroffen sind, wie gesagt, vor allen Dingen Frauen - wäre damit gedient, wenn wir als Gesetzgeber Tariflöhne von 3,50 Euro per Gesetz zu Mindestlöhnen erklärten. Im Gegenteil; dann bekäme Lohndumping auch noch den Segen des Gesetzgebers.
An dieser Stelle eine Zwischenbemerkung. Gewerkschaften können dann gute Löhne durchsetzen, wenn Beschäftigte selbstbewusst sind und sich organisieren. Wer aber in einem 400-Euro-Job schafft, nur einen befristeten Arbeitsvertrag hat oder als Leiharbeiter eingesetzt ist - heute hier, morgen da -, hat schlicht und ergreifend Existenzangst. Er fragt sich zu Recht: Fliege ich raus, wenn ich mich engagiere? Ist mein Job dann ganz weg?
So sieht die Wirklichkeit von Millionen von Menschen mit prekären Arbeitsverhältnissen aus. Dafür trifft nicht diese Menschen die Schuld, sondern einzig und allein die Politik,
allen voran SPD und Grüne, die mit den Hartz-Gesetzen die Menschen gedemütigt und - bewusst oder unbewusst - den Gewerkschaften einen Knüppel zwischen die Beine geworfen haben. Gedemütigte Menschen engagieren sich nicht, organisieren sich nicht, setzen auch nicht über die Gewerkschaften gerechte Arbeitsbedingungen durch. Union und FDP haben - das wissen wir alle; das ist auch heute Morgen wieder geschehen - diesen Zuständen noch applaudiert und Hurra gerufen.
So sieht es aus. Jetzt beklagen wir, dass es so viele Menschen gibt, die von ihrer Arbeit nicht leben können. Dafür sind Sie verantwortlich und niemand anderes. Aber obwohl nun endlich die Erkenntnis reift, dass es so nicht weitergehen kann, schaffen Sie es nicht einmal, wenigstens eine klare Grenze für Lohndumping einzuführen. Damit nicht genug: Letztlich missachtet die Koalition mit den beiden Gesetzentwürfen eine Lohnuntergrenze, die der Gesetzgeber faktisch längst festgelegt hat. Ich meine die Pfändungsfreigrenze, die derzeit bei rund 1 000 Euro netto liegt. Die Pfändungsfreigrenze besagt, dass einem verschuldeten alleinstehenden Arbeitnehmer oder einer verschuldeten alleinstehenden Arbeitnehmerin ein Einkommen mindestens in dieser Höhe zusteht und nicht gepfändet werden darf; denn weniger als 1 000 Euro reichen nicht zum Leben. Aber Sie wollen allen Ernstes mit den vorliegenden Gesetzentwürfen Tariflöhne zu Mindestlöhnen erklären, bei denen nicht einmal 1 000 Euro brutto auf dem Lohnzettel stehen.
Eine Friseurin in Brandenburg, um ein zugegebenermaßen extremes, aber leider nicht gering verbreitetes Beispiel zu nennen, bekommt 2,75 Euro die Stunde per Tarifvertrag. Das wollen Sie mit diesen Gesetzen zum Mindestlohn erklären. Das ist zynisch und menschenunwürdig.
- Deshalb habe ich es ja gesagt, Herr Niebel. Im Gegensatz zu Ihnen weiß ich, wovon ich rede.
Hätten wir in Deutschland einen Mindestlohn wie in Frankreich, würde bei einer Vollzeitarbeit ein Nettolohn ermöglicht, der mindestens auf der Höhe der Pfändungsfreigrenze in Deutschland läge. Der Mindestlohn in Frankreich beträgt derzeit 8,71 Euro die Stunde. Das sollte auch für einen Mindestlohn in Deutschland eine Orientierungszahl sein.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege Dreibus, nun möchte der Kollege Niebel, wie beinahe vorprogrammiert, die von Ihnen provozierte Zwischenfrage stellen.
Werner Dreibus (DIE LINKE):
Das war ja fast schon eine Vorlage. - Bitte schön, Herr Niebel.
Dirk Niebel (FDP):
Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich habe mich mit dieser Frage lange zurückgehalten und gedacht, ich könne sie umgehen. Aber dem Handbuch des Deutschen Bundestages ist zu entnehmen, dass Sie, Herr Kollege Dreibus, im Hauptberuf Gewerkschaftssekretär sind,
also durchaus jemand, wie Sie gesagt haben, der sich mit Tarifverhandlungen auskennt. Da Sie jetzt aber im Rahmen Ihres Wortbeitrages schon mehrfach gesagt haben, dass die untersten Tariflöhne, die von der Regierung - ich bin gegen Mindestlöhne, nur dass das nicht vergessen wird -
als allgemein verbindliche Mindestlöhne eingeführt werden sollen, sittenwidrige Dumpinglöhne sind - so ungefähr haben Sie es formuliert -, frage ich mich, warum Ihre Kolleginnen und Kollegen Gewerkschaftssekretäre Tarifverträge mit solchen sittenwidrigen Dumpinglöhnen unterschreiben.
Werner Dreibus (DIE LINKE):
Ich gebe Ihnen zwei Antworten darauf. Erstens. Wenn Sie mir vor der Formulierung Ihrer Frage bei meiner Rede zugehört hätten, hätten Sie festgestellt, dass ich die Antwort bereits gegeben habe.
Zweitens. Ich bin als Gewerkschafter bei diesen Entwicklungen Täter und Opfer zugleich. Ich bin als Gewerkschafter in vielen Fällen - wenn die Bedingungen so sind, dass Menschen, beispielsweise Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter, nicht in der Lage sind, sich engagiert für ihre Interessen einzusetzen, weil sie Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren -
gezwungen, gemeinsam mit diesen Menschen das Mindeste herauszuholen, was herauszuholen ist, und das sind oft sittenwidrige Löhne.
Aber wenigstens bin ich in der Lage, mein eigenes Tun kritisch zu sehen und festzustellen, dass Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um das in Zukunft zu ändern.
Dieses Maß an Selbstkritik würde ich auch bei Ihnen gerne erkennen.
Ich wiederhole: Hätten wir in Deutschland einen Mindestlohn wie in Frankreich, dann hätten wir ihn in einer Größenordnung von 8,71 Euro. Wenn Sie es wirklich ernst meinen mit Mindestlöhnen, dann müssen Sie in der Koalition über solche Größenordnungen sprechen, Herr Minister. Nur dann kommen wir ein Stück weiter.
Zur Redlichkeit der Politik gehört auch, den Willen der Menschen zu achten. Drei Viertel der Deutschen sind für gesetzliche Mindestlöhne. Alle Umfragen zeigen das. Auch unter den Wählern der CDU gibt es dafür eine deutliche Mehrheit. Das wissen Sie. Sie handeln somit gegen den Willen Ihrer Wählerinnen und Wähler.
Demokratie heißt Volksherrschaft. Darum geht es bei diesem Thema genauso wie bei dem Thema Finanzkrise. Nur so sind die Worte meines Fraktionsvorsitzenden gestern zu verstehen, gemeint und auch gesagt worden. Die Finanzkrise ist eine Krise der Demokratie, weil wir die Voraussetzungen dafür geschaffen haben. Deshalb besteht für uns die verdammte Pflicht und Notwendigkeit, mit demokratischen Entscheidungen Korrekturen herbeizuführen - im Bereich der internationalen Finanzkrise genauso wie beim Thema Dumpinglöhne.
Nicht nur wir kritisieren die vorliegenden Gesetzentwürfe. Viele Experten haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten damit beschäftigt und darauf hingewiesen, dass manches in diesen Gesetzentwürfen einen Schritt darstellt, dass aber das eigentliche Problem, nämlich die Schaffung einer sicheren Lohnuntergrenze, mit diesen Gesetzentwürfen nicht gelöst wird. Dies ist jedenfalls kein Ersatz für einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn.
Auch der Weg über das Gesetz über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen ist keine Alternative. Wir müssten für jede heute tariflose Branche eine Kommission bilden, und es müssten Verhandlungen geführt werden. Das würde einen riesigen Aufwand bedeuten. Am Ende wäre noch nicht einmal sichergestellt, dass bei solchen Gesprächen ein vernünftiger Mindestlohn herauskommt. Dass Hunderte von Branchenmindestlöhnen zudem völlig intransparent wären, sei hier nur am Rande erwähnt.
Die Experten des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts des DGB haben in ihrer Studie darauf hingewiesen:
Zu erwarten ist auch, dass zahlreiche Lücken bleiben, wenn nicht systematisch und flächendeckend für alle in Betracht kommenden Niedriglohnbranchen Verfahren in Gang gesetzt werden.
Das Fazit der Wissenschaftler des DGB lautet: Die erwartbaren
Regelungslücken werden auch in Deutschland dafür sorgen, dass eine universelle Lösung im Sinne eines allgemeinen, branchenübergreifenden Mindestlohns auf der Tagesordnung bleibt.
An dieser Stelle eine zweite Zwischenbemerkung, gerichtet an diejenigen, die meinen, der deutsche Kapitalismus breche zusammen, wenn ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt wird.
Es ist schon davon gesprochen worden: In 20 EU-Staaten gibt es Mindestlöhne. Darunter sind Staaten wie Großbritannien oder die Niederlande. In beiden Ländern liegt der Mindestlohn deutlich über 8 Euro, und er schadet dem Arbeitsmarkt in keiner Weise. Da überall im Kapitalismus dieselben ökonomischen Gesetze gelten, ist zu erwarten, dass die deutsche Wirtschaft unter einem Mindestlohn von 8,71 Euro - wie die Franzosen ihn haben - nicht zusammenbrechen wird.
Der wahre Grund dafür, weshalb die Regierung und die FDP - zumindest die CDU und die FDP - den gesetzlichen Mindestlohn so nachhaltig ablehnen, ist doch ein ganz anderer. Wir alle wissen, dass billige Löhne letztlich höhere Profite bedeuten. Das sagen Sie so natürlich nicht. Um Gottes Willen. Jetzt schon gar nicht in diesen Zeiten. Täten Sie es, wäre allen sofort klar, dass Sie die einen bei schmaler Kost halten wollen, damit es den anderen besser geht. Deshalb müssen wir uns von Ihnen immer wieder die Mär anhören, ein gesetzlicher Mindestlohn würde Arbeitsplätze vernichten. Das ist blanker Unsinn.
Wer einen klaren Blick hat, der weiß, was zu tun ist. Wir brauchen ein Gesetz, das erstens einen einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn festlegt und das zweitens den Tarifparteien ermöglicht, branchenspezifische Mindestlöhne zu vereinbaren, sofern diese über dem gesetzlichen Mindestlohn liegen.
Meine Fraktion hat bereits im Jahr 2006 Eckpunkte für ein solches Gesetzgebungsverfahren in den Bundestag eingebracht. Dabei orientieren wir uns an den schon mehrfach zitierten positiven Erfahrungen Großbritanniens.
Dazu ein letztes Zitat. Auf einer Anhörung meiner Fraktion stellte John Cridland dazu fest:
Bisher war der Mindestlohn ein großer Erfolg. Für mehr als eine Million Arbeitnehmer sind die Löhne deutlich angehoben worden, ohne dass dies Arbeitsplätze gekostet hätte. Auch die Wirtschaft ist nicht behindert worden.
Herr Cridland ist stellvertretender Vorsitzender des britischen Industrieverbandes, also sozusagen des BDI von Großbritannien, und Mitglied der britischen Low Pay Commission. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen.
Vielen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält nun die Kollegin Brigitte Pothmer, Bündnis 90/Die Grünen.
Brigitte Pothmer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 20 von 27 europäischen Mitgliedstaaten haben gesetzliche Mindestlöhne. Nun ist es nicht etwa so, dass die anderen europäischen Staaten keine Mindestlohnregelungen hätten. Nein, sie haben äquivalente Regelungen, die dafür sorgen, dass eine bestimmte Lohnuntergrenze nicht unterschritten wird. In Deutschland ist das leider immer noch anders.
Im letzten Jahr sind die Mindestlöhne in sehr vielen Ländern angehoben worden. Bei uns sind im letzten Jahr die Löhne gerade im untersten Bereich noch einmal deutlich gesenkt worden.
Der Mindestlohn in den anderen europäischen Ländern hat dafür Sorge getragen, dass diejenigen, die am schlechtesten verdienen, vom wirtschaftlichen Aufschwung profitieren, der noch im letzten Jahr zu verzeichnen war.
- Wir wollten den Niedriglohnsektor keineswegs. Wir wollten immer, dass Mindeststandards festgeschrieben werden, Herr Kolb.
Sie aber haben lautstark dagegengebrüllt.
Ich will Ihnen einmal sagen, wie sich die Mindestlöhne im letzten Jahr in den anderen Ländern entwickelt haben: In Großbritannien liegt der Mindestlohn bei 5,73 Pfund, in den Niederlanden bei 8,33 Euro, in Belgien bei 8,41 Euro, in Frankreich bei 8,71 Euro und in Luxemburg bei 9,30 Euro. Jetzt kommen Sie mir nicht, Herr Kolb, mit den östlichen europäischen Ländern. Natürlich hat die Festsetzung der Höhe des Mindestlohns auch etwas mit den Lebenshaltungskosten in den jeweiligen Ländern zu tun.
Natürlich geht es um vergleichbare Volkswirtschaften, Herr Kolb. Wenn das mal in Ihren Kopf ginge!
Ich frage Sie: Warum soll bei uns etwas nicht gehen, was in den anderen europäischen Ländern seit Jahren überaus erfolgreich funktioniert,
und zwar ohne dass damit Arbeitsplätze vernichtet werden? Wenn es nach Ihrer Propaganda ginge, meine Damen und Herren von der FDP
- ich spreche an dieser Stelle, Herr Brauksiepe, ausdrücklich auch die CDU/CSU an -, dann wären Großbritannien, die Niederlande, Belgien, Frankreich und Luxemburg längst erledigt.
Untergegangen wären sie auf dem Weg in eine sozialistische Planwirtschaft. Das ist doch die Propaganda, die Sie hier immer vortragen.
Aber die Wirklichkeit widerlegt Sie. Was soll ich Ihnen sagen: Noch immer hat sich die Propaganda an der Wirklichkeit gebrochen. Die jedenfalls werden Sie propagandistisch nicht überlisten.
Deutschland hält einen traurigen Rekord: Deutschland hat den größten Niedriglohnsektor in ganz Europa. Innerhalb dieses Niedriglohnsektors arbeiten 2 Millionen Menschen in Deutschland für Löhne unterhalb von 5 Euro die Stunde. Das sind noch nicht einmal 200 Euro in der Woche. Das sind knapp 800 Euro im Monat. Herr Kolb,
für 800 Euro halten Sie doch noch nicht einmal einen Vortrag; um die Dimension deutlich zu machen.
Sie von der FDP und große Teile der CDU/CSU sind für diese Hungerlöhne persönlich mitverantwortlich.
Sie haben all die Jahre jede Form einer vernünftigen staatlichen Regelung blockiert. Das Ergebnis dieser Blockade sind diese Löhne. Sie haben sich hier hingestellt und gesagt, Mindestlöhne seien der Untergang des Abendlandes, Mindestlöhne würden die Marktwirtschaft ruinieren. Das war Ihre Propaganda. Aber heute, in den Fieberschüben der weltweiten Finanzkrise, in einer Zeit, in der Ihre marktradikale Welt am Abgrund taumelt, können Sie nicht schnell und laut genug nach dem Staat rufen. Sie messen mit zweierlei Maß. Das werden Ihnen die Leute aber nicht durchgehen lassen.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Frau Kollegin Pothmer, möchten Sie nun dem Kollegen Kolb Gelegenheit zur Fortsetzung seiner Propaganda geben?
Brigitte Pothmer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ich finde, er sollte die Frage stellen, und ich überlege mir dann, ob ich sie beantworte.
Dr. Heinrich L. Kolb (FDP):
Versuchen wir es einmal, Frau Kollegin Pothmer. Sie haben den Eindruck erweckt, die FDP sei schuld an allem Übel. Mir geht Folgendes durch den Kopf: Ich glaube mich zu erinnern, dass Sie nach 1998 acht Jahre lang in diesem Land regiert und die Verantwortung getragen haben. Können Sie mir noch einmal sagen, was die Gründe dafür waren, dass Rot-Grün damals keinen gesetzlichen Mindestlohn eingeführt hat?
Brigitte Pothmer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Wir haben schon zu rot-grünen Zeiten
Initiativen zur Einführung von Mindestlöhnen ergriffen. Damals haben wir uns leider nicht durchsetzen können.
Herr Kolb, Sie jedenfalls waren damals nicht an unserer Seite.
Herr Kolb, ich will Ihnen einmal sagen, welches Voting es zurzeit bei Spiegel-Online gibt. Da steht:
Die FDP hat sich stets für die freie Marktwirtschaft eingesetzt. Jetzt erschüttert eine Bankenkrise die ganze Welt. Muss die FDP jetzt verboten werden oder nicht?
Das Ergebnis dieses Votings sollten Sie sich einmal anschauen, bevor Sie in dieser Debatte weiterreden.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Sehr schön. Das nehmen wir als Zwischenruf zu Protokoll. - Im Übrigen bitte ich, ein bisschen daran zu denken, dass unsere heutige Sitzung, wenn es bei den Redezeiten bleibt, bis weit nach Mitternacht dauert. All das, was wir uns jetzt an Großzügigkeiten erlauben, geht auf Kosten der nachfolgenden Tagesordnungspunkte. Ein bisschen Disziplin würde ich im Interesse der nachfolgenden Kollegen erbitten.
Brigitte Pothmer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Mich können Sie damit nicht gemeint haben.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das bestätige ich ausdrücklich, Frau Kollegin.
Brigitte Pothmer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Meine Damen und Herren! Die politische Auseinandersetzung über den Mindestlohn in Deutschland ist, wenn Sie so wollen, ein Lehrstück. Jahrelang haben die Union und die FDP tatenlos zugesehen, wie sich der Niedriglohnsektor immer weiter ausgebreitet hat. Den Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, haben Sie einen Schutzschild verweigert.
Den von den Geringqualifizierten und Geringverdienenden so dringend gebrauchten Schutz haben Sie verweigert. Sie haben den Mindestlohn zerredet. Sie haben ihn denunziert. Sie haben ihn verzögert, und sie haben ihn blockiert.
Was den Geringverdienern an staatlichem Schutz über Jahre verwehrt wurde, kann für die Banken offensichtlich schon in 48 Stunden geregelt werden. Es ist schon erstaunlich, wie sich einige Propheten der Deregulierung angesichts der Zuspitzung der internationalen Finanzkrise heute zu entschiedenen Befürwortern von Staatsinterventionen gewandelt haben. Das muss man einfach einmal zur Kenntnis nehmen. Herr Kolb, es sind aber die gleichen Leute - das gilt auch heute wieder -, die eine Staatsintervention ablehnen, wenn es um den Mindestlohn geht, wenn es darum geht, die kleinen Leute zu schützen. Sie schreien: Das ist der Untergang des Abendlandes.
Dabei hat der Mindestlohn seine Praxistauglichkeit längst unter Beweis gestellt. Er hat sich bewährt. Ich sage es noch einmal ganz deutlich: Wir brauchen einen Mindestlohn in Deutschland, und zwar dringend. Ich befürchte allerdings, dass die vorgelegten Gesetzentwürfe nicht wirklich dabei helfen, dass wir diesem Ziel faktisch näherkommen. Das will die eine Seite dieses Hauses ganz offensichtlich auch gar nicht. Herr Oettinger stellt sich hin und sagt ganz freimütig: Ich will so wenig Mindestlohn wie möglich in so wenigen Branchen wie irgend möglich. - So sieht das Gesetz auch aus. Hier haben wir die Situation, dass die CDU ein Mindestlohngesetz zwar mitunterschreiben wird, aber dieses Gesetz davon gekennzeichnet ist, dass es so wenig wie möglich greift und so wenig wie möglich Anwendung finden wird.
Ich will das an ein paar Punkten deutlich machen. Welche Branchen jetzt tatsächlich zusätzlich ins Entsendegesetz aufgenommen werden, steht doch in den Sternen. Sie, Herr Struck, haben Anfang des Jahres immer wieder formuliert, Sie gingen davon aus, dass 4,4 Millionen Menschen von der Einführung des Mindestlohns profitieren werden. - Darauf deutet allerdings nichts, aber auch gar nichts hin. Bis jetzt haben sich acht Branchen gemeldet, das sind 1,7 Millionen Beschäftigte. Eine große Gruppe unter ihnen, nämlich 700 000 Menschen, sind Zeitarbeiter. Da hat aber die Union schon gesagt: Zeitarbeiter? Njet! Diese Gruppe wird nicht vom Gesetz erfasst. - Genau so wird das weitergehen. Eine Branche nach der anderen wird von Ihnen abgelehnt, weil Sie dieses Mindestlohngesetz, so wie das Oettinger formuliert, gar nicht wollen. Ich sage Ihnen: Auf diesem Gesetzentwurf steht zwar ?Scholz? drauf, aber da ist ?Glos? drin. Deswegen wird es auch keine Wirkung entfalten.
Ich komme zu einem weiteren Punkt, der hier schon angesprochen worden ist. Ich frage Sie: Was hat die berühmte Friseurin in Sachsen, die laut Tarifvertrag 3,06 Euro die Stunde verdient, von diesem Gesetz? Für diese junge Frau ändert sich nichts, aber auch gar nichts. Das liegt daran, dass Sie in diesem Gesetz festgeschrieben haben, dass bestehende Tarifverträge dauerhaft weiter bestehen und Vorrang vor den Regelungen zum Mindestlohn haben, selbst wenn die vereinbarten Löhne noch so niedrig sind.
So wird man jedenfalls keine existenzsichernden Löhne durchsetzen können.
Diese Politik kostet den Staat oder auch den Steuerzahler 1,5 Milliarden Euro im Jahr, weil diese Löhne aufgestockt werden müssen. In diesem Gesetz ist keine allgemeine Lohnuntergrenze vorgesehen. Deswegen wird das Gesetz in vielen Bereichen, wo es dringend gebraucht wird, nicht wirken.
Ich sage Ihnen: Für mich ist der Qualitätsmaßstab für dieses Gesetz der Wirkungsgrad. Die Frage ist also: Wie viele Menschen werden von den Regelungen dieses Gesetzes tatsächlich profitieren? Die Antwort ist: Dieses Gesetz hat den Wirkungsgrad eines alten Atommeilers. Es wird nicht wirklich etwas bringen. Wir werden das Gesetz nicht abschalten, sondern es verändern und verbessern. Wir werden Änderungsanträge zu unterschiedlichen Punkten stellen. Wir wollen eine allgemeine Lohnuntergrenze. Wir wollen die Einrichtung einer Mindestlohnkommission nach britischem Vorbild.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Frau Kollegin, ich hatte Sie vorhin leichtfertigerweise für die Einhaltung der Redezeit gelobt. Ich möchte Sie nun aber vorsichtig auf dieselbe hinweisen.
Brigitte Pothmer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Aber hier ist angezeigt, dass ich noch über eine Minute habe.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Umgekehrt.
Brigitte Pothmer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Dann komme ich jetzt zum Schluss. - Lassen Sie mich noch Folgendes sagen: Beim Mindestlohn geht es um mehr als eine gesetzliche Regelung für Niedriglohnempfänger. Der Mindestlohn ist auch ein Symbol für die Frage, ob die Politik bereit ist, sich als Schutzmacht der kleinen Leute einzusetzen.
Herr Brauksiepe, wenn Sie sagen, das sei ein urchristliches Anliegen, dann müssen Sie dieses Gesetz dringend verbessern.
Ich danke Ihnen.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, entsprechend dem Thema der Debatte will ich noch einmal darauf hinweisen, dass es sich bei den vereinbarten Redezeiten nicht um Mindestzeiten handelt.
Jetzt hat die Kollegin Nahles für die SPD-Fraktion das Wort.
Andrea Nahles (SPD):
Das ist jetzt natürlich eine schwere Bürde. - Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieses Thema passt gut in diese außerordentliche Woche, weil wir in dieser Woche ein Rettungspaket für die Banken, für unsere Wirtschaft und für unsere Unternehmen auf den Weg bringen müssen. Hinter dieses Rettungspaket gehört aus Sicht der Sozialdemokraten ein Doppelpunkt und kein Punkt, weil es auch darum gehen muss, die Schutzfunktion und die Stärke, die wir als Staat dem Bankensektor leihen, natürlich auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugute kommen zu lassen. Genau darum geht es beim Thema Mindestlohn und den Gesetzentwürfen, die hier heute auf dem Tisch liegen.
Ich denke zum Zweiten, dass wir mit den beiden Gesetzentwürfen einen großen Schritt machen. Ich bedanke mich ausdrücklich beim Bundesarbeitsminister dafür, dass er hier in der Ressortabstimmung eine solide Grundlage geschaffen hat. Wir haben nun die Chance, neben den 1,8 Millionen Menschen, die im Baubereich, in der Gebäudereinigung und im Postbereich bereits Mindestlohn haben, in diesem Jahr weiteren 1,6 Millionen Menschen den Schutz von Mindestlöhnen zu bieten. Darum muss es uns gehen.
Deswegen sagen wir für die SPD - auch an die Adresse unseres Koalitionspartners -, dass es darum gehen muss, die vereinbarten Kriterien in diesem Gesetz daraufhin zu prüfen, ob sie auf die acht Branchen, die sich gemeldet haben, passen. Nach unserer Einschätzung ist es so, dass diese acht Branchen die Kriterien erfüllen. Es gibt da noch einiges zu diskutieren. Aber wir - das ist die erste Prüfung, die wir gemacht haben - gehen davon aus, dass alle diese acht Branchen die Kriterien erfüllen und deswegen Mindestlöhne in acht Branchen eingeführt werden.
Ich bin froh, dass es Bewegung gibt. Denn wir haben hier eben über die Schuldfrage diskutiert: Wieso? Wer war schuld? - Ich muss hinzufügen: Ich war in der letzten Legislaturperiode nicht im Bundestag.
- Das war eine gute Zeit. Ich lasse mir dann einmal genauer berichten, Herr Niebel, wie das war. - Es geht hier aber nicht um Schuld, sondern um die Frage: Haben wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten in Deutschland Mindestlöhne gebraucht? Ich betone: Wir haben starke Sozialpartner, die für das Gemeinwohl und für soziale Demokratie gestanden haben. Wir hatten über Jahrzehnte eine hohe Tarifautonomie und hohe Tarifbindung. Ich kann mich gut erinnern, dass ich im Gewerkschaftsrat meiner Partei Monate gebraucht habe, um die verschiedenen Einzelgewerkschaften Ende 2005 beim Mindestlohn auf eine gemeinsame Position zu bringen. Erst in dem Moment, als klar wurde - auch meiner IG Metall, die in Lohngruppe 1 11 Euro Stundenlohn vorsieht,
und der IG BCE -, dass die Tarifbindung in vielen Branchen mittlerweile so schwach ist, dass starke Gewerkschaften ihre Kraft schwächeren leihen müssen, damit es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in diesem Land insgesamt besser geht, haben wir eine handlungsfähige Struktur branchenbezogener Mindestlöhne gemeinsam geschaffen.
Das scheint mir keine Schuldfrage zu sein, sondern eine Frage der Entwicklung in diesem Land. In Westdeutschland sind nur noch 52 Prozent und in Ostdeutschland nur noch 33 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei tarifgebundenen Arbeitgebern beschäftigt.
Was ist das für eine bittere Zahl? Das ist ein Rückgang um 14 Prozentpunkten in den letzten zehn Jahren. Der Sockelabbau in Westdeutschland ist immer noch nicht gestoppt. Deswegen brauchen wir flächendeckende Mindestlöhne in diesem Land.
Ich weise darauf hin, dass es auch keine - man könnte ja sagen, man hätte das durch Haustarifverträge auffangen können - Zunahme von Haustarifverträgen gibt. Das wäre ja noch eine Möglichkeit, aber auch das ist nicht der Fall. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir da, wo es besonders dringend ist, zum Beispiel in der Zeitarbeitsbranche, den Unterbietungswettbewerb bei den Löhnen stoppen. Keine Branche erfüllt die Kriterien unserer Gesetze so einwandfrei wie die Zeitarbeitsbranche.
Deswegen gibt es überhaupt keinen Grund, warum diese Branche nicht einbezogen werden sollte.
Ich bin an dieser Stelle so frei und zitiere jetzt die Vollversammlung des Katholikenrates aus meinem Bistum Trier.
Der Katholikenrat des Bistums Trier schreibt:
Es gilt zu verhindern, dass Lohndumping zum dominierenden Geschäftsmodell wird und die Skrupellosen die Sozialstandards in unserem Land bestimmen.
Das ist genau das, worum es in dieser Frage geht.
Wir haben die Beschäftigungsschwelle in den letzten Jahren gesenkt; das ist auch gut so. Das wird in den nächsten Jahren, in denen es wahrscheinlich eine wirtschaftliche Stagnation, wenn nichts Schlimmeres geben wird, wichtig sein. Ich stehe dazu, dass wir die Beschäftigungsschwelle gesenkt haben. Wir haben aber niemals das Ziel von Armutslöhnen verfolgt. Im Gegenteil, zu Zeiten von Rot-Grün haben wir Armutslöhne immer bekämpft. Das sage ich, damit auch das hier ein für allemal klargestellt ist.
Eine weitere Branche, die für uns wichtig ist, ist der Pflegebereich. Ich freue mich, dass Herr Neher, der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, eine angemessene Bezahlung im Pflegebereich im letzten Monat ausdrücklich begrüßt hat. In dieser Frage brauchen wir die Kirchen, um das Kriterium der 50-prozentigen Tarifbindung zu erfüllen. Im Pflegebereich besteht Regulierungsbedarf; das stellen mittlerweile alle fest. Daher appelliere ich an die Beteiligten: Jetzt müssen sich alle aufeinander zubewegen - auch Verdi und die Kirchen -, damit wir eine Lösung für die 600 000 Menschen im Pflegebereich finden.
In Richtung FDP möchte ich sagen: Wettbewerb ist immer gut. Aber Wettbewerb auf Kosten der Pflegebedürftigen darf es in diesem Land nicht geben. Deswegen ist es dringend erforderlich, dass wir für den Pflegebereich einen Mindestlohn organisieren.
Ich komme zum Schluss. Ab dem Jahr 2011 wird die volle Freizügigkeit gelten; das ist nicht mit FKK zu verwechseln,
sondern dabei handelt es sich um einen europäischen Binnenmarkt für Arbeitskräfte. Als ich neulich beim Zentralverband des Deutschen Handwerks war, habe ich erstaunlicherweise festgestellt, dass sehr wohl viele Handwerker und Handwerksbetriebe Mindestlöhne befürworten, und zwar deshalb, weil dadurch Wettbewerbsverzerrungen verhindert werden können. Beim Mindestlohn geht es nämlich auch darum, die Mittelständler zu schützen, auch im Hinblick auf den ab 2011 geltenden europäischen Arbeitsmarkt.
Die Anträge liegen auf dem Tisch, und die Argumente sind bekannt. Nun geht es nur noch darum, zu prüfen, ob die erforderlichen Kriterien erfüllt werden oder nicht. Jetzt müssen sich diejenigen, die wir dazu aufgefordert haben, Anträge zu stellen, auch darauf verlassen können, dass wir die Kriterien sauber prüfen und den Anträgen dann, wenn die Kriterien erfüllt sind, auch zustimmen. Im Übrigen brauchen wir einen flächendeckenden Mindestlohn.
Vielen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nun hat der Kollege Dirk Niebel das Wort für die FDP-Fraktion.
Dirk Niebel (FDP):
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Diskussion über die beiden Mindestlohngesetze, die die Bundesregierung heute vorlegt, zeigt, was im nächsten Jahr auf die Menschen in diesem Land zukommen wird.
Es kommt zu einem ideologischen Schlagabtausch mit einem Wettbewerb darum, wer am meisten zu bieten hat. All denen, die den Linken auf den Leim gehen, sage ich: Sie können gar nicht so schnell rennen, wie die schon unterwegs sind. Egal was die vorschlagen, Sie werden mit Ihren Vorschlägen immer darunter bleiben. Deswegen sollten wir wieder ein bisschen wirtschaftspolitische Vernunft in diese Diskussion einbringen.
Auch wenn Frau Nahles sagt, der geringe Organisationsgrad im Osten gebiete zur Stärkung der Tarifautonomie Mindestlöhne,
bleibt es ein Fakt, dass man mit Mindestlöhnen keinen Menschen motiviert, in eine Gewerkschaft einzutreten.
Denn warum sollte man sich noch von einer Gewerkschaft vertreten lassen, wenn es schon der Staat macht?
Auf der anderen Seite - das kennzeichne ich gerne als Werbeblock -: Wer sich die Rede der Kollegin Pothmer angehört hat, hat festgestellt, dass die Stimme der Bürgerinnen und Bürger bei der FDP offenkundig am besten angelegt ist. All das, was wir hier durchgesetzt oder verhindert haben, obwohl wir schon seit zehn Jahren gar nicht mehr regieren, zeigt, dass wir wirklich eine sehr effiziente Politik machen.
Was Sie uns dargeboten haben, ist realitätsfern.
Es bleibt dabei: Mindestlöhne sind maximaler Unsinn. Wenn sie zu niedrig sind, wirken sie nicht. Wenn sie zu hoch sind, vernichten sie Arbeitsplätze in der legalen Wirtschaft im Inland, gerade solche für Geringqualifizierte oder diejenigen Menschen, denen wir am ehesten eine Chance geben sollten, in Arbeit zu kommen.
Ich kann Ihnen das auch begründen, liebe Kollegin Pothmer. Ich weiß ja, dass man, wenn man bei den Grünen ist, jetzt mächtig nach links rücken muss. An den Wahlergebnissen Ihres Fraktionsvorsitzenden in Baden-Württemberg wird deutlich, dass man bei den Grünen nur noch als Linker wieder aufgestellt wird.
Fakt ist, dass ein Arbeitgeber, egal wie sozial er eingestellt ist, einem Arbeitnehmer nicht mehr Geld zahlen kann, als dieser erwirtschaftet. Das ist vielleicht über einen begrenzten Zeitraum möglich. Wenn der Arbeitgeber dies aber zu lange macht, gefährdet er dadurch alle anderen Arbeitsplätze in seinem Betrieb. Das ist unsozial.
Eine ideologisierte Diskussion bringt uns an dieser Stelle nicht weiter.
Jeder in diesem Haus, wahrscheinlich auch jeder Fernsehzuschauer und jeder Besucher auf der Tribüne würde doch emotional den Satz unterstützen: Wer arbeitet, soll von seinem Lohn leben können. Das ist doch nicht der Punkt. Der Punkt ist doch, dass jeder Mensch eine bestimmte Produktivität hat. Es gibt allerdings Menschen - das sind gar keine schlechten Menschen, sondern welche, um die wir uns kümmern müssen -, die mit ihrer Produktivität nicht die Wirtschaftsleistung erzielen können, die wir für ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben als ausreichend ansehen. Deswegen haben wir das Arbeitslosengeld II als Ergänzung. Das ist faktisch der Mindestlohn in Deutschland.
- Sie können sehr gerne eine Zwischenfrage stellen.
Es wird darüber lamentiert, dass es in Deutschland Aufstocker gibt. Hier müssen wir mehr Seriosität in die Diskussion bringen. Wenn jemand Vollzeit arbeitet und zusätzlich Arbeitslosengeld II benötigt, dann wird das von Ihnen beklagt, weil er nicht von seinem eigenen Lohn leben kann. Fakt ist allerdings, dass die Hälfte der vollzeitbeschäftigten Aufstocker einen Stundenlohn von 9 Euro und mehr hat und dass insgesamt zwei Drittel der Aufstocker einen Stundenlohn von über 7,50 Euro haben; das stellt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung fest.
Höchstens 15 000 vollzeitbeschäftigte alleinstehende Menschen haben einen zu geringen Stundenlohn und müssen deshalb aufstocken.
Jetzt lassen Sie uns einmal ehrlich sein. Es geht doch gar nicht um Mindestlöhne. Was nützt einem ein hoher Bruttomindestlohn, wenn netto zu wenig übrig bleibt? - Es geht um den Nettolohn. Diese Netto-Frage müssen wir beantworten,
und gerade jetzt müssen wir den Menschen und Betrieben mehr vom selbst verdienten Geld übrig lassen. Gerade jetzt dürfen wir nicht den Fehler begehen, vor dem Hintergrund der Finanzkrise plötzliche alle Schleusen zu öffnen. Jetzt müssen die Bürger entlastet werden. Jetzt brauchen wir eine Diskussion über Mindesteinkünfte, nicht aber über Mindestlöhne.
Die Liberalen haben hierfür einen Vorschlag gemacht. Wir nennen das unser liberales bedarfsorientiertes Bürgergeld. Es ist eine Verbindung des Steuersystems mit dem Transfersystem, bei der die steuerfinanzierten Transferleistungen, die es heute ohnehin schon gibt - diese werden von 136 verschiedenen Leistungen gespeist und von über 40 Behörden verwaltet werden -, mit dem Steuersystem kombiniert werden.
Ich sage ausdrücklich, dass es ein bedarfsorientiertes Bürgergeld ist. Es soll kein bedingungsloses Grundeinkommen sein. Bedingungslosigkeit ist leistungsfeindlich. Bedingungslosigkeit bedeutet nämlich, dass der Lotto-Millionär genauso von den Steuergeldern der Fleischereifachverkäuferin profitieren könnte wie derjenige, der hartnäckig Arbeit verweigert. Deswegen wollen wir eine Bedarfsorientierung beim Bürgergeld.
In diesem Punkt hat sich der abgewählte Kanzler, der Gasmann aus Hannover, einmal geirrt. Er hat hier einmal gesagt, es gebe kein Recht auf Faulheit. Das stimmt natürlich nicht. In einer freien Gesellschaft gibt es ausdrücklich auch ein Recht auf Faulheit.
Es gibt allerdings nicht den Anspruch darauf, dass die Allgemeinheit die Faulheit finanzieren muss. Und das spricht für die Bedarfsorientierung und gegen die Bedingungslosigkeit.
Wir brauchen ein Mindesteinkommen, das in einem kombinierten Steuer- und Transfersystem das soziokulturelle Existenzminimum gewährleistet, Anreize schafft, eine Arbeit auch dann, wenn sie gering entlohnt ist, aufzunehmen, und die Chance eröffnet, durch eigene Leistung in diesem System aus der Transferleistung herauszukommen und in die Steuerpflicht hineinzuwachsen und sich den größten Teil seines Lebensunterhaltes durch eigene Arbeit zu finanzieren.
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, sage ich mit vollem Selbstbewusstsein: Die Freie Demokratische Partei ist die Partei der sozialen Verantwortung,
weil wir dafür sorgen wollen, dass sich die Menschen mit ihrer eigenen Hände Arbeit zumindest teilweise selbst finanzieren können. Deswegen brauchen wir dieses Bürgergeld als kombiniertes Steuer- und Transfersystem, wie wir es vorschlagen.
Vielen herzlichen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, da es eine eigendynamische Entwicklung von Zwischenfragen und Kurzinterventionsmeldungen gibt, möchte in aller Ruhe auf Folgendes aufmerksam machen: Wir haben zu Beginn dieser Debatte 90 Minuten Redezeit vereinbart; diese sind jetzt fast vorbei. Mir liegen jetzt noch angemeldete vereinbarte Redezeiten von fast einer halben Stunde vor.
Wir können natürlich so verfahren, dass wir gewissermaßen die selbst getroffenen Vereinbarungen zur Redezeit schon beim ersten Tagesordnungspunkt atomisieren. Dann dürfen wir uns jedoch nicht darüber beklagen, dass wir am Ende nicht in der Lage sind, eine Tagesordnung abzuwickeln, die wir miteinander vereinbart haben.
Deswegen werde ich jetzt restriktiv mit der Zulassung solcher Zwischenfragen und Kurzinterventionen umgehen, die mir nicht in jedem Fall zwingend erforderlich erscheinen.
Nun hat der Kollege Max Straubinger für die CDU/CSU-Fraktion das Wort.
Max Straubinger (CDU/CSU):
Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Dass gesetzliche Rahmenbedingungen notwendig sind, zeigen die bevorstehenden Beschlüsse dieser Woche, und hier pflichte ich ausdrücklich bei, dass diese für viele Bereiche in unserem Leben, in unserer Gesellschaft und sicherlich auch für einzelne Bereiche unseres Arbeitsmarktes notwendig sind.
Ich möchte mit dem beginnen, was der Kollege Brauksiepe bereits dargestellt hat: Den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, den Schutz der Arbeitsplätze in unserem Land und den Schutz eines guten und ausreichenden Einkommens für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erreicht man dadurch, eine gute Wirtschaftspolitik zu betreiben, wie das die Bundesregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundeswirtschaftsminister Michael Glos auch getan haben, indem sie die Grundlagen dafür gelegt haben, dass jetzt 2 Millionen Arbeitslose weniger als vor drei Jahren, zu Beginn der Arbeit dieser Bundesregierung, zu verzeichnen sind. Dies ist meines Erachtens etwas Entscheidendes, das immer wieder darzustellen ist.
In der Vergangenheit und auch in der heutigen Diskussion ist in manchen Redebeiträgen angeklungen, dass niedrige Löhne Armut bedeuten und dass Armut bekämpft werden muss, worin wir alle übereinstimmen. Ich sage aber auch ganz deutlich: Die Lohnpolitik kann die Sozialpolitik nicht ersetzen; denn die Lohnpolitik - hier stimme ich durchaus mit dem Kollegen Niebel überein - muss sich an der Produktivität in unserem Land orientieren.
Dies ist sicherlich eine Grundlage dafür, dass es vernünftige Löhne gibt. Diese wird es nur mit starken Tarifpartnern geben. Es gilt, diese in unserem Land zu stärken. Damit es in Deutschland eine gute Lohnfindung für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben kann, sind die Gewerkschaften genauso wie die Tarifpartner der Arbeitgeber zu stärken.
Deshalb sagen wir Ja zu gesetzlichen Rahmenbedingungen, zu den Möglichkeiten nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz und zu den Möglichkeiten nach dem Gesetz über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen. In der Vergangenheit haben viele Parteien hier gesagt, dies mitregeln zu wollen. Das gilt nicht nur für die CDU als soziale Partei, für die CSU als soziale Partei und für die SPD, sondern genauso hat auch die FDP
hier in der Vergangenheit ihren Beitrag geleistet. Der Kollege Brauksiepe hat das bereits dargestellt: Auch der ehemalige Staatssekretär Heinrich Kolb hat hier seinen Beitrag geleistet.
Das gilt es jetzt fortzusetzen, und zwar mit diesen beiden Gesetzentwürfen, die heute vorgestellt worden sind. Ich möchte ausdrücklich festhalten: Durch sie muss und wird eine Stärkung der Tarifautonomie bewirkt werden. Die Tarifpartner sind aufgefordert, besonders darauf zu achten, auch zukünftig gute und vernünftige Tarifabschlüsse im Sinne der Beschäftigung und der Beschäftigten zu erreichen.
Deshalb wenden wir uns dezidiert gegen gesetzliche Mindestlöhne, die von einem Gesetzgeber verordnet werden, der weit von der Tariflandschaft entfernt ist. Kollege Brauksiepe hat das ja dargestellt: Im Westen gibt es eine andere Situation als im Osten, der an die östlichen Länder in Europa grenzt. Darum gibt es auch eine sehr differenzierte Tariflandschaft, in die kein hoher gesetzlicher Mindestlohn passt, sondern es muss differenzierte Möglichkeiten geben.
Ich glaube, mit dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz gibt es die beste Möglichkeit, dies auf Branchen abzustellen und die einzelnen Erfordernisse in diesen Branchen aufzunehmen, um sicherlich auch gesetzliche Unterregelungen zu treffen, wobei aber auch festzustellen ist: Es gibt Branchen, für die wir gesetzliche Unterregelungen und Mindestregelungen getroffen haben. Dadurch wird aber noch lange nicht garantiert, dass damit auch die Arbeitsplätze erhalten werden. In der Bauindustrie hat sich die Anzahl der Arbeitsplätze halbiert, obwohl es eine Entsenderegelung gibt. Das muss man einfach sehen.
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass eine sogenannte Mindestregelung nicht unbedingt auch eine Schutzfunktion beinhaltet. Da die Rednerinnen und Redner heute vielfältig dargelegt haben, dass es in vielen europäischen Ländern einen gesetzlichen Mindestlohn gibt, möchte ich fragen, welche Auswirkungen solche gesetzlichen Mindestlöhne haben. Frankreich wurde heute häufig angeführt. Man muss einfach feststellen, dass in Frankreich eine weit höhere Arbeitslosigkeit als in Deutschland zu verzeichnen ist.
In Frankreich ist vor allen Dingen eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit zu verzeichnen.
Auch das zeigt sehr deutlich, dass hohe Mindestlöhne ein Eintrittshemmnis ins Erwerbsleben bedeuten können. Ich bin überzeugt, dass dies letztlich eine Tatsache ist. Es kann doch nicht so weit gehen, dass zwar wie mittlerweile in Frankreich ein hoher gesetzlicher Mindestlohn garantiert ist, aber kleine und mittlere Betriebe vom Staat bei der Zahlung der Mindestlöhne unterstützt werden müssen, um Beschäftigung zu sichern. Ich glaube, das wäre eine weitere Fehlleistung in der Festsetzung von gesetzlichen Rahmenbedingungen. Deshalb werden wir die beiden Gesetzentwürfe in den kommenden Wochen und Monaten sehr intensiv diskutieren und herausfinden, welche Branchen mit aufgenommen werden müssen. Hier gibt es keinen Automatismus. Wir werden sicherlich gute und vernünftige Lösungen dafür finden.
Ich fordere alle auf und bitte Sie, sich an der Diskussion zu beteiligen. Es geht darum, den Menschen eine gute Grundlage für sichere Arbeitsverhältnisse in unserem Land zu schaffen. Damit dürfen aber wirtschaftliche Möglichkeiten nicht abgewürgt werden. Die Wirtschaft muss weiter einen Aufschwung erleben, damit die Arbeitsplätze gesichert werden.
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Die Kollegin Kramme ist die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion.
Anette Kramme (SPD):
Sehr geehrter Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir setzen heute Grundpfeiler für Mindestlöhne in Deutschland. Wir können auf der Aufgabenliste, die wir als Koalition vereinbart haben, einen weiteren Haken machen. Es ist ein sozialer Fortschritt für den Arbeitsmarkt, und es ist ein Erfolg für die Koalition, vor allen Dingen für den sozialdemokratischen Teil dieser Großen Koalition.
Vor einigen Tagen hat mir ein kleines Mädchen ihr Freundschaftsbuch gereicht. Beim Durchblättern bin ich auf den Eintrag ihres Lehrers gestoßen. Darin stand ein Satz, den ich schön fand: ?Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.? Diese Weisheit erinnert ein wenig an die Verfahrensabläufe beim Arbeitnehmer-Entsendegesetz und beim Mindestarbeitsbedingungengesetz.
Beide Gesetze wurden schon vor einiger Zeit auf den Weg gebracht: Das eine Pflänzchen wurde in den 50er-Jahren, das andere in den 90er-Jahren gesetzt. Das eine kümmerte ein wenig vor sich hin; das andere wuchs unter der sozialdemokratischen Regierung recht ordentlich. Bundesarbeitsminister Olaf Scholz hat die Pflänzchen nun eifrig gegossen, um ihnen zu einem besseren Gedeihen zu verhelfen.
Die Opposition hat Anträge gestellt. Sie hat sozusagen an den Halmen gezogen, und trotzdem erfolgte das Wachstum nicht schneller. Die Arbeitgeberverbände und die Union, insbesondere Bundesminister Glos, trampelten auf der Wiese und versuchten, den Rasen möglichst kurz zu mähen.
Die klimatischen und politischen Bedingungen waren nicht ganz einfach. Aber nun - kurz nach dem Erntedankfest - sehen wir einige Fortschritte: Der Rasen sieht sehr ordentlich aus. Von blühenden Landschaften zu sprechen, ist vielleicht ein wenig vorschnell, aber es bleibt festzuhalten: Unser Rasen steht in saftigem, fettem Grün.
Es ist auch höchste Zeit, dass wir etwas tun. Millionen von Arbeitnehmern erhalten Armutslöhne. 6 Prozent der Erwerbstätigen sind arm. 370 000 Vollzeitarbeitnehmer beziehen zusätzlich zum Lohn Leistungen nach dem SGB II.
Niemand kann vor diesen Fakten seine Augen verschließen. Niemand - auch Sie nicht, Herr Kolb - kann behaupten, dass kein Handlungsbedarf besteht. Niemand kann gegen eine Ordnung des Niedriglohnsektors sein. Eine solche Ignoranz, Herr Kolb, wäre einfach nur zynisch.
Selbst in Zeiten des Aufschwungs ist der Niedriglohnsektor nicht wesentlich kleiner geworden. Wir haben es nun mit einer sich ausweitenden Finanzmarktkrise zu tun. Möglicherweise droht eine Rezession. Wir als Politiker haben die Verantwortung, dagegen Vorsorge zu treffen. Dazu gehören auch Mindestlöhne. Ist es nicht sehr schön, eine große Mehrheit der Bevölkerung hinter sich zu wissen? 80 Prozent der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland wollen Mindestlöhne.
Sie wollen keine ideologische Blockadehaltung, wie sie hier manchmal zu sehen ist.
Die Grundsätze des Mindestarbeitsbedingungengesetzes und des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes sind bekannt. Weniger als 50 Prozent Tarifbindung bedeutet Mindestarbeitsbedingungengesetz. Mehr als 50 Prozent Tarifbindung bedeutet Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Wir nehmen keine politische Lohnfestsetzung vor. Ich finde, das gehört sich aus Respekt vor den Gewerkschaften und der Wirtschaft so. Nach dem Mindestarbeitsbedingungengesetz wird der Hauptausschuss mit Gewerkschaftern und Vertretern der Wirtschaft besetzt. Gleiches gilt für den kleineren Ausschuss, der die Höhe der Mindestlöhne festsetzt. Nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz gilt Ähnliches. Gewerkschafter und Arbeitgeber beantragen die Allgemeinverbindlichkeitserklärung eines zuvor gemeinsam abgeschlossenen Tarifvertrages. Mindestlöhne liegen auch im Interesse der Arbeitgeber, nämlich solcher, die anständige Löhne zahlen wollen
und die Sorge wegen der Dumpingkonkurrenz haben, die ihnen gegenübertritt. Wirtschaftlicher Erfolg in der Bundesrepublik Deutschland darf nicht auf Ausbeutung von Menschen beruhen.
Beide Gesetze sind geeignete Instrumente gegen Armutslöhne. Wir müssen nun die Klaviatur spielen, müssen die Instrumente nutzen. Das bedeutet, dass wir drei Dinge vorzunehmen haben. Erstens. Wir müssen die vorliegenden Gesetzentwürfe verabschieden. Zweitens. Wir müssen schnellstmöglich die Ausschüsse nach dem Mindestarbeitsbedingungengesetz einsetzen. Drittens. Alle Branchen, die Anträge gestellt haben, müssen - vor allen Dingen das ist relevant - in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz aufgenommen werden.
Herr Brauksiepe, Sie haben gesagt, ein Mindestlohn sei bei der Zeitarbeit wegen der hohen Tarifbindung nicht erforderlich. Dazu kann ich nur sagen: Das stimmte vielleicht, wenn vermeintliche Gewerkschaften gewerkschaftlichen Aufgaben nachkämen, wenn es in diesen Gewerkschaften Arbeitnehmer gäbe, die für ihre Interessen auch streikten. Wenn sie aber lediglich Erfüllungsgehilfen der Arbeitgeber sind, dann macht man den Bock zum Gärtner.
In diesem Sinne ganz herzlichen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält der Kollege Paul Lehrieder, CDU/CSU-Fraktion.
Paul Lehrieder (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Damen und Herren! Politik beginnt mit der Betrachtung der Realität. Ich möchte noch ein Sprichwort voranstellen: Halbwahrheiten sind oft schlimmer als Lügen. Wir haben in der Diskussion sehr viel von Mindestlöhnen - diese gibt es bereits in Deutschland - gehört. Herr Dreibus, Sie haben moniert, dass die Lohnhöhe nicht gesetzlich geregelt ist, und haben mehrfach - völlig zu Recht - auf den französischen Mindestlohn in Höhe von 8,71 Euro hingewiesen. Der Kollege Niebel hat gesagt, jeder solle von seinem Lohn leben können. Wir sollten das Ganze näher betrachten. Gerade für die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne und an den Fernsehgeräten bedarf es der Klarstellung. Wir müssen definieren, wer mit ?jeder? gemeint ist. Haben Sie damit den alleinstehenden, vollbeschäftigten Single gemeint? Dann haben Sie recht. Diesem können Sie mit 8,71 Euro - ich gehe noch etwas weiter und verweise auf den luxemburgischen Mindestlohn in Höhe von 9,30 Euro - eine Existenzsicherung verschaffen. Es geht aber auch um den Familienvater, dessen Frau wegen der Erziehung der minderjährigen Kinder - das gibt es noch in Deutschland - zu Hause bleibt. Dieser würde mit dem französischen Mindestlohn in Höhe von 8,71 Euro und erst recht mit dem luxemburgischen Mindestlohn in Höhe von 9,30 Euro in Deutschland besser fahren. Er bekäme in Deutschland zu den 9,30 Euro als Aufstocker noch etwa 3 Euro hinzu. Das heißt, wenn wir über die Höhe des Mindestlohns diskutieren - egal ob es um 8,71 Euro, 9,30 Euro oder sogar um 9,50 Euro geht -, dann geht es immer nur um den alleinstehenden Singlehaushalt.
Frau Pothmer, Sie haben ausgeführt, durch unsere restriktive Haltung gegenüber dem Mindestlohn würden wir Geringverdienern den Schutz verweigern. Sie haben zur Höhe des Mindestlohns wohlweislich nichts gesagt. Sie haben die Problematik offensichtlich erkannt. Wir sagen dazu: Die Geringverdiener sind - so glaube ich - in keinem europäischen Land, egal ob dort ein Mindestlohn existiert oder nicht - im Übrigen liegen die Mindestlöhne zum Teil bei 1 Euro oder wie im Falle von Rumänien sogar bei unter 1 Euro -, besser geschützt als in Deutschland, und zwar durch die Sozialgesetzgebung, durch SGB II und die Regelung über die Aufstocker.
- Da kann man gerne einmal klatschen. - Diese Große Koalition hat das SGB II weiterentwickelt. Wir haben den Kinderzuschlag entfristet. Wir haben hier in diesem Hohen Hause vor wenigen Wochen eine weitere Sicherungsschranke eingezogen, damit Familien mit Kindern nicht in SGB-II-Bezug geraten. Das gehört zur politischen Ehrlichkeit. Dann können wir gemeinsam miteinander diskutieren. Der Mindestlohn muss sich per definitionem auf Alleinstehende, auf vollbeschäftigte Singles beziehen.
Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren tiefgreifend gewandelt. Das ist uns allen bewusst. Jeder Wandel bringt aber auch Verwerfungen mit sich. Auch die Tarifvertragsparteien sind von den Verwerfungen der letzten Jahre nicht verschont geblieben. Die Vorredner haben bereits darauf hingewiesen. Immer mehr Arbeitgeber kehren den Arbeitgeberverbänden den Rücken, in den Gewerkschaften organisieren sich immer weniger Arbeitnehmer. Herr Arbeitsminister Scholz hat diese Entwicklung in seiner Eingangsrede zu Recht moniert. In manchen Branchen sind deshalb die Tarifvertragsparteien längst nicht mehr repräsentativ für alle Beschäftigten. Diese Situation haben leider einzelne Arbeitgeber teilweise zu Lohndumping ausgenutzt. Das müssen wir feststellen.
Die Große Koalition tut nun etwas dagegen. Anstelle der von unserem Koalitionspartner geforderten Einführung von flächendeckenden gesetzlichen Mindestlöhnen halten wir den Weg, über das Arbeitnehmer-Entsendegesetz und das Mindestarbeitsbedingungengesetz bei Verwerfungen in einzelnen Branchen Lohnuntergrenzen einzuziehen, die mit den Tarifvertragsparteien abzustimmen sind, für den richtigen Weg. Die Mittel liegen in Gestalt des Mindestarbeitsbedingungengesetzes und des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes heute zur ersten Lesung vor. Bereits im Koalitionsvertrag von Union und SPD findet sich das Ziel, entschieden gegen Billiglohnkonkurrenz aus dem Ausland, Dumpinglöhne und ruinöse Konkurrenz für mittelständische Betriebe vorzugehen. Wir wollen verhindern, dass unfairer Wettbewerb insbesondere die hier ansässigen kleinen und mittleren Unternehmen und damit eine große Zahl von Arbeitsplätzen gefährdet. Für die Union haben der Schutz der Tarifautonomie und ein fairer Wettbewerb Vorrang vor staatlicher Lohnfestsetzung. Es ist unser Ziel, mit dem bisherigen Vorgehen in Bezug auf tarifvertragliche Mindestlohnvereinbarungen die Tarifvertragsparteien zu stärken. Wir wollen und dürfen sie nicht ersetzen. Wenn es darum gehen soll, sittenwidrig niedrige Löhne für die Zukunft unmöglich zu machen, muss die Politik gemeinsam - ich betone: gemeinsam - mit den Tarifpartnern einen Teil der Verantwortung tragen. Dies muss aber schonend und vor allem in solchen Branchen geschehen, in denen nachweislich soziale Verwerfungen drohen.
Allerdings haben wir in der Baubranche sehen können, dass das Entsendegesetz und tarifliche Mindestlöhne keine Allheilmittel gegen Arbeitsplatzabbau und rechtswidrige Dumpinglöhne sein können. Hier zeigt sich deutlich, wie in den letzten Tagen auch in anderen Wirtschaftsbereichen, dass wir nicht alles dem freien Markt überlassen können. Politik kann über Gesetze Kontroll-, Evaluations- und Sanktionsmöglichkeiten eröffnen und so für Rechtssicherheit sorgen.
Das Mindestarbeitsbedingungengesetz schiebt Versuchen einen Riegel vor, Arbeitnehmer zum Verzicht auf ein festgesetztes Mindestarbeitsentgelt zu drängen. Ein solches Vorgehen ist grundsätzlich nur im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs zulässig. Es ist ausgeschlossen, dass ein Beschäftigter seinen Anspruch auf das Mindestarbeitsentgelt verwirkt. Die beiden uns hier vorliegenden Gesetzentwürfe sind im Kampf gegen sittenwidrige Löhne unverzichtbar. Sie achten die Tarifautonomie - es ist erstaunlich, dass wir für die Tarifautonomie mehr kämpfen müssen als manche andere Parteien in diesem Hohen Hause - und bieten Rechtssicherheit in einer sich verändernden Arbeitswelt. Das Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen für die einzelnen Branchen der acht angemeldeten Berufsgruppen wird nunmehr nach der ersten Lesung im Verfahren zu prüfen sein. Die Kolleginnen und Kollegen der Opposition sollten ohne ideologische Scheuklappen anerkennen, dass es zu den Vorschlägen der Großen Koalition keine ernstzunehmende Alternative gibt.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Laurenz Meyer für die CDU/CSU-Fraktion.
Laurenz Meyer (Hamm) (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mir diese Debatte ganz in Ruhe angehört und einfach einmal auf mich wirken lassen. Ich muss als Erstes sagen: Ich verstehe überhaupt nicht, warum ein Großteil der Kollegen hier meint - man begründet dies damit, dass man sich für Mindestlöhne ausspricht -, unser Land so schlecht machen zu müssen. Die Debatte hat gezeigt: In keinem einzigen anderen europäischen Land ist die soziale Absicherung eines Großteils der Arbeitnehmer, zumindest aller Familien, besser als in Deutschland.
Das liegt daran, dass wir das Thema Mindestlohn nicht isoliert betrachten. Für die Höhe der Mindestlöhne ist für uns nicht ausschließlich die Höhe des Mindestlohnes von Alleinstehenden ausschlaggebend. Wir haben in Deutschland Lösungen gefunden, die viel sozialer sind - das sage ich auch an die Adresse der Linken - als in allen anderen Ländern. Wir haben sogar Lösungen gefunden, die der Situation der Familien Rechnung tragen.
Mancher von denen, die Vollzeit arbeiten, bekommt leider Gottes immer noch einen Schock - stellen Sie in Ihren Veranstaltungen einmal entsprechende Fragen -, wenn er hört, dass er, Familienvater von zwei Kindern, möglicherweise mehr Einkommen hätte, wenn er nicht arbeitete. In meiner Heimatstadt kann man monatlich - ohne die vielen Ranken, die es da gibt - bis zu 1 900 Euro an Sozialleistungen bekommen. Das liegt weit über den Beträgen, die Sie eben angesprochen haben. Angesichts dessen fragt mich mancher Arbeitnehmer: Warum mache ich das denn eigentlich?
Wir sollten die ganze Debatte hier mit einem Kompliment an all diejenigen verbinden, die jeden Morgen zur Arbeit gehen, obwohl sie die sozialen Bedingungen in unserem Land kennen. Eigentlich müsste man ihnen am Werktor jeden Morgen die Hand geben und sie dafür loben, dass sie so viel Ehre im Leib haben und jeden Morgen pünktlich zur Arbeit erscheinen.
Das ist das soziale Deutschland, das über 50 Jahre gewachsen ist. Ich lehne es für unsere Fraktion einfach ab, dass das schlechtgeredet wird, nur um immer wieder kurzfristig Populismus zu betreiben.
Sie - das muss ich an die Adresse der Kollegin Kramme sagen - haben von 370 000 Vollzeitbeschäftigten gesprochen. Davon sind ungefähr - nur von denen reden wir - 50 000 alleinstehend. Den anderen 320 000 würden Sie mit der Umsetzung der Vorschläge, die wir heute besprechen, nicht helfen.
Das müssen wir einfach einmal sagen. Die große Mehrheit, auch der Vollzeitbeschäftigten, ist von dem, was hier debattiert wird, gar nicht betroffen.
Mehr als die Hälfte der Aufstocker - 1,2 Millionen; Herr Scholz, Sie verweisen immer wieder auf diese Zahl - ist teilzeitbeschäftigt. Diese Menschen haben 400-Euro-Jobs oder 100- bis 200-Euro-Mini-/Midijobs. Ihnen kann man auch mit einem noch so hohen Mindestlohn nicht helfen.
- Hallo, Entschuldigung! Wollen Sie den Mindestlohn wirklich so festsetzen, dass man mit zehn Stunden im Monat aus der Aufstockerposition herauskommt? Nun fangen Sie hier doch nicht an zu spinnen und durchzudrehen. Das ist nun wirklich nicht der Punkt.
Ich bin froh, dass wir hier die Frage diskutieren: Was wollen wir eigentlich? Wir haben zwei Ebenen der Diskussion. Die eine Ebene sind die Gesetzentwürfe als solche; darüber diskutieren wir heute. Die andere Ebene ist die Ausfüllung der Gesetzentwürfe.
Ich sage zu den Gesetzentwürfen als solchen eines - das ist auch in der Debatte deutlich geworden -: Mit uns werden bestehende und zukünftige Tarifverträge nicht außer Kraft gesetzt. Wir werden bei der Beratung der Gesetzentwürfe erhebliche Diskussionen zu führen haben.
Zum Zweiten - da besteht eine Parallele zu den Diskussionen um unsere Finanzverfassung -: Die soziale Marktwirtschaft setzt einen Ordnungsrahmen gegen Egoismen. In dieser Diskussion gibt es eine ganze Menge verschiedener Egoismen. Wir dürfen da nicht auf einem Auge blind sein. Es gibt Arbeitgeber, die die Notlage von Arbeitnehmern mit Dumpinglöhnen ausnutzen. Diese Arbeitnehmer müssen von uns geschützt werden.
Es gibt darüber hinaus Arbeitgeber - auch das erleben wir in dieser Situation -, die die derzeitige Diskussion um das sozialpolitische Instrument Mindestlohn dazu nutzen, ihre eigene Wettbewerbsposition gegenüber kleineren Wettbewerbern zu verbessern.
Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf diesem Auge blind sind.
Aus den Gestzentwürfen, die uns vorliegen, Herr Scholz, will ich drei Beispiele herausgreifen:
Erstens. Nach meinem persönlichen Eindruck haben wir es beim Wach- und Sicherheitsgewerbe mit einem Bereich zu tun, in dem Arbeitgeber derzeit zum Teil die Notlage von Menschen ausnutzen, um zu Dumpinglöhnen zu kommen. Da werden wir möglicherweise etwas tun müssen.
Zweitens. Bei der Entsorgung liegt der Fall ganz anders. Da versucht zurzeit gerade der öffentliche Entsorgungsbereich, der ohnehin schon mit Mehrwertsteuerprivileg sowie Anschluss- und Benutzungszwang gesegnet ist,
sich auf Kosten der Verbraucher gegen den privaten Entsorgungsbereich durchzusetzen, und das dürfen wir nicht zulassen. So einfach ist das.
- Da gab es das Postgesetz. Lasst das raus! Ihr macht es euch nur schwer, wenn ihr immer darauf verweist. Bleibt bei den Beispielen hier!
Da habt ihr genug zu tun. Dabei sehe ich von eurer Verantwortung ab, die eben schon angesprochen worden ist.
Der dritte Bereich, den wir ernsthaft diskutieren müssen, ist der der textilen Dienstleistungen. Hier ist es besonders eklatant. Da führen zehn Große einen Kampf gegen tausend Kleine. Da werde ich zunächst die Frage stellen müssen: Hat es etwas mit sozialer Absicherung oder mit Wettbewerb zu tun, wenn hier Leute ihre Wettbewerbsposition beinhart auf Kosten der Kleinen und damit auf Kosten der Arbeitsplätze verbessern wollen?
Nachdem die Diskussion schon so lange dauert, habe ich nun Gott sei Dank den Eindruck, dass die populistischen Klamaukattitüden sich langsam, aber sicher - das haben wir heute morgen erlebt - totlaufen. Frau Pothmer, auch Ihre Rede hörte sich an wie von vorgestern.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege Meyer.
Laurenz Meyer (Hamm) (CDU/CSU):
Ich komme zum Schluss, Herr Präsident.
Die Frage ist: Was hilft - nur daran dürfen wir es messen -, soziale Verwerfungen zu beseitigen, was hilft, die Grundfesten der Tarifautonomie zu stärken, und was ist umgekehrt schlecht für Arbeitsplätze und damit ausgerechnet für weniger qualifizierte Arbeitnehmer? Eine kluge Abwägung in dieser Hinsicht wird allen in Deutschland weiterhelfen, aber nicht populistische Sprüche.
Vielen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird die Überweisung der Gesetzentwürfe auf den Drucksachen 16/10486 und 16/10485 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es anderweitige Vorschläge? - Das ist nicht der Fall. Dann sind die Überweisungen so beschlossen.
Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 4 sowie den Zusatzpunkt 3 auf:
4. Beratung des Antrags der Abgeordneten Hans-Kurt Hill, Eva Bulling-Schröter, Lutz Heilmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE
Energiekosten sozial ausrichten - Sozialtarife einführen, wirksame Strompreisaufsicht schaffen, Energiesparen ermöglichen
- Drucksache 16/10510 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie (f)
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Haushaltsausschuss
ZP 3 Beratung des Antrags der Abgeordneten Renate Künast, Bärbel Höhn, Hans-Josef Fell, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Energiesparen für alle - Kosten senken, Klima schützen
- Drucksache 16/10585 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie (f)
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(f)
Rechtsausschuss
Finanzausschuss
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Haushaltsausschuss
Federführung strittig
Auch diese Aussprache soll nach einer interfraktionellen Vereinbarung 90 Minuten dauern. - Dazu sehe ich keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.
Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort zunächst dem Kollegen Hans-Kurt Hill für die Fraktion Die Linke.
Hans-Kurt Hill (DIE LINKE):
Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Die Finanzkrise überdeckt ein wichtiges Thema. Die Energiepreise steigen und steigen. Die Folge ist: Armut per Steckdose. Das fatale Treiben der Banker wird diese soziale Schieflage weiter verschärfen, und es kostet bereits Arbeitsplätze. Deshalb fordert die Linke: Energie muss bezahlbar sein und auch bleiben.
Das bedeutet: Nur Sozialtarife, also die Halbierung der herkömmlichen Tarife, können Männern, Frauen und Kindern in armen Haushalten sofort helfen. Wir müssen den Energiekonzernen auf die Finger schauen. Dann werden wir gerechte Preise bekommen. Auch die Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen wollen Energie sparen. Das muss gefördert werden. Wer aber mehr Einkommen zur Verfügung hat, kann auch mehr für Energie bezahlen und fürs eigene Energiesparen sorgen.
Die Bilanz der Kanzlerin und ihres bayerischen Bundeswirtschaftsministers können sich wirklich sehen lassen: Seit Antritt dieser Bundesregierung ist Strom um 20 Prozent teurer geworden, und Heizenergie verteuerte sich sogar um 40 Prozent. So sieht die soziale Gerechtigkeit der Regierungskoalition aus. Das ist auch ein Grund für das zunehmende Auseinanderklaffen der Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland; denn gleichzeitig sind gerade die unteren Einkommen gesunken. Es ist geradezu zynisch, wenn der Berliner SPD-Senator Sarrazin die Empfehlung ausspricht, sich warm anzuziehen. Die Rentnerinnen und Rentner werden mit einer Rentenerhöhung von 1,1 Prozent abgespeist, und dann wundern Sie sich, werte Kolleginnen und Kollegen, wenn es in einem Land, das seine Wirtschaftskraft rühmt und einen Spitzenplatz in der Welt einnehmen will, mittlerweile über 800 000 Stromsperrungen gibt. Das ist mit nichts zu rechtfertigen.
Energie ist lebensnotwendig wie der Zugang zu sauberem Trinkwasser. Sie lassen es zu, dass es in Deutschland ein neues Phänomen gibt: Energiearmut. Wenn man im Land unterwegs ist, bemerkt man, dass sich immer mehr Menschen in Deutschland keinen angemessenen Zugang zu Energie mehr leisten können. Währenddessen lachen sich die Energiekonzerne ins Fäustchen und stopfen sich ungehindert die Taschen voll. Was macht die Energiekanzlerin der Merkel-Regierung? Als Freundin der Strombosse verhindert sie eine europaweite und wirksame Kontrolle der Energiekartelle. Die Linke sagt hierzu: So nicht, Frau Merkel!
Jetzt schreien Sie von CDU/CSU und SPD wahrscheinlich, man habe die Netzgebühren gesenkt und das Kartellrecht verschärft, was zu Preissenkungen geführt habe. Verzeihen Sie, die Realität ist eine andere; die Leute fühlen sich von Ihnen veräppelt. Die Strompreise steigen immer schneller, und Wirtschaftsminister Glos stochert weiter nur im Nebel herum. Ihre Papiertiger haben auf den Stromrechnungen der Verbraucherinnen und Verbraucher keine Spuren hinterlassen, meine Damen und Herren von der Regierung.
Die Linke hat natürlich die Sorgen der Verbraucherinnen und Verbraucher im Auge. Deshalb schlagen wir dem Bundestag vor, im Strombereich mit wirksamen Maßnahmen zu beginnen. Es sind fünf Punkte:
Erstens brauchen wir gezielte Energieberatung, um die machbaren Sparpotenziale auszuschöpfen.
Zweitens brauchen wir Sozialtarife, die deutlich unter den Normalkosten liegen. Damit bleiben bei den Bürgerinnen und Bürgern, die nicht so viel Einkommen haben, das Licht an und die Heizung warm.
Drittens brauchen wir eine kostenfreie Sockelversorgung, die Haushalte mit geringem und durchschnittlichem Energieverbrauch entlastet.
Viertens brauchen wir eine wirksame Strompreisaufsicht durch die Länder, um die Preise überprüfbar zu machen.
Fünftens brauchen wir die Abschöpfung der überhöhten Profite bei den Energiekonzernen. Damit finanzieren wir langfristige Maßnahmen für Energieeffizienz, Energieeinsparung und die Zuschüsse für energiesparende Geräte.
Die Linke will, dass sich alle Menschen Energie leisten können. Niemand soll im Dunkeln oder im Kalten sitzen, meine Damen und Herren.
Aus den anderen Fraktionen habe ich von einigen, zumeist halbherzigen Vorschlägen gehört. Klar ist: Wer glaubt, man könne Menschen mit kleinem Geldbeutel helfen, indem man ihnen ausschließlich Energiesparen verordnet, der kann wirklich gleich Wollpullover verteilen. Ist Ihnen eigentlich klar, was es bedeutet, mit 351 Euro Hartz IV im Monat auskommen zu müssen? Auch die Grünen frage ich: Wie wollen Sie Menschen helfen, die schon alles gemacht haben, um Strom zu sparen, und trotzdem ihre Stromrechnung nicht bezahlen können? Sie, die Hartz IV mitbeschlossen haben, sollten aufhören, die Menschen zu schikanieren, die Sie selbst mit arm gemacht haben.
Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Ihre Idee einer verbilligten Sockelversorgung ist gut. Sie greift bei armen Haushalten aber zu kurz und muss mit Sozialtarifen gekoppelt werden. Nur gemeinsam wird ein Schuh daraus.
Sozialtarife helfen Menschen, die aufgrund der Energieteuerung in Not geraten sind. Die Sockelversorgung hilft auch Familien mit unteren und mittleren Einkommen oberhalb von Transferleistungen. Ein Sockelbetrag, der von allen solidarisch getragen wird und hohen Verbrauch verteuert, ist richtig und findet unsere Zustimmung. Es handelt sich dabei aber um eine rein ökologische Maßnahme. Sie erfassen die soziale Situation der betroffenen Menschen nicht. Das ist der Punkt, den Sie dabei übersehen. Deshalb sind solche Vorschläge ein Anfang; aber sie sind wirkungslos, wenn die Menschen ohnehin kein Geld in der Tasche haben. Ich kann nicht verstehen, werte Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von der SPD, dass Sie dem Parlament bis heute keinen geeigneten Vorschlag vorgelegt haben. Ich bedaure das sehr.
Die Bundesregierung ist nicht bereit, die Sozialleistungen für die über 7 Millionen Betroffenen - zum Beispiel Hartz-IV-, Wohngeld-, Sozialhilfe-, BAföG-Empfängerinnen und -Empfänger, Rentnerinnen und Rentner; auch Asylbewerberinnen und Asylbewerber gehören dazu - zu verbessern.
Die Linke fordert, diese Menschen wenigstens bei der teuren Energie zu entlasten und beim Kauf Strom sparender Geräte zu unterstützen. Wir fordern - ich glaube, ein ähnlicher Vorschlag kam vor kurzem auch aus der SPD - Klimaschecks, mit denen arme Haushalte in die Lage versetzt werden, sich neue Geräte mit geringem Verbrauch zu leisten. Bei den Sozialtarifen ist eine echte und spürbare Entlastung wichtig. Eine Halbierung der Stromrechnung ist gerechtfertigt; denn die Energiepreise schlagen sich langfristig in den Preisen aller Produkte des täglichen Lebens nieder.
Natürlich muss die Inanspruchnahme eines Sozialtarifs an eine Energieberatung gekoppelt sein. So können machbare Sparpotenziale gehoben werden. Das Ziel ist, eine Verbrauchssenkung bei allen zu erreichen. Ein wirksamer Klimaschutz ist Aufgabe für alle, nebenbei bemerkt: auch für die Industrie.
Noch ein Punkt. Es kann nicht sein, dass die Bundesregierung den Stromkonzernen auch noch soziale Regelungen im Energiebereich überlässt. Die Folge ist: Eon und Co legen in ihrem eigenen Interesse willkürliche Regeln fest, meist zeitlich begrenzt oder nur für wenige Kunden. Darüber hinaus werben sie mit der Not der Menschen, während sie hinterrücks weiter den Strommarkt manipulieren.
Die Linke sagt: Energie ist öffentliches Gut, und die Regelung von Sozialtarifen ist Sache des Staates.
Das Energiewirtschaftsgesetz muss sozial und ökologisch ausgestaltet werden. Den Strombossen sind in ihrem grenzenlosen Schalten und Walten endlich die Daumenschrauben anzulegen. Zuallererst muss deshalb eine wirksame Strompreisaufsicht eingeführt werden. Es geht nicht darum, wie von der CDU immer gerne behauptet wird, die Preise staatlich zu verordnen. Vielmehr müssen die Unternehmen endlich ihre Preisgestaltung offenlegen, damit diese umfassend überprüft werden kann, selbstverständlich auch von den Verbraucherinnen und Verbrauchern.
Ich fasse zusammen. Bezahlbare Energie und Klimaschutz gehen zusammen, wenn die Maßnahmen sozial ausgewogen sind. Erstens. Nur Sozialtarife im Energiebereich können Energiearmut verhindern. Zweitens. Energiesparen ist Pflicht für alle. Drittens. Nur wenn das Stromkartell umfassend kontrolliert wird, sinken die Preise. Viertens. Wir brauchen ein Konjunkturprogramm mit einem Energiesparfonds, durch den Bürgerinnen und Bürger dazu angehalten werden, effizient zu handeln und sparsam mit Energie umzugehen.
Davon sollen vor allem die Menschen mit kleinem Geldbeutel profitieren. Wir Linke wollen nicht, dass es bei diesen Menschen zappenduster wird.
Vielen Dank.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die Unionsfraktion hat nun der Kollege Dr. Joachim Pfeiffer das Wort.
Dr. Joachim Pfeiffer (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir debattieren heute über diesen Antrag der Linken. Herr Hill, Sie stellen sich hier hin und fordern günstige Stromtarife für alle. Das ist an Populismus nicht zu überbieten; denn Ihre Forderungen und vorgeschlagenen Maßnahmen würden den Strom nur teurer machen.
Sie fordern einen beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie. Sie wollen keine neuen Kohlekraftwerke mehr bauen. Sie wollen insgesamt aus der Nutzung fossiler Energieträger aussteigen. Vor Ort sind Sie gegen den Neubau von Leitungen, in denen erneuerbare Energien aus Windkraftanlagen in die Verbrauchszentren transportiert werden sollen, und, und, und. Die Liste lässt sich fortsetzen.
Nach dem Motto ?Freibier für alle? stellen Sie Forderungen in einer Größenordnung von 130 Milliarden bis 140 Milliarden Euro auf; das ist einmal zusammengerechnet worden. Dann stellen Sie fest, dass dies auch finanziert werden muss; denn es fällt ja nicht vom Himmel. Wie soll dies finanziert werden? Über Steuern und Abgaben, die den Bürger belasten. Schließlich sagen Sie: Der arme Bürger ist so sehr belastet. Deshalb brauchen wir Sozialtarife.
Lieber Herr Hill, es ist ziemlich durchsichtig, was Sie betreiben. Deshalb kann ich Ihnen nur sagen: Anstatt gegen Castor-Transporte zu sein, sollten Sie sich lieber von der Fidel-Castro-Politik lossagen, die mit populistischen Forderungen und Sprüchen am Thema vorbei geht, und sich an einer Politik orientieren, die nicht an Symptomen kuriert, sondern an den Wurzeln ansetzt.
Das ist das, was wir in der Union und auch in der Großen Koalition machen, nämlich an den Wurzeln ansetzen und nicht an den Symptomen kurieren. Das will ich Ihnen jetzt darlegen.
Mit dem Integrierten Energie- und Klimapaket schaffen wir es, bis zum Jahr 2020 20 Prozent des Energieverbrauchs einzusparen. Das heißt, dass wir an erster Stelle den Königsweg der Energieeffizienz beschreiten. Das ist die beste Energiepolitik: Die Energie, die nicht verbraucht wird, ist gut für das Klima. Sie kostet den Bürger nichts, also spart er Geld. Dies ist letztlich auch ein Mittelstandsbeschäftigungsprogramm, wenn man beispielsweise an die CO2-Gebäudesanierungen oder den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien zur Heizung oder Kühlung im Haus denkt.
Was machen wir im Strombereich ganz konkret? Wir wollen und werden die staatlichen Belastungen - anders als Sie es für andere Bereiche vorschlagen - nicht weiter erhöhen. Die Grenze der Belastung ist hier nämlich erreicht.
Wir wollen und werden mit den neuen Maßnahmen des Emissionshandels den Bürger entlasten.
Was haben wir bisher schon erreicht? Stichwort: Netznutzungsentgelte. Überall steigen die Preise. Wir haben bei den Netznutzungsentgelten in den vergangenen Jahren sehr viel erreicht - das ist ein Erfolgsmodell; das muss man sich einmal vergegenwärtigen -: Seit dem Jahr 2005, als wir die Regulierung eingeführt haben, sind die Netznutzungsentgelte in der ersten Regulierungsperiode von 2006 auf 2007 - um einmal die Gesamtsumme zu nennen - um 2,5 Milliarden Euro nicht erhöht, sondern gekürzt worden; ich verweise auf den kürzlich durch die Bundesnetzagentur vorgelegten Monitoringbericht 2008. Das ergibt für den Bürger weitere 1,6 Milliarden Euro, die ihn nicht mehr belasten. Bei Netznutzungsentgelten von insgesamt 23 Milliarden Euro im Jahr 2005 beschreiten wir mit der Anreizregulierung, die im nächsten Jahr beginnt, einen Pfad, auf dem wir in vier bis fünf Jahren auf 18 Milliarden Euro kommen - und das in einem Umfeld, in dem die Preise insgesamt steigen. Dies ist eine Entlastung, die der Bürger auch zu spüren bekommt.
Laut Monitoringbericht - um für den Bürger auch Konkretes zu nennen - sind die Preise von April 2007 bis April 2008 um 3,3 Prozent bis 7,7 Prozent zurückgegangen. Wäre dieses Instrument so nicht eingesetzt worden, wäre der Strompreis für den normalen Durchschnittshaushalt um 21,7 Prozent höher gewesen, als er jetzt ist, und für den energieintensiven Verbraucher in der Industrie wäre er um 15 Prozent höher gewesen als jetzt.
Insofern wirkt unsere Politik ganz konkret nicht nur kostendämpfend, sondern sogar kostenentlastend.
Des Weiteren haben wir den Wettbewerb im Blick und wollen ihn weiter stärken. Stichworte sind hier: GWB-Novelle und Netzanschlussverordnung.
Nur mit mehr Anbietern und mehr Liquidität erreichen wir einen besseren Wettbewerb, aber nicht mit der Verhinderung von Kraftwerksneubauten.
Wir haben jetzt das Instrument des Smart Metering eingeführt. Die ersten Feldversuche zeigen, dass der Bürger - auch der Bürger ist gefordert; es geht um Konsumentensouveränität - bis zu 30 Prozent seines Stromverbrauches einsparen kann, weil er mit dem Smart Metering in der Lage ist, sekundengenau zu wissen, wie viel Strom er verbraucht und wie viel ihn das kostet. Es ist Schluss mit der Blackbox. Heute ist es so, dass der Bürger zwölfmal im Jahr eine Abschlagszahlung leistet und nach einem Jahr eine Gesamtrechnung bekommt, ohne zu wissen, wie sich diese im Einzelnen zusammensetzt. Zukünftig kann er seinen Verbrauchsverlauf genau nachvollziehen.
Ab 2010 - wir haben das im Gesetz vorgesehen - werden lastvariable Tarife angeboten. Das heißt, der Bürger kann reagieren: Da er weiß, wann der Strom günstiger ist, kann er entsprechend die Waschmaschine, den Wäschetrockner oder was auch immer laufen lassen. Das, was bei der Telekommunikation zu einer Preisspirale nach unten und einer Erhöhung der Wettbewerbsintensität geführt hat, kann jetzt endlich auch im Strombereich eingeführt werden. Dies gibt dem Bürger Souveränität über seine Rechnung und seinen Stromverbrauch, was ihm hilft, wenn er sich engagiert, Kosten zu sparen.
Die Große Koalition hat - da wird schlicht die Unwahrheit behauptet; Kollege Kelber hat völlig recht - das Wohngeld rückwirkend zum 1. Oktober dieses Jahres angehoben.
Wir haben eine Heizkostenkomponente eingeführt. Gerade dies entlastet die einkommensschwache Bevölkerung. Wir sehen auch in anderen Bereichen Verbesserungen vor: zum Beispiel beim Kinderfreibetrag, beim Kindergeld; um nur einige Stichworte zu nennen. Für die Leistungsträger in unserer Gesellschaft, für diejenigen, die arbeiten, wird der Arbeitslosenversicherungsbeitrag weiter auf 2,8 Prozent von einstmals 6,5 Prozent gesenkt. Das bedeutet für den Durchschnittsverdiener in diesem Land eine Entlastung von 750 Euro pro Jahr. Das ist die Politik der Großen Koalition. Sie entlastet den Bürger konkret mit einem austarierten Maßnahmenpaket im Energiebereich, aber auch im Bereich von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.
Zum Abschluss möchte ich den Verbraucher direkt ansprechen; denn auch der Verbraucher ist gefordert. Es ist zwar Aufgabe des Staates, die Rahmenbedingungen zu setzen, und Aufgabe der Energiewirtschaft, entsprechende Angebote zu machen. Diese Angebote müssen aber auch vom Verbraucher angenommen werden. Leider kam vieles erst sehr zögerlich in Gang. Von 1998 bis 2007 haben nur knapp 2 Millionen Menschen den Stromanbieter gewechselt. Im letzten Jahr ist Gott sei Dank Dynamik hineingekommen, sodass jetzt insgesamt 4,5 Millionen Menschen einen Wechsel vollzogen haben.
Wenn Sie die Leute fragen, wie oft sie ihren Handyanbieter gewechselt haben, dann stellen Sie fest, dass fast jeder schon einmal eine Veränderung vorgenommen hat. Im Strombereich sind wir noch nicht so weit. Der Verbraucher hat es in der Hand, etwas zu unternehmen. Die Verbraucherverbände sagen ganz klar: Schon bei der heutigen Wettbewerbssituation kann der einzelne Verbraucher bis zu 30 Prozent seiner Stromrechnung einsparen, wenn er die günstigste Variante wählt. Deshalb kann ich an dieser Stelle nur die Verbraucher auffordern, ihren Teil beizutragen.
Das alles ist ein Gesamtpaket und keine Mogelpackung, wie es Sozialtarife wären. Damit bekommen wir das Energieproblem in den Griff.
Vielen Dank.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die FDP-Fraktion hat nun die Kollegin Gudrun Kopp das Wort.
Gudrun Kopp (FDP):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Herren und Damen! Auch angesichts der Finanzmarktkrise kommen wir am heutigen Tage zu anderen politischen Problemfällen. Die hohen Energiepreise sind natürlich ein Dauerproblem, dessen Lösung wir seit vielen Monaten vor uns herschieben. Viele Bürger und Bürgerinnen draußen im Lande wissen nicht mehr, wie sie ihre Stromrechnung bezahlen sollen. Es ist völlig klar, dass es hier zu einer Entlastung kommen muss. Wir Liberale sehen dafür völlig andere Instrumente vor als Sie, Herr Hill, von den Linken und als die Grünen, die heute hierzu ebenfalls einen Antrag vorgelegt haben. Wir haben bereits vor einigen Wochen unsere Vorstellung von einer Entlastung der Bürger eingebracht; darauf komme ich gleich zu sprechen.
Wenn beide Fraktionen, die eben von mir genannt wurden, einen Energiesparfonds einfordern - die eine politische Gruppierung in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, die andere sogar in Höhe von über 3 Milliarden Euro -, wenn pro Kopf der Bevölkerung eine Energiesparprämie von 50 Euro bzw. eine sogenannte Geräteabsatzprämie von 250 Euro gefordert wird - der Bundeswirtschaftsminister kann sich eine sogenannte Kühlschrankprämie in Höhe von 150 Euro pro Gerät als Zuschuss sehr gut vorstellen; Minister Tiefensee packt noch einen drauf und möchte eine steuerliche Vergünstigung für sogenannte Ökoautos -, dann kann ich nur sagen: Das alles sind populistische Maßnahmen, die viele Mitnahmeeffekte auslösen, die die breite Bevölkerung, die eine Entlastung nötig hätte, aber nicht treffen. Insofern sind diese Maßnahmen ungeeignet.
Lieber Herr Kollege Pfeiffer, das Folgende betrifft Sie, die Vertreter der Regierungskoalition und die Bundesregierung: Sie haben auch heute keinen Vorschlag eingebracht, der geeignet wäre, die hohen Steuern und Abgaben auf Strom - die Belastungen liegen bei 40 Prozent - zu senken. Sie gehen immer vom Status quo aus und sagen: Da machen wir Schluss; das ist unsere Deckelung. - Wir hingegen möchten von diesen hohen Steuern und Abgaben herunterkommen.
Wenn man genau hinschaut, stellt man fest, dass die von der Linken geforderten Sozialtarife höchst unsozial sind.
Sie treffen nämlich nicht die Durchschnittsverdiener. Das Durchschnittseinkommen in Deutschland liegt bei rund 3 100 Euro brutto pro Kopf und Monat. Diese Menschen werden doppelt belastet: Als Arbeitnehmer zahlen sie Steuern und müssen darüber hinaus auch noch die Lasten durch Sozialtarife und andere Sondertatbestände schultern. Ferner schwächen Sie die kleineren Stromanbieter am Markt, beispielsweise die Stadtwerke. Rund die Hälfte aller Strom- und Energiebezieher sind immer noch Kunden von Stadtwerken. Genau diese Anbieter schwächen Sie und stärken die Oligopolisten am Markt. Das kann nicht sein; das ist nicht FDP-Politik, weil das nicht zielführend ist.
- Ja, lieber Kollege Kelber, auch der breite Energiemix gehört dazu. Vor allen Dingen gehört dazu - das sage ich ganz deutlich an Ihre Adresse -, dass wir die Scheuklappen abnehmen.
- Ich sage: Wir brauchen einen breiten Energiemix. Wir müssen der Gefahr einer Stromlücke, die auf uns zukommen kann, begegnen. Wir können die Stromversorgung in Deutschland nicht ohne die Nutzung von Kernkraftwerken und Kohle gewährleisten. Das ist nun einmal nicht möglich, ob Sie das nun toll finden oder nicht.
Die FDP hat in den Deutschen Bundestag einen Antrag zur Reduzierung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent eingebracht. Das wäre ein gangbarer Weg, von dem alle profitieren würden. Es gäbe keine Ausnahmetatbestände, keine Bevorzugung bestimmter Bevölkerungsgruppen und keine Benachteiligung anderer. Vielmehr hätten wir mit Blick auf die Grundversorgung eine Basis, auf der man agieren könnte. Also: Mehrwertsteuerreduzierung.
- Ich erinnere daran, dass die jetzige Bundesregierung eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 3 Prozentpunkte vollzogen hat, liebe Kollegin Höhn. Auch Sie werden sich sicher noch daran erinnern.
Auch die Grünen haben ihren Anteil an den hohen Subventionen und an den milliardenschweren Belastungen der Bürger, insbesondere der Stromkunden. Seien Sie also ganz friedlich!
Ferner fordere ich insbesondere die Union, deren Vertreter hier eben noch einmal dargestellt hat, wie wichtig der Emissionshandel und die Einnahmen daraus sind, auf, die Dinge auch tatsächlich umzusetzen.
In diesem Jahr starten wir in Deutschland mit einer Versteigerung von knapp 10 Prozent der CO2-Zertifikate. Die Einnahmen in Höhe von rund 900 Millionen Euro brutto müssen an die Stromkunden zurückgegeben und dürfen nicht in einzelne Förderprojekte gesteckt werden.
Wir halten den Emissionshandel für das geeignete Klimaschutz- und Ressourcenschutzinstrument, das es möglich macht, dass alle anderen Parallelinstrumente entfallen. Wir wünschen uns, dass es hier endlich Klarheit gibt.
Folgende Punkte sind für die FDP wichtig:
Erstens. Wir machen nicht dabei mit, dass die Einnahmen aus dem Emissionshandel, die immer weiter steigen und ab 2013 wahrscheinlich in zweistelliger Milliardenhöhe liegen, nicht an die Energiekunden zurückgegeben werden. Wir wollen eine Rückschleusung und wollen die Bürger entlasten.
Zweitens. Wir möchten, dass auf EU-Ebene und in Deutschland Klarheit darüber besteht, was mit den stromintensiven Industrien passieren soll. Wenn im Umweltausschuss des Europa-Parlaments und in der EU-Kommission beschlossen wurde, sich erst nach dem Jahr 2011 zu entscheiden, dann muss ich sagen: Das ist das Gegenteil von verlässlicher Politik. Ich fordere die Bundesregierung auf, auf der europäischen Ebene Klarheit zu schaffen. Wir brauchen vor dem Jahr 2011 für unsere Wirtschaft die klare Ansage, was energieintensive Industrien, die ja im internationalen Wettbewerb stehen, mit ihren 600 000 Arbeitsplätzen in Deutschland erwartet. Wir möchten nicht, dass aus Deutschland Industrien abwandern, mit der Folge, dass die Emissionen in Nachbarländern entstehen und nicht abgebaut werden.
Drittens. Wir wünschen uns - das haben wir bereits klargemacht -, dass die Bundesregierung endlich eine Netz AG, wie wir sie bereits vorgeschlagen haben, einrichtet. Widersetzen Sie sich nicht länger einer Trennung von Vertrieb und Netz beim Strom, sondern lassen Sie uns die Netz AG, in die alle vier großen Netzbetreiber ihre Netze einbringen, gemeinsam angehen, damit wir auch in diesem Bereich zu mehr Wettbewerb und zu einem besseren Ausbau von Netzen kommen! Wir wollen bei dieser Gelegenheit die vier Regelzonen, die es derzeit noch in Deutschland gibt, zu einer Regelzone zusammenfassen und so die Effizienz erhöhen und dabei Kosten sparen.
Viertens. Wir wollen den Wettbewerb auf den Gasmärkten stärken. Auch da haben wir große Defizite. Hier muss dringend etwas geschehen. Wir wollen, dass Gas vollständig an der Börse gehandelt werden kann. Auch da tut die Bundesregierung im Moment nichts, jedenfalls nicht so, dass man irgendetwas bemerken könnte. Wir wünschen uns auf jeden Fall mehr Transparenz an der Börse, nämlich in Form einer Marktbeobachtungsstelle, damit mögliche Manipulationen bereits beim Handel aufgedeckt und eliminiert werden können.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollegin Kopp, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Pfeiffer?
Gudrun Kopp (FDP):
Sehr gerne.
Dr. Joachim Pfeiffer (CDU/CSU):
Frau Kollegin Kopp, Sie haben das Allheilmittel Ownership-Unbundling - oder auf Deutsch: Netz AG - angesprochen. Sind Sie nicht vielmehr mit uns der Meinung, dass es richtiger wäre, die einheitliche Regelzone einzuführen, mit der wir ein Einsparungs- und Optimierungspotenzial von mehreren Hundert Millionen Euro erreichen würden? Würden Sie nicht lieber an Themen wie Interkonnektoren arbeiten? Die Netz AG allein ist, wie das Ownership-Unbundling, eine Monstranz, die man vor sich herträgt, die aber dem Wettbewerb nichts bringt. Oder sehen Sie das anders?
Gudrun Kopp (FDP):
Wir sind einer Meinung - das habe ich eben auch dargestellt -, dass der Netzausbau dringend nötig ist, gerade an den Grenzkuppelstellen. Es ist in der Tat richtig, dass wir an dieser Stelle dringend weiterkommen müssen. Beim Netzausbau sind wir also völlig einer Meinung.
Von einem Ownership-Unbundling habe ich eben nichts gesagt, sondern ich habe von einer Netz AG gesprochen. Wir möchten keine Enteignung vornehmen, weil eine Enteignung in diesem Fall rechtlich sehr schwierig wäre und nicht nachweislich zu mehr Wettbewerb führen würde; jedenfalls haben das alle Experten bisher so gesagt. Deswegen - das ist gerade der Charme einer Netz AG - wollen wir, dass alle vier Übertragungsnetzbetreiber ihre Netze in diese AG einbringen, dass wir dadurch eine Regelzone schaffen
und dass die Übertragungsnetzbetreiber Anteile entsprechend dem Wert ihrer Netze erhalten.
Sie selbst sollen aber in dieser Netz AG nicht über den Ausbau entscheiden dürfen. Das ist das Entscheidende. Das wäre rechtlich sehr viel eleganter, gäbe weniger Probleme, wir brauchten dabei keine Enteignung, und wir würden den Wettbewerb, den wir wünschen, sehr wohl befördern. Für Enteignung sind wir nicht. Wir halten das für keinen gangbaren Weg.
Ich möchte zum Schluss noch auf eine weitere Entwicklung zu sprechen kommen. Neben der Energiepreissteigerung, über die wir hier heute Morgen diskutieren, ist ganz wichtig, zu fragen: Was folgt eigentlich realpolitisch aus dieser Finanzmarktkrise? Natürlich trägt sie stark zur Verunsicherung der Bevölkerung bei. Der klassische Fall einer Enteignung gerade des kleinen Mannes, der kleinen Frau im Land ist natürlich der Preisauftrieb. Wir sollten daher die Inflationsrate im Auge behalten.
Ich mache mir Sorgen, wenn ich sehe, dass der Anstieg der Verbraucherpreise in 2007 und 2008 im Schnitt bei 2,8 Prozent liegt; das ergibt sich aus dem Herbstgutachten. Es wird geschätzt, dass der Preisauftrieb im nächsten Jahr bei in etwa 2,3 bis 2 Prozent liegen wird. Wenn es eine solche Inflationsrate - keiner kann das heute verlässlich vorhersagen - geben oder wenn sie sogar noch steigen sollte, dann würde das eine weitere Schwächung der Menschen bedeuten, die ein geringes oder ein mittleres Einkommen haben. Das muss uns Sorge bereiten. Denn wir haben es mit einer Wirtschaftsflaute zu tun - im nächsten Jahr werden wir das noch mehr spüren -, wahrscheinlich mit einem Arbeitsplatzabbau und mit einer sinkenden Nachfrage. Auch an der Stelle werden wir merken, dass es den Bürgern angesichts aller notwendigen Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um Energieeffizienz und Energieeinsparung zu befördern, immer schwerer fällt, gerade ihren täglichen Bedarf, auch den Energiebedarf, zu finanzieren.
Es gibt aber eine Grenze. Von daher kann ich heute Morgen nur noch einmal mahnen: Wir müssen die Bürger entlasten, damit sie für das, was im nächsten und im darauffolgenden Jahr wahrscheinlich auf uns alle zukommen wird, gewappnet sind. Daher ist es notwendig, die von mir genannten Maßnahmen umzusetzen. Ich fordere die Bundesregierung auf, das zu tun und sich nicht immer auf Einzelmaßnahmen zu beschränken. Ich wünsche mir, dass auch Bundesminister Glos zu den realpolitischen Auswirkungen, die die Finanzmarktkrise in Deutschland, international und europaweit hat, Stellung nimmt. Das wäre am heutigen Morgen wichtig als Signal und als Orientierung für die Bürger draußen, damit sie wissen, was auf sie zukommt. Die Politik muss sich darauf einstellen und darf sich nicht ideologisch verhalten, sich in weiteren Subventionstatbeständen ergehen und die Bürger milliardenschwer belasten.
Vielen Dank.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Garrelt Duin das Wort.
Garrelt Duin (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Manchmal - das ist, glaube ich, unser aller Erfahrung - schmeckt Aufgewärmtes besonders gut. Manchmal ist es aber leider so, dass Aufgewärmtes fast ungenießbar wird oder jedenfalls sehr fade und langweilig schmeckt. So ist es in diesem Fall, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken. Es ist schon ein bisschen enttäuschend, dass Sie uns hier mit dem gleichen Thema und einem fast identischen Antrag innerhalb von wenigen Wochen das zweite Mal quasi mit Aufgewärmtem beglücken.
Es war erst am 20. Juni 2008, also unmittelbar vor der Sommerpause, als wir hier über einen Antrag von Ihnen diskutiert haben, der in zwei von drei Punkten mit Ihrem jetzigen Antrag identisch ist. Die Debatte zeigt auch, dass ein Teil der Argumente oft wiederkehrt.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen zur Kenntnis zu geben, was wir als Große Koalition in dieser Wahlperiode alles schon auf den Weg gebracht haben. Zunächst einmal zu Ihrer Forderung nach Wiedereinführung der staatlichen Strom- und Gaspreisaufsicht auf Länderebene.
Diesen Vorschlag haben wir, wie Sie wissen, schon im Juni dieses Jahres abgelehnt. Auch die Bundesratsinitiative, die es dazu gegeben hat, ist im Grunde sang- und klanglos verpufft. Das ist auch gut so; denn die staatliche Preisaufsicht hat sich immer nur auf den Vertrieb bezogen. Hier hilft uns kein Rückfall in staatliche Preisaufsicht, sondern mehr Wettbewerb.
Im Stromendkundenmarkt kommt der Wettbewerb mittlerweile in Gang, auch wenn wir uns noch mehr wünschen. Im vergangenen Jahr haben nach Angaben der Bundesnetzagentur rund 1,3 Millionen Stromkunden den Versorger oder zumindest den Tarif gewechselt. Herr Kollege Pfeiffer hat schon darauf hingewiesen, dass noch nicht die Zahlen und die Selbstverständlichkeit erreicht wurden, die wir aus anderen Bereichen kennen. Hier kommt aber etwas in Bewegung. Das wünschen wir uns natürlich auch für den Gasmarkt. Was den Gasendkundenmarkt angeht, kann sicherlich noch viel mehr erreicht werden.
Mit der Novelle zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen haben wir dem Bundeskartellamt Ende letzten Jahren mehr Möglichkeiten im Kampf gegen missbräuchlich überhöhte Endkundenpreise eingeräumt. Das ist der richtige Weg. Es sind bereits erste Erfolge zu verzeichnen, wie die Einstellung des Missbrauchsverfahrens gegen sechs regionale Eon-Gasversorger Anfang Oktober dieses Jahres gezeigt hat. Obwohl § 29 des GWB noch nicht einmal zehn Monate alt ist, können wir schon jetzt feststellen, dass dieses Instrument in die richtige Richtung weist. Im bereits erwähnten Verfahren wurde entschieden, dass durch eine Verschiebung der Preiserhöhung bzw. im Rahmen von Boni 55 Millionen Euro an die Kunden zurückgezahlt werden müssen. Weitere knapp 30 Verfahren gegen Gasversorger stehen nach Aussage des Bundeskartellamtes kurz vor dem Abschluss.
Die von Ihnen geforderte staatliche Preisaufsicht auf Länderebene konnte die Verbraucher früher nicht in diesem Umfang vor Preiserhöhungen schützen, und sie wird dies auch in Zukunft nicht können. Deswegen bleibt es bei dem eingeschlagenen Weg.
Richtig ist - das wird auch von niemandem in Zweifel gezogen -, dass die Energiekostenentwicklung der vergangenen Jahre und insbesondere der vergangenen Monate für immer mehr Haushalte eine erhebliche Belastung darstellt. Richtig ist auch, dass die Menschen von der Politik Handlungsoptionen erwarten. Was sie nicht erwarten, sind unhaltbare Versprechungen. Die Bürgerinnen und Bürger wissen genau, dass es in Zeiten einer wachsenden globalen Energienachfrage bei gleichzeitig knapper werdenden Ressourcen falsch wäre, Hoffnungen auf dauerhaft niedrige Energiepreise zu wecken. Insbesondere wäre es angesichts der Entwicklungen auf dem Weltmarkt falsch, den Eindruck zu erwecken, dass diese Probleme durch nationale Politik gelöst werden könnten; dieser Ansatz kommt in Ihrer Programmatik aber immer wieder zum Vorschein.
Die Politik kann aber helfen, die Kostenbelastung der Verbraucherinnen und Verbraucher in einem bezahlbaren Rahmen zu halten. Deswegen muss ganz oben auf der Tagesordnung stehen - das ist unsere Leitlinie -, gleichen Lebenskomfort bei sinkendem Energieverbrauch zu ermöglichen. Das ist im Grunde die Maxime, nach der wir unsere Politik ausgerichtet haben; darauf hat Herr Kollege Pfeiffer schon hingewiesen. Im Rahmen des Integrierten Energie- und Klimaprogramms haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen aus verschiedenen Politikbereichen gebündelt. Das war auch notwendig.
Die Novelle zum Erneuerbare-Energien-Gesetz, das KWK-Gesetz und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz gehen in die richtige Richtung. Durch Kraft-Wärme-Kopplung und den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien im Strom- und Wärmesektor werden unsere Importabhängigkeit und die Belastung der privaten Haushalte durch den Preisanstieg auf den Weltenergiemärkten verringert.
Schon seit Jahren schaffen wir darüber hinaus mit dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm Anreize zur energetischen Gebäudesanierung. Allein in den Jahren 2005 bis 2007 wurden 650 000 Wohnungen mithilfe von staatlichen Zinsverbilligungen oder Zuschüssen saniert oder energiesparend neu gebaut. Durch diese dauerhafte Entlastung der Haushalte im Hinblick auf ihre Energiekostenrechnung wurden außerdem Tausende, ja Zehntausende von Arbeitsplätzen im lokalen Handwerk gesichert und zum Teil neu geschaffen. Wegen der hohen Nachfrage haben wir die Mittel für energetische Sanierungen im Bereich privater Haushalte Mitte dieses Jahres von 900 Millionen Euro auf 1,4 Milliarden Euro aufgestockt. Wir haben uns geeinigt, dass CO2-Gebäudesanierungsprogramm mindestens bis 2011 mit mindestens 900 Millionen Euro jährlich fortzuführen.
Ein weiteres Element - ich will es hier noch einmal ausdrücklich erwähnen - ist das ebenfalls im Juni, als wir diese Diskussion führten, verabschiedete Gesetz zur Liberalisierung des Zähl- und Messwesens. Spätestens 2010 haben Endkunden die Möglichkeit, sich intelligente Strom- und Gaszähler einbauen zu lassen, wodurch wir Transparenz über den tatsächlichen Energieverbrauch und neue Möglichkeiten zur gezielten Verbrauchssteuerung schaffen. Wir haben in dieses Gesetz auch die Pflicht der Energieversorgungsunternehmen aufgenommen, tageszeit- und lastvariable Tarife anzubieten. Auch damit wird der Energieverbraucher zunehmend zu einem wirklich mündigen Kunden.
Ich will an dieser Stelle auch die Ausweitung des Contractings im Mietwohnungsbereich erwähnen. Contracting ist zwar eine zunächst kompliziert anmutende Materie, bringt aber eine tatsächliche Entlastung der Bürgerinnen und Bürger mit sich. Contracting ist die Brücke in das Zeitalter der Energiedienstleistungen. Es ermöglicht ein professionelles Management der Energieverbräuche und generiert, sofern es gut ausgestaltet ist, spürbare Einsparungen von Energiekosten.
Darüber hinaus macht Contracting Schluss mit der kontraproduktiven Anbieterphilosophie, möglichst viele Kilowattstunden absetzen zu wollen. Wir wollen deshalb möglichst noch im parlamentarischen Verfahren zum Energieeinspargesetz eine Regelung zur Erleichterung von Contracting im Mietwohnungsbereich einbringen.
Ich komme jetzt zur Ihrer Forderung nach den Sozialtarifen. Ich freue mich über jeden Energieversorger, der diese auf freiwilliger Basis anbietet; wir kennen Stadtwerke und andere Regionalgesellschaften großer Energieversorger, die solche Tarife anbieten. Ich warne allerdings im gleichen Atemzug vor staatlich verordneten Sozialtarifen, wie Sie sie heute erneut fordern. Ein solcher Tarif bietet im Übrigen keinerlei Anreiz zum sparsamen Umgang mit Energie. Er gäbe möglicherweise sogar Fehlanreize in Richtung von Energieverschwendung.
Natürlich ist uns sehr bewusst, dass gerade Haushalte mit niedrigem Einkommen oder Haushalte von Transferleistungsbeziehern ganz besonders von steigenden Energiekosten betroffen sind, sofern sie diese Mehrkosten nicht vom Amt erstattet bekommen. Wir halten es jedoch für verfehlt, dieses Problem über Zwangstarife, über staatliche Sozialtarife zu lösen. Ich glaube, dass wir im Bereich der klassischen Sozialpolitik einiges auf den Weg gebracht haben - auch davon ist schon gesprochen worden -, was sich wirklich als positiv darzustellen lohnt.
Die Novelle zum Wohngeldgesetz will ich an erster Stelle nennen. Es ist verabschiedet, die Fördersätze deutlich zu erhöhen und die Heizkosten einzubeziehen.
Wir haben es jetzt geschafft, die gesamte Heizperiode einzubeziehen. Das ist ein großer Erfolg, der in dieser Koalition erzielt worden ist.
Lassen Sie sich diese Zahlen noch einmal sagen: Von den Änderungen, die wir beim Wohngeld vorgenommen haben, sind in Deutschland rund 800 000 Haushalte mit niedrigem Einkommen und rund 300 000 Haushalte von Rentnerinnen und Rentnern positiv betroffen. Insofern können Sie doch nicht sagen, das sei alles viel zu spät gekommen.
Ursprünglich war vereinbart, das zu Beginn des nächsten Jahres zu machen. Wir haben es jetzt vorgezogen; das ist ein absolut notwendiger und richtiger Schritt in die richtige Richtung.
Insofern bin ich sehr froh, dass Herr Tiefensee und andere, die daran mitgewirkt haben, sich in diesem Punkt haben durchsetzen können.
Wenn es um die Anpassung von Regelsätzen beim Arbeitslosengeld II und der Sozialhilfe geht, werden wir nach Vorlage des Existenzminimumsberichts die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen und diese in der Politik konkret umsetzen.
Aber tun Sie doch nicht immer so, als ob von steigenden und sehr hohen Energiepreisen in unserem Land nur Transferleistungsempfänger betroffen wären.
Das ist doch nicht der Fall.
In der Mitte der Gesellschaft spielt dieses Thema eine große Rolle. Deswegen werden Sie dieses Problem über die Instrumente, die sich auf das Arbeitslosengeld II und andere Transferleistungen beziehen, nicht lösen. Sie müssen es viel breiter diskutieren.
- Doch, ich habe ihn sehr genau gelesen.
Wir haben uns im ersten Halbjahr dieses Jahres in einer Arbeitsgruppe sehr viel Zeit genommen und mit vielen externen Sachverständigen intensiv darüber gesprochen, wie man es machen kann. Statt eines speziellen Tarifs für sozial Schwache gibt es die Idee eines für alle Haushalte wählbaren Effizienztarifs. Ich denke, dass Herr Kollege Kelber im weiteren Verlauf dieser Debatte noch einiges dazu sagen wird. Wir werden das weiter prüfen, weil wir glauben, dass das ein wesentlich intelligenteres Mittel ist, dieses Problem zu lösen.
Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich abschließend noch etwas zu den Lösungsvorschlägen der Kollegin Kopp sagen. Das, was Sie hier vorgeschlagen haben - zum einen durch einen Zwischenruf ausgelöst, zum anderen war das aber auch Teil Ihrer grundsätzlichen Ausführungen -, läuft am Ende auf die Aussage hinaus, dass man die steigenden Energiepreise und die Belastung der Bürgerinnen und Bürger hauptsächlich durch zwei Maßnahmen in den Griff bekommen kann, nämlich durch eine Verlängerung von Laufzeiten der Atomkraftwerke und durch Steuersenkungen. Sehr verehrte Frau Kollegin Kopp, beides ist völlig irreführend.
Ich lade Sie gerne nach Niedersachsen ein. Wir können einmal mit den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Wolfenbüttel, die oberhalb der Asse leben, darüber sprechen, wie sie das Thema Verlängerung von Laufzeiten der Atomkraftwerke beurteilen. Solange das Problem des Endlagers in Deutschland nicht abschließend und eindeutig geklärt ist, stellt sich die Frage der Verlängerung von Laufzeiten der Atomkraftwerke überhaupt nicht.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Kopp?
Ich erinnere allerdings an die getroffene Regelung, um die Sitzung heute unterbrechen zu können.
Garrelt Duin (SPD):
Möglicherweise sind Frau Kopp und ich ja selber davon betroffen, weil wir dann später zu einem anderen Tagesordnungspunkt noch einmal sprechen werden. - Bitte sehr.
Gudrun Kopp (FDP):
Ich versuche, mich sehr kurz zu fassen, Herr Kollege Duin.
Sind Sie bereit, mir darin zuzustimmen, dass in Ihrem Koalitionsvertrag, also dem Koalitionsvertrag von SPD und Union, steht, dass Sie sich darauf verständigt haben, noch in dieser Legislaturperiode das Problem der Endlagerung von Atommüll einer Lösung zuzuführen? Wo ist diese Lösung? Reden Sie sich bitte nicht mit dem Thema Asse heraus; das hat mit diesem Thema nichts zu tun.
- Nein, es geht um stark strahlende Abfälle.
Wo ist Ihre Endlagerlösung für den Atommüll, wie Sie es in Ihrem Koalitionsvertrag vereinbart haben?
Garrelt Duin (SPD):
Frau Kollegin Kopp, natürlich steht das so in der Koalitionsvereinbarung; Sie haben sie sinngemäß richtig zitiert. Wenn sich aber während dieser Überprüfung ergibt, dass es zurzeit keine Lösung für dieses Endlagerproblem gibt - die Vorkommnisse in der Asse sind ein Beleg dafür, dass wir dort weder technisch noch anders auf einem guten Weg sind -, dann muss das in der Großen Koalition eben auch zur Kenntnis genommen werden.
Es gibt jetzt ein anderes verabredetes Verfahren. Wir werden weiter prüfen, weil wir ja ein Interesse daran haben, dass wir irgendwann zu einer entsprechenden Lösung kommen. Dass diese Lösung noch nicht vorliegt, hat aber nichts damit zu tun, dass man sich im Bundesumweltministerium oder an anderer Stelle nicht um diese Dinge kümmern würde, sondern das hat schlichtweg damit etwas zu tun, dass alle Erfahrungen, die bisher gemacht worden sind, nicht ausreichen, um ein sicheres Endlager in Deutschland zu definieren. Solange das nicht der Fall ist, kann über eine Verlängerung von Laufzeiten der Atomkraftwerke nicht gesprochen werden.
- Doch, natürlich.
Auch mit dem zweiten Punkt, den Sie hier vorschlagen, nämlich Steuersenkungsprogrammen, liegen Sie falsch. Das kann nicht die Lösung der Probleme sein. Wir haben das in den letzten Monaten an den Tankstellen immer wieder erlebt, auch wenn es jetzt eine Entwicklung hin zu sinkenden Spritpreisen gibt. Wer glaubt denn ernsthaft, dass die Verbraucherinnen und Verbrauchern länger als drei oder vier Tage etwas von einer Senkung der Mehrwertsteuer oder der Ökosteuer hätten? Das landet am Ende doch wieder bei den Konzernen. Die Preisgestaltung, die insbesondere bei den Tankstellen vorgenommen wird, ist doch für niemanden nachvollziehbar. Sie glauben doch nicht wirklich, dass dabei am Ende eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger herauskommen würde. Es würde zu einem riesigen Loch im Haushalt kommen, das wir durch Mittel von anderen Stellen wieder stopfen müssten. Für die Bürgerinnen und Bürger käme dabei nichts Positives heraus.
Ich will abschließend sagen: Beide Wege - sowohl der staatlich verordnete Sozialtarif als auch Steuersenkungen und Atomkraft - sind irreführend. Wir müssen auf dem Weg weitergehen, den diese Koalition auf der Basis der von Rot-Grün in diesem Punkt eingeleiteten Politik geebnet hat. Effizienzsteigerungen, erneuerbare Energien - das und nicht das, was wir hier in diesem Saal von links und rechts dazu gehört haben, ist der Weg, um eine wirkliche Lösung dieses Problems zu erarbeiten.
Herzlichen Dank.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat nun die Kollegin Bärbel Höhn das Wort.
Bärbel Höhn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben in den letzten Wochen bei der Bankenkrise gemerkt, wie schnell die Bundesregierung aktiv wird, um ein gravierendes Problem anzupacken. Wir wollen, dass andere Probleme, die die Menschen betreffen, ebenso schnell angepackt werden. Durch die Auswirkungen der Finanzkrise werden die Bürgerinnen und Bürger mehrfach belastet. Wir werden nicht nur den Haushalt mit mehreren Hundert Milliarden Euro belasten, sondern ein Teil der Belastungen wird auch real auf die Menschen zukommen. Wir stehen vor einer Rezession, und wir müssen uns mit hohen Energiepreisen auseinandersetzen. Das ist eine dreifache Belastung der Bevölkerung. Deshalb ist es richtig, dass wir angesichts des wachsenden sozialen Problems heute eine Debatte darüber führen, wie die Lösung aussehen könnte.
Ehrlich gesagt hat mich die Lösung, die CDU/CSU und SPD für dieses Problem vorschlagen, nicht überzeugt. Herr Duin hat eben zu Recht festgestellt, dass nicht nur Hartz-IV-Empfänger bzw. Wohngeldempfänger betroffen sind. Insofern ist es zwar richtig, dass Sie das Wohngeld erhöht und einen Heizkostenzuschuss vorgesehen haben; aber wir haben auch eine Mittelschicht. Es gibt Familien mit kleinen Einkommen, die massiv von den drei Punkten betroffen sind, die ich genannt habe. Dafür brauchen wir eine Lösung.
Mit der Wohngelderhöhung und dem Heizkostenzuschuss laufen Sie dem Problem hinterher. Allein im Oktober haben 300 Gasanbieter ihre Gaspreise um durchschnittlich 15 Prozent erhöht. Mit Ihrer Feststellung, dass die Menschen im Winter nicht im Kalten sitzen sollen, haben sie recht, Herr Hill. Aber in Ihrem Antrag gehen Sie auf das Problem der Heizkosten gar nicht ein. Sie kündigen zwar an, dafür sorgen zu wollen, dass die Menschen nicht frieren, aber Sie schlagen keine Lösung für dieses Problem vor. Sie beschäftigen sich nur mit dem Strom, aber nicht mit den Heizkosten und dem Verkehr.
Die Menschen werden einen zusätzlichen Schock erleben, wenn sie im nächsten Frühjahr ihre Heizkostenabrechnung bekommen. Jetzt zahlen sie noch nach der Vorausberechnung vom letzten Jahr. Im Sommer war das Heizöl teilweise doppelt so teuer als im Vorjahr. Das heißt umgekehrt: Wer zu diesem Zeitpunkt Heizöl eingekellert hat, wird den Mietern erhebliche Kosten in Rechnung stellen müssen. Das wird die Menschen im nächsten Frühjahr erwarten. Deshalb sind nicht nur eine Wohngelderhöhung und ein Heizkostenzuschuss notwendig; wir brauchen vor allen Dingen eine Lösung, mit der wir unabhängiger vom teuren Öl werden und wertvolle Energie einsparen, um dem nächsten Preisschock vorzubeugen. Wir müssen handeln, wir müssen reagieren.
Der beste Weg dorthin besteht in erneuerbaren Energien, Energieeinsparung und Energieeffizienz. Wir haben ein großes Energieeinsparpotenzial. Deshalb brauchen wir - das ist der Vorschlag der Grünen - eine Energiesparoffensive; denn jede eingesparte Kilowattstunde ist billiger als jede verbrauchte Kilowattstunde.
Wie wollen wir vorgehen? Wir fordern beispielsweise einen Energiesparfonds; denn gerade in den Bereichen, in denen es Einzelne nicht schaffen, muss es eine Unterstützung der Infrastruktur geben. Das heißt, dass wir zum Beispiel mehr in Dämmmaßnahmen investieren müssen. Herr Duin, Sie haben zu Recht gesagt, dass in diesem Bereich bereits investiert wird. Aber wir sehen doch, dass gerade im Mietwohnungsbau viel zu wenig geschieht. Auf diese Weise bräuchten wir 100 Jahre, bis dieses Problem gelöst wäre. Aber wir haben keine 100 Jahre. Wir können den Menschen nicht sagen, dass sie noch 100 Jahre warten müssen, bis die letzte Wohnung gedämmt ist.
Das heißt, wir brauchen bessere Contracting-Maßnahmen; denn die bestehenden Maßnahmen greifen nicht. Wir brauchen Finanz-Contracting. Wir brauchen gerade im Wohnungsbau mehr Unterstützung. Wir brauchen auch im Verkehrsbereich mehr Unterstützung. Der ÖPNV muss ausgebaut werden, damit die Menschen eine Alternative zu den steigenden Spritkosten in diesem Land haben.
Wir wollen nicht nur durch einen Energiesparfonds die Infrastruktur verbessern. Wir wollen auch einen Energiesparscheck. Jede Person in diesem Land soll entscheiden, ob sie mit diesem Scheck im Wert von 50 Euro pro Jahr ein ÖPNV-Ticket bezahlt, eine Energieberatung in Anspruch nimmt oder - wenn sie die Schecks sammelt - einen energieeffizienteren Kühlschrank kauft. Auch das ist wichtig, um den Menschen vor Ort individuell eine Möglichkeit zu geben, etwas zu tun.
Wir brauchen darüber hinaus ein entsprechendes Ordnungsrecht. Ich kann nicht verstehen, dass es nur die Japaner mithilfe des Ordnungsrechts schaffen sollen, einen Top-Runner-Ansatz zu verfolgen. Das effizienteste Elektrogerät setzt den Standard. Alle diejenigen, die es in drei bis fünf Jahren nicht geschafft haben, diesen Standard einzuhalten, sind weg vom Markt. Ein solches Top-Runner-Modell brauchen wir in der EU, auch in Deutschland.
Ich muss ganz ehrlich sagen: Die Kennzeichnungsregelungen in der EU müssen überarbeitet werden. Die Kennzeichnung ist für die Verbraucher nicht nachvollziehbar. So gibt es bei den Elektrogeräten ein Labeling von A, B, C und D. Das kann man noch verstehen. Wenn man aber ein Gerät der Stufe A kauft und meint, dies sei das beste, muss man sich erklären lassen, dass es auch Geräte der Stufen A+ und A++ gibt. Wenn man einen Kühlschrank der Stufe A++ gekauft hat, dann hat man einen Kühlschrank, der teilweise 45 Prozent effizienter ist als ein Kühlschrank der Stufe A. Das verstehen die Menschen nicht. Das müssen wir ändern. Wir brauchen eine bessere Kennzeichnung, die die Menschen verstehen.
Das wäre auch gut für die Wirtschaft; denn die Wirtschaft produzierte dann bessere Geräte. Die Exportmöglichkeiten nähmen zu. Wir wären damit besser dran. Wir sehen an der Krise der Automobilindustrie in den USA, wie schlimm es ist, wenn man auf die falschen Produkte setzt. Damit werden letzten Endes Arbeitsplätze gefährdet.
Ich komme zum Schluss. Wir brauchen mehr Wettbewerb auf dem Energiemarkt. Es gibt ein Kartell von vier großen Energiekonzernen, die 88 Prozent der Stromversorgung kontrollieren. Das geht nicht, weil das zu unfairen Preisen führt.
Wir Grüne fordern mehr Wettbewerb, mehr Effizienzstandards und mehr Energieeinsparoffensiven. Aber hier tut die Bundesregierung zu wenig. Wir müssen jetzt agieren und vor der nächsten Energiepreiserhöhung handeln, damit die Menschen wissen, dass wir etwas getan haben.
Danke schön.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Das Wort hat der Kollege Franz Obermeier für die Unionsfraktion.
Franz Obermeier (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Kolleginnen und Kollegen! Wieder einmal wird versucht, mit alten planwirtschaftlichen Instrumenten auf Stimmenfang zu gehen. Es ist ja so einfach: Die Strompreise werden quasi staatlich festgesetzt. Vorgeschlagen wird: Sockelversorgung kostenlos, 50 Prozent Vergünstigung für Bezieher sozialer Leistungen, eine höhere Besteuerung der Energieunternehmen zur Deckung des Freifahrtscheins für Strom, einen neuen Energieeinsparfonds, dazu noch eine neue Strompreisaufsicht auf Länderebene und ein neuer Verbraucherbeirat, nicht zu vergessen ein Klimascheck in jährlicher Höhe von 250 Euro.
Selbst wenn ich etwas vergessen haben sollte: Es reicht uns schon. Warum soll es Sozialtarife eigentlich nur für Energie geben? Warum gibt es denn keine Sozialtarife für Nahrungsmittel? Warum gibt es keine Sozialtarife für Kleidung? Warum gibt es keine Sozialtarife für Urlaubsreisen? Das alles könnten Sie beantragen.
Nein, der richtige Ansatz ist, dass der soziale Ausgleich bei uns über Sozialtransfers und über das Steuersystem stattfindet und nicht bei einzelnen Gütern ansetzt. Wir verzetteln uns sonst und bringen die soziale Marktwirtschaft durch immer mehr Eingriffe und Zusatzkosten aus dem Lot. Ihre Vorschläge strotzen nur so von zusätzlicher Bürokratie, Geld, das uns dann an anderer Stelle fehlt.
Das Kabinett hat gerade beschlossen, die ab 2009 geplante Wohngelderhöhung um drei Monate vorzuziehen. Bedürftige erhalten rückwirkend ab dem 1. Oktober rund 140 Euro statt bisher 90 Euro. Außerdem wird der Heizkostenzuschlag für Bedürftige über das Wohngeld aufgestockt. Der Zuschlag wird im kommenden Frühjahr gezahlt. Das beschlossene Schulbedarfspaket bringt eine weitere Entlastung. Wie Herr Duin gerade gesagt hat, kommt dies insgesamt 800 000 Haushalten in der kommenden Heizperiode zugute.
Sie sprechen immer nur von den einkommensschwachen Haushalten, die mit höheren Energiepreisen konfrontiert sind. Was ist eigentlich mit den ganz normalen Arbeitnehmern, den Familien mit Kindern, den Handwerkern und den mittelständischen Unternehmen, die sich anstrengen, Leistungen erbringen, ihren Lebensunterhalt selbst erwirtschaften und die Sozialtransfers mit ihren Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen finanzieren? Sie denken nur über neue Steuern für diese Personengruppen nach; Sie wollen ihnen nur neue Lasten auferlegen, was man zum Beispiel an der Regelung zur Erbschaftsteuer erkennt. Danach soll es den Erben möglichst schwer gemacht werden, den Betrieb weiterzuführen.
Ihr Prinzip ist: Neid hat immer Konjunktur.
Was verbirgt sich nun hinter den Vorschlägen, und wer trägt die Kosten? Die Antwort ist: Das sind die anderen privaten Verbraucher, auf die diese Kosten durch Preiserhöhungen umgelegt werden. Sie zahlen höhere Preise, um das auszugleichen.
Bei dieser Gelegenheit will ich auf einige Instrumente zu sprechen kommen. Natürlich ist es richtig, dass wir alles daransetzen, Wettbewerb auf dem Energiesektor einzuführen. Die Große Koalition ist dabei, die Dinge voranzubringen. Natürlich ist es auch Aufgabe des Staates und des Gesetzgebers, die Voraussetzungen für einen effizienten Markt zu schaffen.
Da vorhin von der Kernenergie die Rede war, will ich auf diesen Punkt eingehen. Ich weiß, dass Sie aus Niedersachsen kommen, Herr Duin. Wenn man die Endlagerfrage zum Casus knacksus macht, dann stellt sich natürlich die Frage, ob durch das bestehende Moratorium die Endlagerfrage irgendwann gelöst werden kann. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass ein Moratorium schon einmal ein Problem gelöst hat. Deswegen ist der Hinweis auf den Koalitionsvertrag natürlich nachvollziehbar. Wir sollten uns in der verbleibenden Zeit schon bemühen, dass wenigstens dort, wo die wissenschaftliche Erkundung weitgehend abgeschlossen ist, festgelegt wird, ob der Standort geeignet ist oder nicht.
Frau Höhn, Sie bringen die Rezession und die hohen Energiepreise in einen direkten Zusammenhang.
Es ist wahr, dass wir in der Vergangenheit den Zusammenhang zwischen dem Wirtschaftswachstum und den Energiepreisen verspürt haben. Aber Sie stellen die Frage, was die Bundesregierung in dieser Beziehung getan hat. Dazu will ich Ihnen wegen der knappen Zeit nur einige Punkte nennen.
Die Umstellung auf andere Energieformen ist bei den deutschen Verbrauchern voll im Gange. Ich sehe, dass sehr viele Haushalte jetzt auf neue Formen der Energie umstellen, nicht zuletzt deswegen, weil die Große Koalition die Förderung neuer Energieformen verstärkt hat. Ich stelle zum Beispiel fest, dass eine ganze Menge von Haushalten jetzt Pelletöfen und Hackschnitzelheizungen einbauen und dass Wärmepumpen jeglicher Art hoch im Kurs stehen. Das ist eine Folge dieser Politik. Um Ihre Frage zu beantworten: Der Bund reagiert für meine Begriffe auf die Herausforderungen richtig. Auch das CO2-Gebäudesanierungsprogramm hat erhebliche Erfolge gezeitigt. Es ist mittlerweile zu einer Stütze der Bauwirtschaft geworden. Insbesondere das Innenausbaugewerbe zieht daraus erhebliche Vorteile.
Ich will auf den Antrag der Linken zurückkommen. Auf wen zielen Sie wirklich ab?
Im Rahmen der Grundsicherung werden die Energiekosten bereits über die Erstattung der Wohnkosten abgegolten.
- Die Stromkosten nicht, aber die Heizkosten werden abgegolten.
- Warmwasser auch nicht; das spielt aber mit 10 Prozent nur eine geringe Rolle.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollege Obermeier, achten Sie bitte auf die Zeit.
Franz Obermeier (CDU/CSU):
Vielen Dank. Ich komme gleich zum Ende.
Ich will nur sagen: Vorhin wurde ausgeführt, dass es in keinem europäischen Land eine derart gute soziale Absicherung für Einkommensschwache gibt. Das ist uneingeschränkt zu unterstützen. Ihr Antrag ist ein Relikt aus der DDR-Zeit, und die wollen wir nicht.
Vielen Dank.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat nun der Kollege Markus Kurth das Wort.
Markus Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn Herr Obermeier von der CDU/CSU-Fraktion fragt, warum wir uns mit diesem Thema überhaupt beschäftigen, dann scheint mir notwendig zu sein, zunächst einmal zwei oder drei Fakten zu präsentieren und sich die Situation zu verdeutlichen.
Nach Berechnungen des Verbraucherzentrale Bundesverbandes werden zum Beispiel die gesamten Energiekosten eines Vierpersonenhaushaltes, also Strom-, Wärme- und Treibstoffkosten, im Jahr 2008 im Vergleich zum Vorjahr um rund 1 000 Euro auf 4 640 Euro gestiegen sein. Es handelt sich folglich um einen erheblichen Anstieg. Im Vergleich zum Jahr 2000 beträgt der Anstieg weitere 1 000 Euro. Innerhalb von acht Jahren haben sich diese Kosten fast verdoppelt. Das heißt, die Geschwindigkeit des Energiepreisanstiegs erfordert natürlich, insbesondere für die einkommensschwächeren Haushalte, eine Antwort. Insofern ist diese Debatte vollständig berechtigt.
Wenn Sie von der Union das in Abrede stellen, dann haben Sie die Zeichen der Zeit nicht erkannt.
Insbesondere für die einkommensschwächeren Haushalte wird die Situation unter Einbeziehung der Mietkosten geradewegs bedrohlich. Wir haben nach Berechnungen des Deutschen Mieterbundes bei den Niedrigeinkommenshaushalten Belastungen durch die Warmmiete von insgesamt 50 Prozent. Das heißt, man gibt die Hälfte seines Einkommens für diesen Bereich aus. Wenn wir das in die Zukunft projizieren, dann zeigt das die Dringlichkeit unseres Handelns.
Das hat natürlich Konsequenzen für die Volkswirtschaft und für die öffentlichen Haushalte; Frau Höhn hat darauf hingewiesen. Bei den angesichts der drohenden weltwirtschaftlichen Rezession bzw. der Abschwächung des Wachstums erwartbaren Exportrückgängen fehlt jeder Euro, der für Energieimporte ausgegeben werden muss, zur Stärkung der Binnennachfrage, die jetzt so wichtig wäre. Wenn wir auf die öffentlichen Haushalte schauen, dann sollten wir die Kommunen in den Blick nehmen: Sie müssen in diesem Jahr voraussichtlich 1 Milliarde Euro mehr für die Kosten der Unterkunft der Arbeitslosengeld-II-Beziehenden ausgeben - allein wegen der gestiegenen Heizkostenanteile. Das heißt, die Notwendigkeit des Handelns ist überhaupt nicht abzustreiten.
Am meisten betroffen sind natürlich Hartz-IV-Beziehende; denn während der Regelsatz von der Großen Koalition seit seiner Einführung 2005 um insgesamt ganze 2 Prozent erhöht wurde, sind im gleichen Zeitraum die Preise für Strom allein um 19 Prozent und die Nahrungsmittelpreise, die mit den Energiepreisen zusammenhängen, um 13 Prozent gestiegen. Herr Duin, streuen Sie den Leuten doch keinen Sand in die Augen, indem Sie sagen: Wir werden uns mit dem Regelsatz beschäftigen. Ich bin im Sozialausschuss, und ich höre, was der Arbeitsminister sagt. Während Sie noch regieren, macht er überhaupt keine Anstalten, am Regelsatz irgendetwas zu ändern. Das ist die Wahrheit, die man sagen muss. Sie sollten hier keinen Nebel verbreiten.
Wir wollen die soziale Frage mit der ökologischen Frage verbinden. Ich kann angesichts der knappen Zeit hier nur auf den Bereich Stromtarife eingehen; Frau Höhn hat zum Bereich Wärme schon einiges gesagt. Wir meinen nicht, dass es eine sinnvolle Lösung ist, Ihrem simplen Modell - Motto ?Freibier für alle? - zu folgen und Sozialtarife unbeschränkt um 50 Prozent zu subventionieren. Mir liegen die DDR-Vergleiche mit Ihrer Fraktion normalerweise überhaupt nicht. Dennoch ziehe ich einen solchen Vergleich jetzt zum ersten Mal, weil das wirklich an die Zeiten erinnert, in denen die Raumtemperatur noch über das Fenster reguliert worden ist. Das kann nicht funktionieren.
Wir wollen vielmehr einen gestaffelten, einen progressiven Stromtarif. Wir diskutieren das. Wir sind der Ansicht, dass das auf jeden Fall in die Überlegungen der Bundesregierung einbezogen werden muss. Wir brauchen Tarifmodelle, wie sie von den Verbraucher- und Umweltverbänden zur Diskussion gestellt werden: Tarifmodelle ohne Grundgebühren, mit vergünstigten Grundkontingenten und einem progressiven Tarifverlauf. Es kann nicht sein, dass Mehrverbrauch mit einem niedrigeren Preis belohnt wird, während diejenigen, die geringe Verbräuche haben, hohe Grundkosten zahlen müssen.
Wir diskutieren diesen Tarif. Ich würde mir wünschen, dass auch die SPD da weiterkäme. Aber sie tut es nicht. Herr Kelber - hören Sie einmal zu! Sie sind gleich dran! Dann können Sie diesen Widerspruch vielleicht erläutern! -, Sie haben in der SPD-Arbeitsgruppe Energie noch am 24. Januar 2008 ganz dicke Backen gemacht und vollmundig gesagt: Die Bundesregierung wird aufgefordert, unverzüglich mit der Energieindustrie in Verhandlungen über die Einführung eines Sozialtarifs zu treten.
- Das habe ich hier schwarz auf weiß.
Im letzten September gab es einen Zwischenbericht der Energiearbeitsgruppe der SPD. In dem heißt es: Wir verzichten jedoch auf sogenannte Sozialtarife für Energie. Wir schlagen daher vor, Geringverdiener durch das Vorziehen der Wohngeldnovelle zusätzlich zu entlasten. - Die dicken Backen sind also zusammengefallen wie nichts.
Gehen Sie mit uns einen Weg der Energieeinsparung, der soziale Postulate und ökologische Postulate effektiv miteinander verbindet, um das absehbar drohende Problem energiepreisbedingter Armut anzugehen.
Vielen Dank.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Von nahezu allen bisherigen Rednern in dieser Debatte angekündigt, hat nun tatsächlich der Kollege Kelber für die SPD-Fraktion das Wort.
Ulrich Kelber (SPD):
Dazu muss ich aber sagen: Ich habe dafür nichts bezahlt.
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die in den letzten Wochen und Monaten gesunkenen Ölpreise verschaffen den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Atempause, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Einige nutzen diese Atempause. Die Bestellungen von Heizöl sind in den letzten Wochen massiv gestiegen. Es gibt schon fast Lieferengpässe. Manche sind so schlau, sich die Preise garantieren zu lassen. Andere merken, dass es nur für einige und nur für einige Zeit eine Atempause ist. Noch haben die Nutzerinnen und Nutzer von Gas keinen Vorteil. Auch bei den Strompreisen hat es keine Erholung gegeben. Das sind zwei Punkte, wo Politik klar sagen muss: Wer Gaspreise unter Bezug auf die Kopplung an den Ölpreis auf den Weltmärkten erhöht, der muss sie jetzt auch senken.
Im November stehen die Entscheidungen für die Phase ab Januar an. Im November müssen die Stadtwerke und die Regionalversorger der Großen die Entscheidung treffen, dass zum 1. Januar, noch mitten in der Heizperiode, die Preise für Erdgas in Deutschland in dem Maß sinken, wie das die Ölnotierungen auf den Märkten hergeben.
Auch beim Strom gilt: Wer Strompreise unter Verweis auf Öl-, Gas- und Kohlepreise erhöht, muss sie in dem Augenblick, in dem Öl, Gas und Kohle auf den Weltmärkten billiger werden, ebenfalls senken. Es kann nicht immer nur in eine Richtung gehen. Ich hoffe, dass das Kartellamt und die Bundesnetzagentur auch auf diesen Bereich schauen, um festzustellen, ob es hier Machtmissbrauch gibt.
Eine Atempause zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie zu Ende geht. Das heißt, dass jetzt die Phase ist, Vorsorge für den Fall zu treffen, dass die Preise wieder anziehen. Wir haben es beim Öl nach wie vor mit einem Verkäufermarkt zu tun. Es sind wenige Regionen. Das Gleiche gilt beim Gas. Wir haben einen nach wie vor steigenden Verbrauch bei sinkenden Ressourcen und sinkenden Fördermöglichkeiten. Das heißt, die Preise werden wieder steigen. Deswegen muss die Atempause genutzt werden, um jetzt vorzusorgen.
Es gibt drei Schritte:
Erstens mehr Effizienz, das heißt weniger verbrauchen. Einsparen und Energieproduktivität erhöhen sind die Möglichkeiten.
Zweitens umstellen auf preisstabile erneuerbare Energien, um als Land, aber auch als einzelne Verbraucherin bzw. einzelner Verbraucher ein Stückchen Energieautonomie zurückzugewinnen.
Drittens. Wir werden soziale Härten dieses Prozesses abfedern müssen.
Was nicht funktioniert - das sage ich sowohl in Richtung der linken Seite im Plenum, zur Linkspartei, als auch in Richtung der rechten Seite im Plenum, zur FDP -, sind die verschiedenen Vorschläge, gegen steigende Weltmarktpreise anzusubventionieren. Ich meine sowohl direkte Überweisungen en masse als auch das Versprechen, beliebige Steuern und Abgaben zu senken, wobei gleichzeitig behauptet wird, dass man den Haushalt konsolidieren will. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Es sind unrealistische populistische Versprechungen, die nicht funktionieren können. Es ist nicht möglich, gegen Weltmarktpreise national anzusubventionieren.
Kommen wir zum ersten Punkt: Erhöhung der Effizienz. Schauen wir uns eine Familie an - zwei Erwachsene, zwei Kinder -, die in einem Einfamilienhaus wohnt. - Man könnte die gleiche Berechnung für eine Familie anstellen, die in einer Etagenwohnung lebt. - Diese Familie zahlt heute in etwa 3 500 Euro an Energiekosten im Jahr. Dass die Menschen Angst haben, wenn die Grundpreise jeder dieser Energieeinheiten, die sie verbrauchen, weiter steigen, kann man sich gut vorstellen. 300 Euro netto pro Monat ist eine Menge Geld und muss erst einmal aufgebracht werden. Mit den vorhandenen wirtschaftlichen Technologien kann die Familie ihre Energiekosten auf 350 Euro im Jahr, auf ein Zehntel, reduzieren.
Jetzt ist die entscheidende Frage: Wie geht das? Dazu sind Investitionen notwendig. Wir sollten einmal über Investitionen und nicht immer nur über - angebliche - Kosten sprechen. Sich lohnende Investitionen sind keine Kosten, sondern sind ein Gewinn.
Deswegen wird Politik sagen müssen: Im Kampf gegen steigende Energiepreise werden die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen in diesem Land investieren müssen. Es lohnt sich. Denen, die diese Investition nicht aus eigener Kraft bewältigen können, müssen wir ganz besonders helfen. Wir brauchen noch gezielter ausgerichtete Förderprogramme als in der Vergangenheit. Dies ist nicht nur für die Menschen gut, die mit dieser Investition ihre laufenden Kosten senken und sich gegen künftig steigende Kosten absichern können - Investitionen sind eine Lebensversicherung gegen steigende Energiepreise, seien es Weltmarktpreise oder überzogene Renditen von Monopolisten oder Oligopolisten im eigenen Land -, sondern auch für das eigene Land, weil jeder Euro, der nicht für einen Energieträger, sondern für einen Handwerker, der ein Haus dämmt, oder für ein neu hergestelltes Gerät, das weniger Energie braucht, ausgegeben wird, sehr viel mehr neue Jobs als der Import von Energieträgern schafft.
Diese Investitionen sind auch die beste Rückgabe der Einnahmen aus den Emissionszertifikaten. Es ist falsch, über eine direkte Rückgabe oder einen Ökobonus das Geld zu verjubeln. Wenn man den Menschen hilft, die richtigen Investitionen zu tätigen, werden sie ab dem zweiten oder dritten Jahr Kumulationsgewinne, Zinseszinseffekte aus den Investitionen erzielen. Den Bürgerinnen und Bürgern Investitionen in Energieeffizienz zu ermöglichen, ist die beste Rückgabe. Damit wird auch den Unternehmen geholfen, weil sie mit den besten Produkten und effizientesten Produktionsprozessen auf den Weltmarkt gehen können. Wir sollten den Schwerpunkt auf die Investitionen legen; das ist gut für das Land und gut für die Menschen.
Ich nenne ein paar Beispiele dafür. Bei den Wohnungen können wir viel erreichen. Die Förderung ist bereits massiv ausgebaut und muss weiter steigen. Ich halte es für sehr wichtig, dass beide Koalitionsfraktionen das klare politische Signal in ihre energiepolitischen Papiere aufgenommen haben, dass wir das Wohnraumsanierungsprogramm durchfinanzieren. Jede Maßnahme, die 2008 und 2009 beantragt wird, wird bezuschusst werden. Beide, CDU/CSU und SPD, wollen dieses Programm bis 2015 mindestens auf dieser Höhe fortsetzen. Das ist ein klares Signal an den Markt: zum Ersten an die Verbraucherinnen und Verbraucher, ihre Wohnungen zu sanieren, zum Zweiten an die Hersteller der entsprechenden Materialien, in neue Fertigungsanlagen zu investieren, damit mehr und preisgünstigere Materialien vorhanden sind, und zum Dritten an das Handwerk, Mitarbeiter und Auszubildende einzustellen, damit diese wichtigen Maßnahmen von noch mehr Menschen umgesetzt werden können.
Mit Contracting werden wir dafür sorgen, dass auch die kleinen Vermieterinnen und Vermieter, die heute den hohen Aufwand scheuen, die Möglichkeit haben, sich daran zu beteiligen. Sie werden dann Dritte beauftragen können, die Maßnahmen für sie durchzuführen.
Natürlich müssen wir auch über Vorschriften sprechen. Es ist richtig, dass wir die Energieeinsparverordnung für Neubauten verschärfen. Aus meiner Sicht sollten wir 2020 bereits beim Passivhausstandard angekommen sein. Ferner sollten wir in Ruhe noch einmal darüber sprechen, ob wir zusätzlich zu den bestehenden Programmen auch beim Altbaubestand einfordern, dass bestimmte Dinge zum Schutz der Mieterinnen und Mieter passieren, die nicht der Entscheidung des Vermieters ausgeliefert bleiben dürfen, ob er ihnen hilft oder nicht.
Wir können bei den Geräten vorangehen. Ich bin ein Anhänger des Top-Runner-Prinzips. Wir haben es noch als rot-grüne Koalition im Juli 2005 beschlossen, und es steht im Koalitionsvertrag. In Brüssel fällt im Rahmen der Öko-Design-Richtlinie der Europäischen Union die Entscheidung, ob wir zumindest Elemente des Top-Runner-Prinzips dort hineinbekommen. Ich weiß, dass im Moment die Möglichkeit besteht, zumindest wichtige Elemente in dieser Richtlinie zu verankern: erstens eine klare Kennzeichnung, die auf dem ersten Blick erkennen lässt, ob ein Gerät im Betrieb teurer als ein besseres Gerät ist, und zweitens eine dynamische Verbesserung der Standards, etwa einen Standard A++, damit niemand, der ein Gerät mit dem Standard A kauft, mehr elektronischen Schrott bekommt. Auch sollten wir uns überlegen, was wir auf der nationalen Ebene tun können. Wir können kein Top-Runner-Programm eins zu eins umsetzen; dies tangierte den EU-Binnenmarkt. Aber wir könnten den Blauen Engel auf den Bereich Energieeffizienz ausweiten; ihn bekämen nur die 10 Prozent energieeffizientesten Geräte einer Kategorie. Dann sähen die Bürgerinnen und Bürgern auch in Deutschland auf einem Blick, ob das Gerät eines der besten ist oder ob es bessere gibt, nach denen sie sich noch umschauen müssen. So muss man den Verbraucherinnen und Verbrauchern im Geschäft helfen, damit sie energieeffiziente Geräte kaufen können.
In der Tat müssen manche Menschen, wenn sie ein Gerät ersetzen oder ein neues beschaffen müssen, sehr auf den Geldbeutel achten. Für sie besteht im Augenblick des Kaufs eine Investitionshürde, die dazu führt, dass sie das billigere Gerät selbst dann kaufen, wenn es nach drei Jahren aufgrund des höheren Stromverbrauchs im Betrieb teurer ist. Über diese Hürde müssen wir uns unterhalten. Niemand sollte das Copyright auf einen bestimmten Vorschlag haben. Ich gehöre zu denjenigen, die befürchten, dass ein reiner Zuschuss etwa über einen Klimascheck zur Verteuerung dieser Geräte in den Geschäften um genau diesen Zuschussbetrag führen wird. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen.
Eine Alternative sind zinslose Minikredite oder ein zinsloses Mini-Contracting. Damit wird Geld für die Anschaffung des besseren Gerätes gegeben, das dann aufgrund der eingesparten Stromentgelte zurückgezahlt werden kann. Der Geldbeutel wird also nicht belastet. Das würde helfen. Es würde die erreichen, die diese Hilfe dringend benötigen. Darüber hinaus würde es Mitnahmeeffekte und eine Verteuerung der Geräte in den Geschäften verhindern.
Mit Blick auf die intelligenten Stromzähler - wir haben dafür gesorgt, dass ab 2010 bei einem neuen Stromzähler ein Rechtsanspruch besteht - hoffe ich, dass viele der Wettbewerber im Strommarkt dafür sorgen werden, dass diese schneller auf den Markt kommen.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollege Kelber, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Reinke?
Ulrich Kelber (SPD):
Ja, selbstverständlich.
Elke Reinke (DIE LINKE):
Vielleicht ist Ihnen ja der Regelsatz für Energie für Hartz-IV-Beziehende bekannt. Es sind 26,24 Euro; aber darin sind auch Instandhaltung und Wohnen enthalten, nicht nur die Energiekosten. Ich denke, die Energiekosten, die entstehen, sind weit mehr als doppelt so hoch. Ich habe jetzt einen Lösungsvorschlag von den Sozialdemokraten erwartet. Uns wurde vorgeworfen, wir würden uns um die Hartz-IV-Beziehenden kümmern. Leider müssen wir uns auch um diese kümmern; denn Sie tun es nicht. Ich erwarte jetzt wirklich einen Vorschlag von Ihnen, wie wir den Menschen helfen können. Das ist nur über den Sozialtarif möglich. Energieeffizienz und Kennzeichnungen an Kühlschränken, von denen Sie sprechen, sind gut und schön; aber diese Menschen haben im Regelsatz gerade einmal 1,40 Euro für die Ansparung einer neuen Waschmaschine. Das heißt, sie brauchen neun Jahre für die Ansparung. Ich warte auf Vorschläge, mit denen den Menschen schnell geholfen werden kann, damit sie nicht vom Zugang zu Energie ausgeschlossen werden und nicht im Dunkeln sitzen müssen.
Danke schön.
Ulrich Kelber (SPD):
Wenn Sie den dritten Teil meiner Rede abgewartet hätten, hätten Sie die Antwort bekommen. Meine Rede ist in drei Teile gegliedert: mehr Effizienz, erneuerbare Energien und die Abfederung sozialer Härten. Aber ich ziehe den dritten Punkt für Sie gerne vor.
Dazu zwei Punkte. Erstens. Zum einen muss genau betrachtet werden, wie jemand eine bestimmte Investition tätigen kann. Dass man sich mit den bisherigen Regelsätzen für die Ansparung, vor allem, wenn man das Pech hat, dass ein Gerät zu Beginn der Ansparungszeit kaputtgeht, kein energieeffizientes Haushaltsgerät leisten kann, ist offensichtlich. Deswegen muss auf der Grundlage des Existenzminimumsberichts ganz genau geklärt werden: Wie hoch ist die Kilowattstundenzahl eines ALG-II-Empfänger-Haushalts, und wie groß muss bei den heutigen Marktpreisen dafür der Anteil in der Pauschale sein? Ich glaube, er wird deutlich höher als heute liegen. Zum anderen müssen wir uns darüber unterhalten, wie solche Investitionen getätigt werden können. Müssen wir Einmalleistungen einführen, oder ist so etwas wie ein zinsloses Mini-Contracting sinnvoll, wobei zum Beispiel die Stadtwerke das Gerät stellen und eine Verrechnung über die Einsparungen im Laufe der zehn oder zwölf Jahre, die das Gerät benötigt wird, erfolgt? Auch das könnte funktionieren. Ich glaube, es ist besser, sich darüber zu unterhalten, als das Geld sofort zu verteilen, nicht wissend, was damit eigentlich passiert.
Der zweite Punkt. Sie können diesen Haushalten auch - ich bin Ihnen, Herr Hill, sehr dankbar, dass Sie das vorhin angesprochen haben - mit einer gezielten Energieberatung helfen. Das haben wir übrigens in meiner Heimatstadt Bonn in den Stadtwerken auf meinen Antrag hin getan. Die örtliche Linkspartei hat dies abgelehnt mit der Begründung, es sei eine Verhöhnung der Menschen, wenn wir ihnen eine kostenlose Energieberatung mit einem Energiestarterpaket anböten. Ich glaube, wir sollten da den Populismus und die Hetze ablegen. Denn diese Menschen und alle Menschen in diesem Land brauchen mehrere Ansätze, um mit den Energiepreisen klarzukommen. Es darf nicht der Einzelne diskreditiert werden, nur weil es gerade in die parteipolitische Linie passt. - Vielen Dank.
Der zweite Bereich, mit dem ich mich in meiner Rede befassen will, sind die erneuerbaren Energien. Sie sind preisstabiler - ich lasse jetzt bei den Bioenergien bestimmte Dinge außen vor -, und sie werden im Verhältnis bereits jetzt jedes Jahr preisgünstiger. Zu bestimmten Zeiten stabilisieren sie bereits die Märkte an der Börse.
Vielleicht ein kleiner Einschub, Frau Kopp von der FDP; denn Sie haben davon gesprochen, dass die Scheuklappen abgelegt werden müssten, und Sie haben den Begriff ?Stromlücke? verwendet. Ich gestehe dem Begriff ?Stromlücke? zu, dass er PR-technisch hervorragend ausgedacht ist. Aber ich nenne Ihnen jetzt sieben Studien zu diesem Thema und bitte Sie, eine davon zu lesen. Das sind zunächst die drei Studien aus dem Energiegipfel bei Angela Merkel. Sie tragen die Unterschrift von Angela Merkel, Michael Glos und Sigmar Gabriel. Alle drei Studien ergeben, dass es keine Stromlücke gibt. Dann gibt es die Studie von dena, bei der sich Herr Kohler, der Chef der dena, dagegen verwahrt, dass diese Studie in dem Sinne herangezogen wird, er hätte eine Stromlücke festgestellt. Ferner gibt es die Studie des Bundeswirtschaftsministers aus diesem Jahr, aus der klar hervorgeht, dass es keine Stromlücke gibt. Die Studie des Umweltbundesamtes bringt ebenfalls zum Ausdruck, dass es keine Stromlücke gibt. Frau Kopp und Herr Pfeiffer, den Jahresbericht der Bundesnetzagentur hätten Sie vor unserem Treffen vor ein paar Wochen lesen müssen. Auch in diesem steht, dass es keine Stromlücke gibt. Sie hätten sich doch auf die Sitzung vorbereiten und das lesen müssen. Dann hätten Sie nicht wieder das Gegenteil behauptet. Ich erwarte, dass Sie das wenigstens lesen, bevor Sie sagen, dass Sie keine ideologischen Debatten wollen.
Wir müssen die erneuerbaren Energien noch verstärkter einführen. Wir haben einen sehr großen Erfolg im Bereich Strom zu verzeichnen: 14,2 Prozent. Im vergangenen Jahr sind fast drei Prozentpunkte hinzugekommen. Wenn übrigens die Geschwindigkeit des letzten Jahres eingehalten würde, dann hätten wir im Jahr 2010 eine so große Strommenge aus erneuerbaren Energien, wie es die zuvor zitierte Studie des Wirtschaftsministers für das Jahr 2020 einschätzt und zudem davon spricht, dass es keine Stromlücke gibt. Wir haben dann aber immer noch zehn Jahre der Einführung vor uns, in denen wir einen Anteil erneuerbarer Energien von 30 Prozent, 40 Prozent bzw. 45 Prozent erreichen können.
Nicht so gut sind wir im Bereich Wärme; nicht so gut sind wir im Bereich der Kraftstoffe. In diesem Bereich müssen wir noch einiges tun, um es allen Menschen zu ermöglichen, zu investieren. Ich finde es gut, dass wir im Bereich des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes so weit gekommen sind, dass wir zwar nur für die Altbauten Vorschriften gemacht haben, für Neubauten aber eine starke Förderung von 500 Millionen Euro pro Jahr bis zum Jahr 2012 festgelegt haben. Die energiepolitischen Papiere sagen, dass diese Programme bis mindestens 2015 so weiterlaufen sollen.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Pfeiffer? Herr Kollege Hill hat sich außerdem gemeldet.
Ulrich Kelber (SPD):
Sowohl Koalition als auch Opposition sind herzlich willkommen.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Dann hat zunächst Herr Kollege Dr. Pfeiffer das Wort.
Dr. Joachim Pfeiffer (CDU/CSU):
Lieber Herr Kelber, ich bin etwas erstaunt über Ihre Zitierung der Gutachten. Sie haben beispielsweise Herrn Kohler zitiert. Ich bin Vorsitzender des Beirates für Energie der Gesellschaft zum Studium strukturpolitischer Fragen, Frau Kollegin Kopp ist dort stellvertretende Vorsitzende. Wir hatten kürzlich Herrn Kohler zu diesem Thema zu Gast, der uns anhand eines Power-Point-Vortrages basierend auf dieser Studie dargelegt hat, dass es eine Stromlücke geben wird, wenn wir die Dinge nicht ändern.
Insofern bin ich etwas verwirrt über diese Aussage. Meine Informationen sind in der Tat differenzierter. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen nacharbeiten. Ich weiß nicht, ob Sie Herrn Kohler richtig zitieren.
Ulrich Kelber (SPD):
Herr Pfeiffer, zwei Dinge: Erstens möchte ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, eine Website aufzurufen, auf der etwas über die Gesellschaft nachzulesen ist, in deren Beirat Sie sind. Dann werden sie sehen, dass sie nicht so ganz pluralistisch aufgestellt ist und nicht die ganze Bandbreite der Diskussion abgedeckt wird.
Zweitens zurück zu den Themen Herr Kohler, dena und Studie. Wenn Sie die Begriffe ?Kohler?, ?Stromlücke? und ?dena? bei Google oder bei einer anderen Suchmaschine eingeben, dann werden Sie die Stellen sehr schnell finden. Herr Kohler hat ganz klar gesagt: Daraus eine Stromlücke per se abzuleiten, ist falsch. Er hat gesagt: Es gibt dann eine Stromlücke, wenn wir keine neuen Kraftwerke mehr in diesem Land bauen.
Das ist eine Binsenweisheit.
Wenn in den nächsten zwölf Jahren kein abgeschaltetes Kraftwerk durch ein neues ersetzt wird, dann entsteht ein Defizit. Frau Kopp hingegen hat versucht, zu erzählen: Wenn keine Atomkraftwerke mehr weiterbetrieben werden, dann entsteht eine Stromlücke. Herr Kohler sagt hierzu, dass dies eindeutig falsch ist.
Er weist in der Studie nach: Atomausstieg plus Neubau von ausfallenden Kraftwerken gewährt einen vollen Ersatz. Es gibt keine Stromlücke. Wir können ihn gern zur nächsten Sitzung des Umwelt- oder des Wirtschaftsausschusses einladen. Dann wird er Ihnen sagen, dass genau das darin steht.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Jetzt stellt Herr Kollege Hill seine Frage. Ich mache darauf aufmerksam, dass ich ab jetzt so verfahren werde, wie es der Präsident bereits beim ersten Tagesordnungspunkt getan hat, dass ich restriktiv bei denjenigen das Fragerecht ein Stück weit einschränken werde, die schon geredet und sich in die Debatte eingemischt haben. Hierzu haben wir heute Morgen eine Verabredung getroffen.
Hans-Kurt Hill (DIE LINKE):
Herr Kelber, ich erwarte von Ihnen eine Aussage zu einem Artikel, den ich heute in der Saarbrücker Zeitung gelesen habe. Dort wird berichtet, Mieter sollen Heizkosten kürzen dürfen. Dabei geht Herr Gabriel mit seinem Kollegen Glos ein bisschen strenger ins Gericht. Wenn ich diese Forderung als Überschrift lese - ich gehe davon aus, dass dies zitatfähig ist -, dann stellt sich für mich die Frage, ob vor der Heizperiode damit zu rechnen ist.
Ulrich Kelber (SPD):
Da die Saarbrücker Zeitung leider, obwohl meine Frau in dieser Stadt geboren worden ist, nicht zu meiner täglichen Lektüre gehört, kenne ich den Artikel nicht exakt. Aber das, was Sie zitieren, hat Sigmar Gabriel nicht das erste Mal gesagt. Übrigens, auch ich habe mich mehrfach dafür ausgesprochen. Deswegen habe ich gerade gesagt: Wir sollten darüber gemeinsam diskutieren.
Ich bin der Meinung, dass auch für den Altbaubestand eine Energieeinsparverordnung gelten muss. Wir haben ja heute bereits zwei Vorschriften: Die oberste Geschossfläche muss gedämmt werden, und bestimmte alte Heizungssysteme müssen ausgetauscht werden. Ich bin der Meinung, dass wir Stück für Stück - aber nie so wie beim Neubau - zusätzliche Vorschriften einführen müssen. Für den Fall, dass Vermieterinnen und Vermieter trotz aller Förderung diesen Vorschriften nicht nachkommen, bin ich der Meinung, dass die Mieterinnen und Mieter ihre Heizkosten auf das maximale Niveau, das bei Einhaltung der Vorschriften bestünde, kappen können. Dafür setze ich mich ein - sowohl innerhalb der eigenen Partei, in der es sehr viele gibt, die das unterstützen, als auch innerhalb der Koalition, wobei vom Koalitionspartner schon angekündigt wurde, dies nicht mitzutragen. Sie kennen das ja aus Koalitionen, in denen Sie beteiligt sind - sei es in Berlin mit der SPD, sei es in anderen ostdeutschen Städten mit der CDU -: Auch dort dürfen Sie nicht all das, was Sie sich vorgenommen haben, in den Stadtrat einbringen.
Ich hatte schon davon gesprochen, dass soziale Härten abgefedert werden müssen. Ein Beispiel ist erwähnt worden: das Wohngeld. 800 000 Haushalte werden davon profitieren, dass in diese Pauschale ein Heizkostenelement eingerechnet worden ist; Herr Obermeier hat schon darauf hingewiesen, um wie viel die entsprechenden Zahlen steigen. Das ist ein hoher Anstieg für den durchschnittlichen Haushalt. Dieses Geld wird Anfang des Jahres 2009 fließen. Genau dann, wenn aufgrund der im Vergleich zu den vorherigen Wintern deutlich gestiegenen Heizkosten eine hohe Nachforderung auf viele Mieterinnen- und Mieterhaushalte zukommt, aber auch viele höhere Nachzahlungen von ihrem Gasversorger für die Heizung in ihrem Einfamilienhaus erhalten werden, werden 800 000 Haushalte zusätzliches Geld in der Hand haben, um diese Nachforderung zu bezahlen.
Wir werden die Mobilität sichern müssen. Deswegen muss der Bund zusammen mit den Ländern und Kommunen den ÖPNV-Ausbau angehen. Wer sich die Situation in den Kommunen anschaut, weiß: Der ÖPNV ist in den letzten Jahren nicht zurückgebaut worden, aber die Defizite sind verringert worden. Aus dieser Kraft heraus, dass der ÖPNV eine wesentlich bessere Deckung seiner Ausgaben über seine Einnahmen erzielt, muss es jetzt ein Ausbauprogramm geben.
Als letzten Punkt spreche ich die Effizienztarife an. Ich danke dem Kollegen von den Grünen, dass er noch einmal darauf verwiesen hat, dass die SPD in 2007 und 2008 die erste Partei war, die darüber gesprochen hat. Aber es ging nie um einen Sozialtarif; es ging immer um einen sozialen Effizienztarif. Wir haben heute in Deutschland die Situation, dass die Kilowattstunde Strom umso teurer ist, umso weniger ich verbrauche. Das muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden - sei es freiwillig, sei es gesetzlich.
Sozialtarife sind falsch. Wir haben nichts zu verschenken, auch nicht Strom. Aber wir müssen die Dinge so gestalten, dass wir erstens einen fairen Wettbewerb haben. Das fehlt mir manchmal. Ich möchte nicht, dass die Stadtwerke gezwungen sind, soziale Effizienztarife anzubieten, und die Eon-Tochter die lukrativen Kunden übernehmen kann. Dies muss zweitens natürlich pro Kopf ausgestaltet sein; denn ich will keine Bevorteilung des Single gegenüber der Familie. Das kann man tun, ohne bürokratische Hürden aufzurichten. Dann haben wir etwas erreicht, was allen hilft. Wir haben die Chance der Atempause genutzt, indem wir uns auf in Zukunft wieder steigende Energiepreise vorbereitet haben.
Vielen Dank.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Zu einer Kurzintervention hat die Kollegin Kopp das Wort.
Gudrun Kopp (FDP):
Vielen Dank. - Herr Kollege Kelber, wir sollten uns nicht gegenseitig vorwerfen, bestimmte Gutachten gelesen oder nicht gelesen zu haben. Ich glaube, das ist unter Niveau.
Ich danke dem Kollegen Pfeiffer sehr herzlich für die Richtigstellung. Ich habe die Ausführungen von Herrn Kohler zu seinem Gutachten, das übrigens von der Bundesregierung bei ihm in Auftrag gegeben wurde,
zweimal gehört. Er hat gesagt: Wenn es dabei bleibt, dass der Ausstieg aus der Kernenergie vollzogen wird, und wenn wir beim Neubau von konventionellen Kraftwerken nicht nennenswert weiterkommen - er hat nicht gesagt: ?wenn keine weiteren neuen gebaut werden?, sondern: ?wenn keine neuen Kohlekraftwerke gebaut werden, wie es eigentlich nötig wäre; leider sind es meist Kohlekraftwerke, aber so ist es? - und wenn wir beim Netzausbau nicht vorankommen, dann haben wir ein Problem, und dann ist die Stromlücke eine reale Gefahr, die wir sehen müssen. Da hat es überhaupt keinen Zweck, das vertuschen zu wollen.
Sie haben zwar eben etwas differenzierter in Ihrer Antwort auf eine Nachfrage argumentiert. Aber ich bitte Sie wirklich, mit solcherlei Totschlagargumenten wie ?nicht gelesen?, ?nicht zur Kenntnis genommen? vorsichtiger zu sein. Die Fakten sind andere. Die werden Sie auch durch Verdrängung nicht umdrehen. Ich bitte Sie, das einfach zur Kenntnis zu nehmen.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollege Kelber, Sie haben das Wort zur Erwiderung.
Ulrich Kelber (SPD):
Sie haben mehrere Sachen miteinander vermischt.
Das eine war die Aussage, dass Sie als Mitglied des Beirats der Bundesnetzagentur eigentlich die Pflicht gehabt hätten, den Entwurf des Jahresberichts der Bundesnetzagentur zu lesen, in dem steht: Die Versorgung in Deutschland ist gesichert.
Die Bundesnetzagentur ist die staatliche Einrichtung. Die andere ist die Deutsche Energie-Agentur. Sie wissen, dass die dena-Studie nicht von der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurde, sondern von anderen. Herr Kohler hat auf Nachfrage mehrfach gesagt: Deutschland kann die Versorgung mit einem Ausstieg aus der Atomenergie dann sicherstellen, wenn es nicht einen organisierten politischen Widerstand gegen den Neubau der damit verbundenen Ersatzkraftwerke für ausscheidende Kohlekraftwerke gibt. Er hat nicht gesagt - das ist ein ganz wichtiger Punkt -, dass es Ersatzkohlekraftwerke für ausscheidende Atomkraftwerke geben muss, sondern, dass die ausscheidenden Kohlekraftwerke ersetzt werden müssen, sei es durch Kohle-, sei es durch Gaskraftwerke.
In diesem Abschnitt des Gutachtens steht ganz klar: Wenn man beides macht, die Atomkraftwerke abschaltet und alle fossilen Kraftwerke, die ausscheiden, nicht ersetzt, dann sieht er keine gesicherte Versorgung,
und damit ist er auf der Linie der SPD-Bundestagsfraktion.
Sie können nicht erst über Atomenergie sprechen - danach setzen Sie vielleicht für sich ein geistiges Komma - und anschließend über eine Stromlücke, womit Sie beides in einen Zusammenhang stellen.
Dieser Zusammenhang ist falsch. Das ist unfair. Die Aussage von Herrn Kohler, die Sie zitiert haben, haben Sie entweder nicht richtig verstanden oder hier unrichtig dargestellt.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Nun hat der Kollege Dr. Georg Nüßlein für die Unionsfraktion das Wort.
Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es wird Sie vielleicht überraschen, wenn ich einleitend sage: Die Kollegin Höhn hat recht mit ihrer Problembeschreibung, dass wir mittlerweile bis in die Mittelschicht hinein ein Einkommensproblem haben. Deshalb sagen wir: Im Zentrum unserer Politik muss die Frage stehen, wie die Leute in diesem Land wieder zu einem höheren Nettoeinkommen kommen.
Meine Damen und Herren von der Linken, dieses Problem kann man nicht durch billigen oder, wie ein Kollege gesagt hat, ?aufgewärmten? Populismus lösen. Der Kollege Pfeiffer hat das anschaulich mit dem Satz ?Freibier für alle!? beschrieben. Wenn es das wenigstens wäre, hätte ich als Bayer eine gewisse Sympathie dafür. Sie sagen aber nur: Freibier für unsere Klientel!
Das ist die Problematik, über die wir hier reden. Sozialtarife beim Strom; warum nicht auch Sozialtarife für den täglichen Bedarf? Das ist heute schon gefragt worden. Ich kann die Frage beantworten: Weil Sie den Sozialismus im Hinterkopf haben, weil Sie staatliche Preisfestsetzungen in den Bereichen Strom, Arbeit - Stichwort Mindestlohn - usw. wollen und weil Sie natürlich die Verstaatlichung der Energieversorger im Kopf haben.
Auch deshalb kommen solche Anträge zustande.
Das ist falsch. Das ist der falsche Weg. Wir gehen einen anderen. Ich bin davon überzeugt, dass er besser ist. Wir setzen auf mehr Wettbewerb und mehr Dynamik.
Stichwort Sozialpolitik. Der Kollege Obermeier hat gesagt: Der soziale Ausgleich erfolgt in diesem Land über Sozialtransfers, über das Steuersystem, nicht über einzelne Güter. Ich möchte hinzufügen: Der soziale Ausgleich erfolgt über den Staat, nicht über die Unternehmen. Ich sage auch, warum Sie etwas anderes fordern: Sie wissen, dass unser Haushalt mittlerweile zu 50 Prozent aus einem Sozialhaushalt besteht. Da gibt es natürlich keine zusätzlichen Spielräume. Also müssen Sie sich für Ihre Klientel etwas Neues einfallen lassen, möglichst etwas, was man nicht sieht, was man vertuschen kann, weil die Übersichtlichkeit fehlt. Da fallen Ihnen halt solche Dinge ein.
Ich stelle Ihnen die Frage: Wo bleiben die Bürger, die mit harter Arbeit jeden Tag das Überleben ihrer Familie sichern? Wo bleiben die?
Herr Hill, da Sie sich hier so lautstark zu Wort melden: Ich habe Ihren Vorschlag vernommen. Sie fordern Energieschecks und damit einen neuen Fernseher für die, die nicht arbeiten; die, die arbeiten, brauchen keinen, weil sie keine Zeit zum Schauen haben.
- Sie haben doch einen neuen Fernseher gefordert.
- Sie haben das vorhin gesagt. - Auch beim Thema Umverteilung haben Sie ein Rezept. Sie schreiben in Ihrem Antrag: Diese Umverteilung findet zulasten der Gewinne der Energieversorger statt. - Wenn Sie es realistisch betrachten, würde die Umsetzung dieses Vorschlags eine Umverteilung zulasten derjenigen bedeuten, die nicht begünstigt sind, die keine Sozialtarife bekommen und als Verbraucher wieder einmal die Zeche zahlen.
Der Kollege Kurth von den Grünen sagt, dass die Grünen die soziale Frage mit der ökologischen verbinden wollen. Das haben sie schon einmal im negativen Sinne getan. Damals, als der Benzinpreis noch relativ niedrig war, haben Sie gefordert, dass der Staat ihn auf 5 DM heraufsetzen solle. Daran sieht man, was Sie unter der sozialen Frage verstehen und was Sie mit dieser Verknüpfung meinen.
- Sie sprechen die Mehrwertsteuer an. Ein Strompreistreiber ist natürlich auch in einem nicht zu unterschätzenden Umfang mit 40 Prozent der Staat. Aber wer Senkungen fordert, der muss natürlich auch sagen, wo denn die Einsparungen stattfinden sollen. Von den Linken habe ich, seit sie wieder im Bundestag sitzen, von Einsparungen nie etwas gehört, sondern nur zur Frage, wo es noch Möglichkeiten gibt, Geld auszugeben.
Wenn man über das Thema Strompreistreiber redet, muss man aus meiner Sicht auch dringend über das Thema Emissionshandel sprechen. Wenn wir hier etwas falsch machen, dann kann das eine gigantische Deindustrialisierungsstrategie für Deutschland bedeuten.
Ich kann jedem nur sagen: Wir müssen genau hinschauen, was da letztlich abläuft. Wir können doch nicht die energieintensiven Branchen einfach so zusätzlich belasten und glauben, wir würden einen Beitrag zum Klimaschutz dadurch leisten, dass man diese Branchen aus der Europäischen Union treibt.
Was mich an dieser Stelle auch wurmt, ist die Industriepolitik, die in Europa betrieben wird. Die Franzosen lehnen sich zurück und sagen: 80 Prozent unseres Strombedarfs decken wir mit Kernenergie. Die Deutschen sollen einmal sehen, wie sie mit dem Emissionshandel klarkommen und wie sie ihre Emissionen zurückfahren. - Gleichzeitig werden in Frankreich zum Beispiel die Chemieunternehmen durch einen Staatskonzern - die Liberalisierung ist da nicht angekommen - mit billigem Strom subventioniert. Über diese Dinge müssen wir reden. Ich bin dem Bundeswirtschaftsminister dankbar, dass er das auch offen und klar tut.
- Lieber Herr Kollege, wenn das der Herr Bundesumweltminister auch macht, dann ist das eine feine Sache; denn dann haben wir die doppelte Durchschlagskraft und können zeigen, wie handlungsfähig die Große Koalition an dieser Stelle ist. Ich hoffe nur, dass er das tatsächlich tut.
Lassen Sie mich kurz etwas zum Energiemix sagen. Ich glaube nicht, dass dann, wenn man eine Energieform, mit der billig produziert wird, aus unserem Energiemix herausnimmt und durch eine offenkundig teurere ersetzt, in diesem Land die Energiepreise sinken werden. Diese Rechnung muss mir erst einmal irgendjemand hier erklären. Ich habe vorhin erst wieder gehört, die Atomenergie sei wie ein Flieger ohne Landebahn, weil wir noch kein Endlager hätten. Dazu muss ich sagen: Die Große Koalition hat in der Tat keinen Beitrag dazu geleistet, dass wir an dieser Stelle vorankommen. Das liegt nicht an der Union.
Ich sage aus meiner Sicht ganz klar: Wir müssen das Moratorium für Gorleben aufheben, weil uns niemand glaubt, dass wir uns ernsthaft mit diesem Thema beschäftigen, wenn man gleichzeitig ein Moratorium aufrechterhält.
Was aus meiner Sicht auch entscheidend ist, ist, dass wir bei alledem, was wir energiepolitisch machen, schauen müssen, dass die Wertschöpfung in unserem Land bleibt. Das gilt für die erneuerbaren Energien. Das gilt aber ganz genauso auch für die Energieversorgung. Ich möchte, dass bei uns Kraftwerke gebaut und bei uns betrieben werden, dass hier Arbeitsplätze entstehen und dass wir unabhängig und sicher Energie produzieren können. Das muss gerade auch in einer Finanzkrise, in der man wieder einmal merkt, wie wichtig und wie zentral der Schirm der Nation ist, ein Anliegen sein.
Vielen herzlichen Dank.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Als letzter Redner in dieser Debatte hat nun der Kollege Andreas Lämmel für die Unionsfraktion das Wort.
Andreas G. Lämmel (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Abschließend bleibt festzuhalten, Herr Hill: Der Antrag der Linken ist einfach scheinheilig. Ich will Ihnen das ganz klar nachweisen.
Wir wollen kein VEB Energiekombinat mehr; Herr Hill, das wollen Sie ja wieder einführen. Denn die Lasten des VEB Energiekombinats müssen wir noch heute abbezahlen. Sie wissen, die ökologische Sanierung der alten Braunkohletagebau- und Kraftwerkslandschaften in Ostdeutschland hat den Steuerzahler in Deutschland Milliarden gekostet.
Das müssen Sie bei dieser Politik zu einem Energiekombinat hin berücksichtigen.
Sie wollen nun einen Sozialtarif einführen, erklären aber den Verbrauchern nicht, woher die hohen Strompreise zum großen Teil kommen. 40 Prozent - Kollege Nüßlein hat es gesagt - sind staatlich verursacht. Sie haben da überall mitgemacht. Sie haben überall zugestimmt, zum Beispiel beim Erneuerbare-Energien-Gesetz.
- Ich habe nicht zugestimmt; tut mir leid.
Nun sagen Sie den Verbrauchern auch ganz deutlich, Herr Hill, dass das Milliarden kostet.
Das kostet in den nächsten Jahren regelmäßig Milliarden zusätzlich auf den Strompreis.
Herr Hill, Sie kämpfen vor Ort gegen den Energiemix in Deutschland. Sie kämpfen gegen die Braunkohle, obwohl Sie ganz genau wissen, dass die Braunkohle der einzige subventionsfreie Energieträger in Deutschland ist.
Sie kämpfen gegen die Steinkohle. 25 Prozent des Stroms in Deutschland kommen aus der Steinkohle; 25 Prozent kommen aus der Braunkohle. Wenn Sie das alles bekämpfen, müssen Sie dazu sagen, woher der Strom kommen soll.
Sie kämpfen gegen den Atomstrom.
Auch das sind 25 Prozent. Herr Hill, insgesamt bekämpfen Sie 75 Prozent der deutschen Stromproduktion. Sagen Sie doch bitte schön, woher dann bezahlbarer Strom kommen soll.
Sie kämpfen gegen Freileitungen. Sie wollen den Großteil der Kabel in die Erde vergraben. Das kostet Geld und würde den Strompreis belasten. Kollege Nüßlein hat zur Versteigerung der CO2-Zertifikate gesprochen. Auch das wird nach Ansicht aller Experten zu einem weiteren Schub bei den Preisen führen. Über all diese Maßnahmen diskutieren Sie nicht mit den Verbrauchern. Das ist scheinheilig und kann einfach nicht die Politik sein, die Unterstützung findet.
Jetzt noch zu dem Thema, wie wir weiterhin bezahlbare Strompreise ermöglichen können. Ich plädiere weiterhin für eine Verlängerung der Restlaufzeiten. Denn aus der gewonnenen Strommenge, die durch die Verlängerung entstehen würde, könnte man einen Fonds bilden, aus dem Energieeffizienzmaßnahmen oder andere Maßnahmen, die verschiedentlich vorgeschlagen worden sind, finanziert werden.
Der Strom, der aus einer Verlängerung der Restlaufzeiten der Atomkraftwerke resultieren würde, ist der preiswerteste, der im Moment in Deutschland hergestellt werden kann.
Wir müssten doch verrückt sein, wenn wir uns diese Quelle - vorausgesetzt natürlich, die Sicherheit der Kraftwerke ist gegeben - abschneiden würden.
Noch zwei Argumente, Herr Hill, die zeigen, dass Sie Nebelkerzen werfen, dass Sie den Leuten die Augen verkleistern wollen. Zum Thema Energieberatung: Wenn Sie einen Blick in den Haushaltsplan 2009 des Wirtschaftsministeriums werfen, sehen Sie, dass die Bereiche Energieberatung und Energieeffizienz doppelt so hoch ausgestattet sind wie im letzten Jahr. Das hätte Ihnen auffallen müssen. Damit werden zum Beispiel Energieberatungen bei den Verbraucherzentralen finanziert. Das heißt, wer Energieberatung wünscht, kann überall flächendeckend in Deutschland Energieberatung bekommen. Er bekommt, mit staatlichen Mitteln unterstützt, eine Beratung vor Ort geboten.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollege Lämmel, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Bulling-Schröter?
Andreas G. Lämmel (CDU/CSU):
Bitte.
Eva Bulling-Schröter (DIE LINKE):
Danke schön, Kollege Lämmel. Sie haben uns unterstellt, dass wir die Strom- und Energiepreise erhöhen wollen. Jetzt würde ich Sie gerne fragen, ob Ihnen bekannt ist, dass für die Energieunternehmen von 2008 bis 2012 durch die Nichtversteigerung von 90 Prozent der Zertifikate ein Sonderprofit in Höhe von 35 Milliarden Euro entsteht. Das ist keine Berechnung der Linken, sondern eine des Öko-Instituts, das ja nicht in der Gefahr steht, so sehr links zu sein.
- Darüber können wir später diskutieren.
Meine zweite Frage an Sie ist: Kennen Sie den Bericht des Öko-Instituts zum EU-Emissionshandel? Sie haben vorhin gesagt: Wenn es nicht weiterhin kostenlose Zertifikate gibt, dann wird die Industrie wegbrechen; das hat auch Ihr Vorredner gesagt.
Hierzu gibt es eine Studie, in der man zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Kostensteigerung in diesem Bereich 1 Prozent beträgt. Diese vom WWF in Auftrag gegebene Studie ist sehr neu. Ich würde Ihnen empfehlen, sie einmal zu lesen.
Andreas G. Lämmel (CDU/CSU):
Ja. Vielleicht schicken Sie mir einmal ein Exemplar vorbei. Ich habe sie nämlich noch nicht gelesen.
Trotzdem bleibt es dabei: Eine 100-prozentige Versteigerung ab 2013, wie sie jetzt angelegt ist, wird zu einem großen Strompreisschub führen;
das ist unbestritten.
Zur ersten Frage, die Sie gestellt haben: Kein Redner der Union hat gesagt, dass die unentgeltliche Zuteilung von Zertifikaten fortgeführt werden soll. Es ist ein großes Ärgernis, dass die Energiekonzerne die unentgeltlich ausgeteilten Zertifikate in den Strompreis eingepreist haben. Was das angeht, sind wir nicht unterschiedlicher Meinung.
- Dass Sie immer wieder Ideen haben, wie der Staat höhere Steuereinnahmen erzielen kann, wissen wir; das ist uns klar. Ihre Anträge werden aber nicht besser, wenn Sie Ihre Forderungen ständig wiederholen.
Ich möchte noch ganz kurz auf Folgendes hinweisen: Wenn Sie sich den Haushaltsplan ansehen, stellen Sie fest, dass die Mittel für die Energieforschung in allen betreffenden Haushalten, im Umweltministerium, im Wissenschaftsministerium und im Wirtschaftsministerium, enorm erhöht worden sind. Auch die Mittel für Energieeffizienz in der Wirtschaft sind enorm erhöht worden. Der Staat stellt für alle Bereiche der Energieeinsparung sehr viel Steuergeld zur Verfügung,
um auf diesem Gebiet in Deutschland voranzukommen.
Ich komme zum Schluss. Sie betreiben Vernebelungspolitik. Auf der einen Seite jammern Sie.
Auf der anderen Seite sagen Sie aber nicht, dass Sie den Maßnahmen, die letztlich bedauerlicherweise zu hohen Energiekosten geführt haben, selbst zugestimmt haben. Herr Hill, ich kann nur das wiederholen, was meine Kollegen bereits gesagt haben: Familien mit Kindern, deren Haushaltseinkommen nur knapp über der Grenze der Sozialhilfe liegt, haben Sie in Ihrem Antrag überhaupt nicht berücksichtigt;
diesen Familien fällt es noch viel schwerer, diese hohen Kosten zu tragen. Daher können wir Ihrem Antrag nicht zustimmen.
Danke schön.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 16/10510 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden? - Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen.
Die Vorlage auf Drucksache 16/10585 soll ebenfalls an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse überwiesen werden, jedoch ist die Federführung strittig. Die Fraktionen der CDU/CSU und der SPD wünschen Federführung beim Ausschuss für Wirtschaft und Technologie. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wünscht Federführung beim Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
Ich lasse zuerst über den Überweisungsvorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, das heißt Federführung beim Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, abstimmen. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? - Wer stimmt dagegen? - Gibt es Enthaltungen? - Dann ist der Überweisungsvorschlag gegen die Stimmen der Antragsteller abgelehnt.
Ich lasse nun über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD, das heißt Federführung beim Ausschuss für Wirtschaft und Technologie, abstimmen. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? - Wer stimmt dagegen? - Gibt es Enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist der Überweisungsvorschlag gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen von den übrigen Fraktionen angenommen.
[Der folgende Berichtsteil - und damit der gesamte Stenografische Bericht der 183. Sitzung - wird am
Freitag, den 17. Oktober 2008,
an dieser Stelle veröffentlicht.]