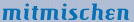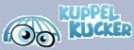184. Sitzung
Berlin, Freitag, den 17. Oktober 2008
Beginn: 8.00 Uhr
* * * * * * * * V O R A B - V E R Ö F F E N T L I C H U N G * * * * * * * *
* * * * * DER NACH § 117 GOBT AUTORISIERTEN FASSUNG * * * * *
* * * * * * * * VOR DER ENDGÜLTIGEN DRUCKLEGUNG * * * * * * * *
Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner:
Die Sitzung ist eröffnet.
Ich rufe den Zusatzpunkt 7 auf:
Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU und der SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes (Finanzmarktstabilisierungsgesetz - FMStG)
- Drucksache 16/10600 -
Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)
- Drucksache 16/10651 -
Berichterstattung:
Abgeordnete Otto Fricke
Dr. Gesine Lötzsch
Alexander Bonde
Steffen Kampeter
Carsten Schneider (Erfurt)
Hierzu sind Änderungs- und Entschließungsanträge angekündigt.
Ich möchte darauf hinweisen, dass wir über den Gesetzentwurf später namentlich abstimmen.
Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache eineinhalb Stunden vorgesehen. - Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.
Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Fraktionsvorsitzende Dr. Peter Struck, SPD.
Dr. Peter Struck (SPD):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Regierung, die Koalition, aber auch das Parlament haben in einem beispiellosen Kraftakt das Ihre zur Bewältigung der Finanzmarktkrise geleistet. Ich will sagen, dass ich als leidenschaftlicher Parlamentarier natürlich weiß, dass es eine Zumutung für das ganze Haus ist, ein solches Gesetz in nur einer Woche durchzuziehen. Aber wir hatten überhaupt keine andere Chance im Kampf gegen die Uhr, um schneller zu sein und keine Gefährdung heraufkommen zu lassen.
Für diesen Vertrauensvorschuss des Parlaments erwarte ich allerdings von der Bundesregierung, von der Exekutive, dass der Bundestag eng eingebunden wird und dass ihm alle erdenklichen Kontrollmöglichkeiten zugestanden werden.
Das erwarte ich nicht nur im Interesse der Koalitionsfraktionen, sondern auch im Interesse der Oppositionsfraktionen. Bei allem Streit in der Sache haben sie durch ihren Verzicht auf formale Fristeinhaltung dazu beigetragen, dass die von uns für richtig gehaltene Rezeptur ihre Wirkung möglichst bald entfalten kann. Ich halte es für angemessen und notwendig, dass ein zusätzliches Gremium die Fragen des Finanzmarktes erörtern und das Vorgehen der Bundesregierung begleiten und kontrollieren wird, so wie es in der Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses jetzt vorgesehen ist.
Ich zolle der Bundesregierung Respekt für ihr sehr entschlossenes Handeln. Ich möchte vor allem dem Finanzminister danken, ein Rettungsszenario aufgezeigt zu haben, das international eingebettet ist und dennoch den speziellen deutschen Bedürfnissen ausdrücklich Rechnung trägt.
Es war auch richtig, dass die Bundeskanzlerin die erste französische Initiative eines gemeinsamen europäischen Rettungsschirms abgelehnt hat und gemeinsam mit dem Finanzminister eine europäisch vernetzte, aber dennoch den nationalen Gegebenheiten geschuldete Initiative vorgelegt hat.
Es ist ein Erfolg, dass die Bundeskanzlerin und der Finanzminister eine Einigung mit den Bundesländern gefunden und angemessen für die Haftung der Bundesländer Sorge getragen haben. Auch das ist ein Erfolg. Dies ist nicht einfach gewesen, wie ich aus den Gesprächen weiß. Denn die Bewältigung dieser Krise ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, bei der alle Schultern mittragen müssen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Bundesregierung mit dem vorliegenden Gesetz alles in ihrer Macht Stehende getan hat, um der akuten Krise Herr zu werden. Aber es gibt, so hoffen wir alle, sehr bald eine Zeit nach der Krise. Wir müssen Vorkehrungen treffen, dass sich Gleiches nicht wiederholen kann. Das erwarten die Menschen von uns.
Sie vertrauen darauf, dass wir das System ändern. Sie erwarten, dass wir für die Zukunft so vorsorgen, dass sich eine Krise dieses Ausmaßes nie mehr wiederholen kann.
Frau Bundeskanzlerin, Sie haben in dieser Woche immer wieder davon gesprochen, dass wir nach der akuten Krisenbewältigung eine neue Ordnung für die Marktwirtschaft brauchen. Das ist absolut richtig. Helmut Schmidt hat gemahnt, dass es bei einem so komplizierten Gebilde wie der globalisierten Finanzwirtschaft Verkehrsregeln geben müsse wie in der internationalen Luftfahrt. Es kann eben nicht jeder von seinem nationalen Tower funken, wie es ihm gefällt, sondern internationale Standards müssen eingehalten werden. Das ist genauso wichtig.
Ich denke aber, das reicht nicht. Mir hat der Münchener Erzbischof Reinhard Marx aus dem Herzen gesprochen, als er eingeklagt hat, dass neue Regeln allein nicht genügen. In einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur hat er am Dienstag gesagt: Neue Strukturen ?ersetzen nicht die moralische Erneuerung bei den Spitzenmanagern oder letztlich auch bei den Anlegern.?
Denn, so der Bischof weiter, ?Renditeerwartungen von 20, 25 Prozent jährlich sind unsittlich.?
Er hat recht. Das Problem ist nur, dass manche Leute offenbar gar nicht mehr wissen, was unsittlich ist. Der ehemalige Chef der Deutschen Bank, Hilmar Kopper, hat sich dieser Tage in einem Interview beschwert, er könne das Wort Gier nicht mehr hören; will sagen, dass er es als Zumutung empfindet, wenn Managern der Bank- und Finanzwirtschaft Gier vorgeworfen wird. Nein, es ist genau andersherum: Diese Arroganz Koppers ist eine Zumutung für alle Sparer, die wegen der Zockerei einiger Banker um ihre Einlagen zittern müssen.
Das ist eine Zumutung für alle Steuerzahler, die mit der Bürgschaft des Staates für die Zockerei der Koppers und Ackermanns einstehen müssen.
Dass Herr Ackermann heute mitteilen lässt, er würde seinen Bonus seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen, halte ich für den Versuch, einen Ablass für die Sünden zu erhalten. Das ist ein peinlicher Vorgang. Er hätte lieber erklären sollen, dass er das Geld dem Steuerzahler und dem Finanzminister zurückgibt, wenn er schon eine solche Maßnahme vorschlägt. Das ist eine reine Showveranstaltung.
Wenn schon BDI-Präsident Thumann die Gier dieser Kaste - ich nutze das Wort noch einmal - kritisiert, wie fassungslos müssen dann Normalverdiener vor den Summen stehen, derer sich die Finanzmanager bedient haben? Diese Herren haben getan, als spielten sie ein gewaltiges Monopoly, bei dem sie sich um die Verluste nicht zu kümmern brauchen. Die Scherben, die aus ihrem Größenwahn erwachsen sind, haben sie uns und den Bürgerinnen und Bürgern weltweit vor die Tür gekehrt. Sie müssen jetzt endlich vom hohen Ross steigen und sich konstruktiv, vor allem aber solidarisch an der Lösung dieser Probleme beteiligen.
In der Fraktion wurde mir gestern von Kolleginnen und Kollegen aus dem Haushalts- und aus dem Finanzausschuss mitgeteilt, wie manche Banker in der Sitzung aufgetreten sind. Daher habe ich große Zweifel, dass diese Mahnung angekommen ist. Wir werden sie deshalb öfter wiederholen müssen. Wir lassen es uns nämlich nicht gefallen, dass diese Herren so arrogant auftreten.
Bischof Marx hat recht: Wir brauchen nicht nur neue Regeln, sondern wir brauchen eine moralische Erneuerung.
Für einige dieser Herren kommt erst das Fressen und dann die Moral, wie es in Brechts Dreigroschenoper heißt. Wir brauchen aber sogenannte Eliten, bei denen die Reihenfolge wieder umgekehrt ist: Erst die Moral und dann das Fressen.
- Ich weiß gar nicht, wieso Sie sich darüber aufregen.
- Ihren Zwischenruf nehme ich sowieso nicht auf.
Der amerikanische Nobelpreisträger Paul Krugman hat gewarnt, dass eine Gesellschaft nicht funktionieren kann - man höre -, in der der bestbezahlte Hedgefonds-Manager der Wall Street in einem Jahr so viel verdient wie alle Lehrer New Yorks zusammen in drei Jahren. Er hat völlig recht. Das ist ein Zustand, den eine Gesellschaft nicht ertragen kann. Das dürfen wir nicht einfach so hinnehmen.
Diese Aufspaltung der Gesellschaft, so Krugman, habe die weltweite Wertevernichtung vorangetrieben. Sie lässt die Menschen daran zweifeln, dass ihnen aus eigener Kraft durch Bildung und Gerechtigkeit der Aufstieg gelingen kann. Die Menschen müssen wieder die Gewissheit haben, dass sich Leistung für alle lohnt und dass Eigentum verpflichtet.
Bei dieser Verpflichtung ist es für meine Fraktion - das will ich übrigens hinzufügen - völlig selbstverständlich, dass die Finanzbranche nicht ungeschoren davonkommen darf.
Deshalb haben wir beschlossen, dass Defizite, die nach Abwicklung des Fonds verbleiben sollten, nicht durch Steuergelder, sondern mithilfe geeigneter Maßnahmen durch die Finanzbranche selbst ausgeglichen werden müssen.
Es besteht kein Zweifel, die Krise der Finanzwirtschaft wird den Abwärtstrend der Wirtschaft weltweit verstärken und natürlich auch negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes haben. Wie intensiv sie sein werden, lässt sich im Augenblick seriös nicht prognostizieren. Wir sollten aber darauf vorbereitet sein, nach den Ergebnissen der Steuerschätzung bei den Beratungen des Haushalts für das nächste Jahr über weitere Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft nachzudenken. Ohnehin geplante Investitionen in Bildung könnten vorgezogen werden, nachhaltige Investitionen in die Infrastruktur ausgeweitet und Gebäudesanierungsprogramme intensiviert werden. Wir werden das in den Haushaltsberatungen ausdrücklich prüfen.
Wie gehen wir jetzt mit denen um, die uns das alles eingebrockt haben? Ich will noch einmal Bischof Marx zitierten:
In so einer Lage erwarte ich aber auch vom Staat ein Signal, das besagt: Wir stehen zusammen, wir sind eine Solidargemeinschaft. Ganz gerecht ist das natürlich nicht, denn die Verursacher können den Schaden gar nicht wiedergutmachen, den sie angerichtet haben. Wir brauchen dann das Vertrauen in ein Gemeinwesen, das solidarisch ist.
So der Bischof. - Zu dieser Solidarität müssen wir den einen oder anderen zwingen. Wenn Steuerzahler Bürgschaften für taumelnde Zockerbanken geben, kann es nicht sein, dass die Gehälter der Manager auf dem Niveau der Monopolyspiele bleiben. Die Bundeskanzlerin hat das in den vergangenen Tagen ähnlich gesehen, wenn ich sie richtig verstanden habe. Mit beredten Worten haben Kollegen aus der Union das ebenfalls gefordert. Ich erwarte, dass wir alle zu diesen Worten stehen, die wir beim Blick in den Abgrund der Finanzkrise mit moralischem Timbre verbreitet haben.
Wir alle hoffen, dass das heute zu verabschiedende Gesetz das Schlimmste für den Finanzmarkt verhindern kann. Wir wissen allerdings auch, dass wir damit nicht am Ende der Krise stehen, sondern möglicherweise erst mitten in ihr. Wenn wir die Krise überstanden haben, sollten wir so selbstbewusst wie Luxemburgs Premier Jean-Claude Juncker die Lösung des Problems auf die Fahnen der Politik schreiben. Denn es waren die Politiker, die Regierungen und Parlamente, und nicht die Banker, die die Krise entschärft haben. Die Arroganz der Banker wird nach dem, was wir hier als Parlament und als Regierung geleistet haben, ein für alle Mal zu Ende sein müssen.
Ich hoffe, dass wir national und international wirklich zu grundlegenden Veränderungen kommen, die dem Tanz um das Goldene Kalb in Zukunft enge Grenzen setzen werden. Dafür will ich mit meiner Arbeit in meiner Fraktion und meiner Partei sorgen.
Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner:
Das Wort hat der Fraktionsvorsitzende der FDP, Dr. Guido Westerwelle.
Dr. Guido Westerwelle (FDP):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir alle sind verpflichtet, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Das gilt für die Regierung und für das Parlament, und zwar gleichgültig, ob man in einer Regierungsfraktion oder einer Oppositionsfraktion sitzt. Deswegen will ich hier ausdrücklich sagen: Die Lage ist da und muss bewältigt werden. Deswegen werden wir als Freie Demokraten den Gesetzentwurf der Koalition unterstützen und ihm zustimmen.
Wir hören natürlich - das wird jedem hier so ergehen - eine Menge fachliche Betrachtungen und auch manches, was wir anders sehen. Darauf will ich gleich noch kurz eingehen. Aber eines will ich vorab klarmachen: Dieses Paket schützt nicht Banken und auch nicht irgendeinen Aktienkurs, sondern die Bürgerinnen und Bürger. Es schützt die Rentnerinnen und Rentner. Es schützt die Mittelständler. Es schützt die Arbeitnehmer. Es ist ein Paket, das Deutschland dient, nicht einigen wenigen.
Natürlich wird es bei einem solchen Kompromiss, der bis in den frühen Morgen hinein verhandelt wurde - ich darf mich in diesem Zusammenhang bei dem Haushaltsausschuss herzlich bedanken -, immer so sein, dass viele der darin enthaltenen Maßnahmen unterschiedlich bewertet werden. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn eine Fraktion alleine dieses Paket geschnürt hätte, dann würde es vermutlich anders aussehen. Das will ich ausdrücklich auch für uns sagen.
Dass wir mehr und vor allen Dingen auch intensiver über das britische Modell nachgedacht haben, will ich hier nicht verschweigen. Ich will auch nicht verschweigen, dass bis hin zum Insolvenzrecht manche Regelungen getroffen worden sind, die wir ausdrücklich nicht teilen und billigen. Deswegen betrachten Sie bitte - Sie verstehen, dass ich das hier zu Protokoll gebe - unsere Zustimmung zu dem Paket nicht als Freifahrtschein für alles, was in dem Paket enthalten ist. Das ist auch nicht anders zu erwarten.
Natürlich teilen wir nicht jede Maßnahme dieses Pakets. Aber wir müssen uns umgekehrt einmal Gedanken darüber machen, was es für unser Land, für die Wirtschaft unseres Landes und die Stabilität des Geldes unseres Landes bedeuten würde, wenn dieses Paket heute keine Mehrheit bekäme. Auch darüber muss man sich einmal Gedanken machen.
Ich sage das, weil auch wir um Lösungen gerungen haben, wie es sich in einem parlamentarischen Verfahren gehört. Dass man dem Paket nicht zustimmt, weil man die Verantwortung nicht übernehmen möchte und gleichzeitig sicher sein kann, dass es ohnehin eine Mehrheit erhält, ist nicht die richtige Art und Weise, mit der Parlamentarier hier herangehen sollten.
Wir haben im Laufe der Beratungen einiges verbessern können. Es ist für mich keine Pflichtübung, sondern es ist mir eine Herzensangelegenheit, mich insbesondere bei den beiden Fraktionsvorsitzenden, Herrn Kauder und Herrn Struck, für die Beratungen zu bedanken, die wir insbesondere in diesen letzten beiden Tagen geführt haben. Es ist uns besonders wichtig, dass die Stellung der Bundesbank in dem Gesetzentwurf, den wir heute beschließen werden, anders geregelt ist als in der Vorlage, die eingebracht worden ist. Die Unabhängigkeit der Bundesbank ist ein hohes Gut. Es ist richtig, dass das in diesem Paket aufgenommen wurde und zum Ausdruck gekommen ist.
Es ist vor allen Dingen für jeden Parlamentarier von herausragender Bedeutung, dass wir mit der Beschlussfassung an diesem Tag nicht unsere Parlamentsrechte abgeben.
Das sagen wir nicht aus Eitelkeit, sondern das sagen wir im Interesse unserer Verfassung und der Bürgerinnen und Bürger, weil wir diejenigen sind, die den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber für die Verwendung der Steuergelder geradestehen müssen. Deswegen will ich an dieser Stelle noch einmal sagen, dass der in dem Gesetzentwurf neu aufgenommene § 10 a ausdrücklich die Bildung eines Ausschusses in diesem Hause vorsieht, der die parlamentarische Kontrolle und Begleitung dessen zur Aufgabe hat, was jetzt die Regierung umzusetzen hat. Das ist ein wichtiger Beitrag für das Parlament und für die Gewaltenteilung.
Als Verfassungspatrioten sagen wir dazu: Es ist notwendig, dass an dieser Stelle das Parlament in weiten Teilen mitwirken kann. Die Kritik, die von manchen geäußert wird, dass diese Mitwirkung im Geheimen passiert, kann ich nicht nachvollziehen. Das Gremium wäre völlig arbeitsunfähig, wenn es öffentlich tagen müsste. Da werden Firmen- und Eigentumsinteressen sowie Arbeitnehmerinteressen behandelt. Bei einem öffentlich tagenden Gremium würde ein Unternehmen, das um Hilfe bittet, in den Ruin getrieben. Die Parlamentsbeteiligung ist ein großer Erfolg, den wir in diesen letzten beiden Tagen gemeinsam durchsetzen konnten.
Ich will noch eine Bemerkung an die Adresse der Bundesregierung machen. Grundlage für unsere Entscheidung ist, dass die Bundesregierung mit offenen Karten spielt. Sie erwarten von uns Vertrauen. Wir müssen aber auch Ihnen vertrauen können.
Deswegen sage ich mit großem Ernst und aus gegebenem Anlass: Die Informationen, die Sie uns in diesem Haus, in geheimen Unterrichtungen und in den Beratungen der Ausschüsse, haben zukommen lassen, müssen stimmen. Sie stehen dafür gerade, dass Sie keine wesentlichen Informationen verschwiegen haben. Geschäftsgrundlage ist, dass die Bundesregierung mit offenen Karten spielt.
Ich will zwei Schlussbemerkungen machen. Ich glaube, dass wir uns als Deutscher Bundestag mit einem gewissen Abstand zu dieser schwierigen Woche trotz einer zweifelsohne belastenden und aufgeregten Situation die Zeit nehmen sollten, grundsätzlicher über die Folgen zu reden. Das ist am heutigen Tage weder leistbar noch notwendig. Wir müssen aber einmal Bilanz ziehen, auch was die Art und Weise angeht, wie wir als Staatsorgane mit dieser Krise umgegangen sind.
Eines wird man, wie ich glaube, festhalten können: Viele, die häufig negativ über Europa reden, haben in dieser Zeit hoffentlich verstanden, was für ein Glück es ist, dass wir in einem vereinigten Europa leben dürfen.
Europa hat sich in dieser Situation bewährt. Das ist weit mehr als eine Randbetrachtung. Das ist ein wichtiger politischer Vorgang.
Meine sehe geehrten Damen und Herren, zum Schluss: Unsere Demokratie, unser Rechtsstaat und unsere soziale Marktwirtschaft werden sich auch in dieser Krise als eine überlegene Ordnung bewähren. Um das zum Ausdruck zu bringen, stehen wir zu der Verantwortung, die wir alle gemeinsam tragen. Die FDP-Fraktion wird das Maßnahmenpaket im Interesse unseres Landes und der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes unterstützen.
Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner:
Ich gebe das Wort dem Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU, Volker Kauder.
Volker Kauder (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir schnüren heute das größte Finanzmarktrettungspaket in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Diese Woche war ein Kraftakt. Begonnen hat sie mit Diskussionen darüber, was konkret getan werden muss, um am Markt neues Vertrauen zu schaffen. Über das Wochenende wurden Verhandlungen auf europäischer Ebene geführt, und in den Ministerien wurde das Maßnahmenpaket vorbereitet. Dann folgten die parlamentarischen Beratungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe dies nie als eine Zumutung empfunden, sondern als eine Pflichtaufgabe für uns alle, für den Deutschen Bundestag und für die Bundesregierung. Ich bin dankbar, dass uns dies gelungen ist.
Diese Woche hat gezeigt, dass unsere soziale Marktwirtschaft, unsere Einrichtungen und unsere Organe - Regierung, Bundestag und Bundesrat - auch in einer schwierigen Situation handlungsfähig sind. Manche aus der Wirtschaft und der Bankenbranche haben oft lächelnd auf uns herabgeschaut nach dem Motto: ?Wir bestimmen, was passiert. Wir erklären die Welt. Die Politik hat uns nur noch zu folgen.? Mancher Bürger hat auf die Politik herabgeschaut nach dem Motto: ?Die können es nicht mehr.? In dieser Woche haben wir allerdings zeigen können, dass dem nicht so ist. In dieser Woche kam es auf uns an, und wir sind unserer Verantwortung gerecht geworden.
Das sage ich nicht aus Selbstgerechtigkeit,
sondern dies sage ich nur, damit klar wird: Man kann sich auf unsere Demokratie verlassen. Auf jeden Fall kann man festhalten: Auf unsere Demokratie und auf unsere Institutionen war und ist mehr Verlass als auf manch andere, die wir jetzt erst wieder zur Verlässlichkeit bringen müssen.
Wir sind all denjenigen dankbar, die die Last in diesen Tagen in besonderer Weise getragen haben: Bundesregierung, Ministerien, Haushaltsausschuss. Wir sollten in diesen Stunden allerdings auch nicht diejenigen vergessen, denen wir dafür dankbar sein müssen, dass wir unsere Arbeit in geordneter Ruhe machen konnten, nämlich den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes. Wir sollten ihnen dankbar sein, dass sie nicht in Hektik ausgebrochen und auch nicht in Hysterie verfallen sind. Sie haben vielmehr darauf vertraut, dass das Richtige getan werde. Deswegen sage ich unseren Bürgerinnen und Bürgern einen herzlichen Dank für ihre besonnene Haltung in den letzten Tagen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Rettungspaket, das wir auf den Weg bringen, ist noch nicht alles erledigt. Wir erwarten jetzt noch Rechtsverordnungen, die die Umsetzung dieses Paketes in der Praxis begleiten und ermöglichen. In diesem Zusammenhang erwarten wir von der Bundesregierung natürlich, dass das, was uns zugesagt wurde, in Gänze eingehalten wird. Der Satz ?Keine Leistung ohne Gegenleistung? muss sich in diesen Rechtsverordnungen konkret wiederfinden.
Uns als Parlamentariern - ich glaube, ich kann dies für alle in diesem Hause sagen - sollte besonders wichtig sein, dass klar und deutlich wird, dass diejenigen, die Handlungsverantwortung für das tragen, was jetzt eingetreten ist, nicht einfach so davonkommen können, als ob nichts geschehen wäre.
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss es überall dort, wo beispielsweise Kapital zur besseren Eigenkapitalausstattung von Banken gegeben werden muss, Konsequenzen für die Geschäftspolitik und das Entlohnungssystem haben. Herr Bundesfinanzminister, Sie haben dazu Zahlen genannt. Wir erwarten in den Rechtsverordnungen klare Konsequenzen.
Es geht auch nicht darum, dass aus Neid oder aus irgendwelchen anderen Gründen Gehälter begrenzt werden sollen. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht darum, mit diesen Maßnahmen, die aus den Rechtsverordnungen resultieren und die auch in die Gehaltsstrukturen eingreifen, wieder etwas herzustellen, was manchen in diesen Banken- und Finanzstrukturen verloren gegangen ist: Sie müssen wieder mitten in die Gesellschaft zurückgeholt werden, und sie dürfen nicht außerhalb aller Regeln herumturnen.
Mitten in die Gesellschaft zurückzukehren, heißt auch, eine gesunde Relation zwischen dem eigenen Handeln und Einkommen und damit zu dem, was in unserer Gesellschaft normalerweise verdient werden kann, herzustellen.
Wir erwarten, dass durch dieses Paket, das wir schnüren, neues Vertrauen am Markt entsteht. Wir erwarten allerdings von denjenigen, die jetzt in unserem Banken- und Finanzmarktsystem handeln müssen, dass sie diesem Vertrauen gerecht werden, dass sie sich an die Arbeit machen, Kredite vergeben und den Finanzmarkt wieder in Bewegung bringen. Wir leisten unseren Beitrag jetzt, und wir erwarten im Gegenzug von Finanzmarkt und Banken, dass sie dem Vertrauen, das wir ihnen entgegenbringen, gerecht werden und dass sie ihren Teil dazu beitragen, dass wir aus der Krise herauskommen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Frage, was geschehen muss, damit so etwas nicht noch einmal auf uns zukommt. Wir haben natürlich erkannt, dass es auf die Handlungsfähigkeit des Nationalstaates ankommt. Diese Handlungsfähigkeit kann aber nur dadurch hergestellt werden, dass wir in Europa eingebunden sind und dass nicht jeder macht, was er gerade für richtig hält.
Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Regeln, die sich bewährt haben - durch die weltweite Krise zeigt sich, dass sich unsere Regeln der sozialen Marktwirtschaft bewährt haben und bewähren -, weltweit umgesetzt werden. Wir müssen aber auch erkennen: Dass wir jetzt, wie ich finde, stark handeln können, hängt auch damit zusammen, dass wir uns in den letzten drei Jahren stark gemacht haben. Wir haben es zwar schon immer gewusst, aber jetzt, in dieser Krise, erkennen wir,
- ja, ja, Frau Künast - dass das, was wir in den letzten drei Jahren nach rot-grüner Bundesregierung hier in dieser Großen Koalition gemacht haben, nicht umsonst war.
- Keine Aufregung.
Dies können Sie im Herbstgutachten der führenden Wirtschaftsinstitute nachlesen. In diesem Herbstgutachten steht nämlich, dass die Bundesrepublik Deutschland aufgrund dessen, was wir gemacht haben, in dieser Krise stärker ist, als sie noch vor drei Jahren war. Deshalb ist die Botschaft für uns klar: Das, was uns stark gemacht hat, darf jetzt in der Krise nicht aufs Spiel gesetzt werden.
Deswegen sind Haushaltssanierung und klare Verhältnisse, wie wir jetzt erkennen, kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung für Handeln und Stärke auch in schwierigen Situationen.
Deshalb werden wir unser Ziel der Stabilität des Haushalts und der Politik auch in der Krise nicht aufgeben.
Was muss noch geschehen? - Ich glaube, dass wir die klare Botschaft brauchen, dass die Bankenaufsicht konzentriert werden muss.
Ich sage noch einmal, dass wir es für richtig halten, dass die Bankenaufsicht bei der Bundesbank konzentriert wird.
Ohne eine nationale Bankenaufsicht wird es nicht gehen, aber wir brauchen auch eine europäische Komponente der Aufsicht. Das, was wir uns für die nationale Ebene vorstellen, stelle ich mir auch für die europäische Ebene vor:
Konzentration einer europäischen Bankenaufsicht bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. - Das Vorbild, das wir für uns haben, muss auch dort gelten.
Eines lernen wir aus dieser Krise aber auch: Nichts ist wichtiger als Vertrauen. Deswegen sagen wir all denjenigen, die auf dem Finanzmarkt, in der Finanzwirtschaft und im Bankenwesen tätig sind: Schaut wieder mehr auf den Wert des Vertrauens. Vertrauen heißt für euch in der Bankenwelt, dass ihr nicht unbedingt das Vertrauen jedes großen Profiteurs gewinnen müsst, sondern schaut wieder auf eure kleinen Kundinnen und Kunden und habt mehr Respekt vor den Einlagen der kleinen Kundinnen und Kunden, die euer Vertrauen verdient haben und die Stütze unserer Gesellschaft und unserer Demokratie sind.
Ich sage aber auch: Wir als Politiker sollten in dieser Situation auch erkennen, wie wichtig für uns Vertrauen ist und was Vertrauen heißt. Vertrauen heißt, dass Reden und Handeln möglichst nahe beieinander liegen sollten. Hundertprozentig wird das nie gelingen, aber das sollte wirklich nahe beieinander liegen. So, wie ich zur Bankenwelt sage, dass Profit um jeden Preis nicht sein darf, sage ich mit Blick auf die Vertrauenserhaltung auch zur Politik, dass Machtperspektive nicht um jeden Preis sein darf.
Ich glaube, dass wir in diesen Wochen ein großes Stück Vertrauen geschaffen haben. Ich erwarte, dass sich dafür etwas am Markt bewegt. Ich weiß sehr genau, dass wir jetzt an der Börse die sorgenvolle Beobachtung und Vorwegnahme eines wirtschaftlichen Abschwungs erleben. Wir sehen am Ölpreis und anderen Indikatoren, dass die Lage schwieriger wird. Deshalb sollten wir den Menschen nicht vormachen, dass diese Krise in den nächsten Wochen und Monaten einfach so an uns vorbeigeht.
Aber wir sollten auch darauf hinweisen, dass wir stärker sind, als wir es noch vor Jahren waren. Wir haben gezeigt, dass dieser Staat und diese Demokratie handlungsfähig sind und wir nicht, wie in früheren Krisen, nur zuschauen können. Deswegen bin ich gerade nach dieser Woche bei allem, was wir zu erwarten haben, optimistisch. Die Demokratie hat sich als handlungsfähig erwiesen. Das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass es in den nächsten Jahren gut weitergeht.
Ich danke allen, die an dem Erfolg in dieser Woche mitgewirkt haben. Es bedeutet nicht, wie in manchen Kommentaren geschrieben wird, die Rückkehr des Politischen, sondern es ist die Bestätigung, dass Politik in diesem Land etwas erreichen kann.
Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner:
Das Wort hat der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dr. Gregor Gysi.
Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich denke, wir erleben zurzeit die tiefste Krise des Kapitalismus seit 80 Jahren.
Diese Krise geht aber nicht von der Dritten Welt oder von den Schwellenländern aus, sondern ausschließlich von den führenden kapitalistischen Staaten. Gestern Abend wurde in den Tagesthemen über ein Thema berichtet, mit dem wir uns hier noch nicht beschäftigt haben und über das wir diskutieren müssen.
Derzeit sterben jährlich 9 Millionen Menschen an Hunger. Jetzt wurde gemeldet, dass die 50 ärmsten Staaten wegen der Finanzkrise keine Kredite mehr bekommen. Sie können dann keine Nahrungsmittel mehr kaufen. Es wurde geschätzt, dass zusätzlich zu den 9 Millionen Menschen noch weitere 50 Millionen Menschen an Hunger sterben werden. Das kann niemand in diesem Hause wollen. Deshalb erwarte ich von Ihnen, Frau Merkel, und auch von Frau Wieczorek-Zeul konkrete Vorschläge, wie wir das auf deutscher, europäischer und internationaler Ebene verhindern können.
Verantwortlich für diese Krise sind nicht nur Bankmanager - die stehen allerdings ganz oben an -, sondern auch Politikerinnen und Politiker, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Journalistinnen und Journalisten, die uns jahrelang gepredigt haben, dass die Freiheit der Finanzmärkte zu einer gigantischen Wirtschaft führt. Aber das Gegenteil ist passiert.
Wir haben es nicht nur mit einer Krise auf den Finanzmärkten zu tun, sondern auch in den Bereichen Wirtschaft, Politik und Demokratie, was zum Teil noch geleugnet wird. Oskar Lafontaine hat am Mittwoch darauf hingewiesen, dass der von Ihnen zunächst berufene und dann wieder zurückgetretene Tietmeyer erklärt hatte, dass die Finanzmärkte die Politik beherrschen. Heute sagen Sie, dass Sie zu diesem Gesetz gezwungen sind. Damit räumen Sie ein, immer noch beherrscht zu werden.
Die Kernfrage lautet deshalb, zu welchen Veränderungen wir kommen müssen, um so etwas zukünftig auszuschließen.
Der demokratische Sozialismus steht leider - ich bin Realist - noch nicht auf der Tagesordnung.
- Dass Sie nicht begreifen, was das ist, verstehe ich. Aber zumindest vom Kapitalismus müssten Sie etwas verstehen. Dann müsste man sich wenigstens darin einig sein, dass man ihn verändern muss. Können wir nicht zusammen darum ringen, ein Primat der Politik über Wirtschaft und Finanzen wiederherzustellen?
Das ist auch eine Kernfrage der Demokratie;
denn wenn der Vorstand der Deutschen Bank entscheidet, was der Bundestag und die Bundesregierung zu tun haben, und nicht wir entscheiden, was sie zu tun haben,
dann ist die Demokratie schwer verletzt. Schließlich darf die Bevölkerung den Bundestag wählen, aber nicht den Vorstand der Deutschen Bank.
Wie es sich mit der Wirtschaft verhält, werde ich Ihnen sagen. Ein Konzernchef hat mir gesagt, dass früher der zehnte Tagesordnungspunkt in der Vorstandssitzung immer der Börsenstand war. Aber seit Jahren sei nun der erste Tagesordnungspunkt der Börsenstand, weil dieser alleine darüber entscheide, welche Kredite zu welchen Bedingungen man bekomme. Das heißt, die Finanzwelt beherrscht sogar die Wirtschaft. Es wäre selbst im Kapitalismus sehr viel sinnvoller, wenn die Wirtschaft die Finanzwelt beherrschte. Auch dort brauchen wir eine Umkehrung.
Die Frage, die sich nun stellt, ist: Gab es unterschiedliche politische Ansätze zur Vermeidung einer solchen Krise, oder gab es sie nicht? Ich finde Besserwisserei immer blöde.
- Entschuldigen Sie, das ist Ihr Stil. Sie behaupten, seit 1949 alles richtig gemacht zu haben. Aber das ist ein schwerer Irrtum der Union; das kann ich Ihnen versichern.
In dieser Frage hatten wir aber nun einmal recht. Wir haben immer gesagt, dass wir eine Regulierung der internationalen Finanzmärkte brauchen, weil alles andere zu einer Katastrophe führt. Aber Sie haben das immer bestritten. Das ist die Wahrheit.
- Ich werde es Ihnen gleich beweisen. - Sie verlangen von uns immer Ehrlichkeit in der Aufarbeitung der Geschichte. Haben Sie doch einmal die kleine Ehrlichkeit, hier zu sagen: Wir haben uns zutiefst geirrt, und die Linken hatten - meinetwegen: ausnahmsweise - recht.
Jetzt erklären Union und SPD sowie Grüne, dass sie schon immer für die Regulierung der Finanzmärkte waren. Das ist eine Erfindung.
Denn Joschka Fischer von den Grünen hat erklärt, man könne nicht gegen die Finanzmärkte regieren. Gerhard Schröder ist Tony Blair gefolgt - und zwar gegen Oskar Lafontaine - und hat gesagt: Wir müssen die Freiheit der Finanzmärkte schaffen. Herr Steinbrück, ich darf Sie ausnahmsweise zitieren. Sie haben am 4. Mai 2006 auf der Euromoney Germany Conference Folgendes wörtlich erklärt:
Obwohl wir mit unseren Reformanstrengungen noch keineswegs am Ende sind, zeigen sie doch erste gute Ergebnisse ? Nicht zuletzt ist Deutschland heute eine der am meisten liberalisierten und deregulierten Wirtschaften in Europa.
Darauf waren Sie stolz. Das Ergebnis sehen wir jetzt.
- Entschuldigung, die SPD hat Hedgefonds zugelassen, die Sie dann als Heuschrecken bezeichnet haben. Die SPD und die Grünen haben Leerverkäufe zugelassen.
Darf ich den Bürgerinnen und Bürgern erklären, was Leerverkäufe sind? - Man gibt Geld an die Börse und wettet darauf, dass bestimmte Aktienkurse fallen. Wenn man recht hatte, gewinnt man Geld. Wenn man unrecht hatte, ist man sein Geld los. Sie haben mit dieser Maßnahme aus dem Kapitalismus einen Kasinokapitalismus gemacht.
2008 haben Sie das endlich verboten, allerdings nur befristet.
Den Gesetzentwurf lehnen wir ab. Herr Westerwelle, Sie sagen, das könnten wir uns nur leisten, weil es auf unsere Stimmen nicht ankomme. Ich sage Ihnen Folgendes: Wenn es auf unsere Stimmen ankäme, könnten wir entsprechende Veränderungen durchsetzen; das ist der Unterschied. Diese können wir nun aber nicht durchsetzen.
Dass ein Rettungspaket erforderlich ist, ist unstrittig. Dass das zügig geschehen musste, ist auch unstrittig. Dafür hatten Sie unsere Zustimmung. Wir kritisieren aber Folgendes:
Erstens. Sie sagen, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wenn staatliches Geld fließt. Man kann dann Bonusscheine oder Aktien erwerben, aber ohne Mitbestimmungsrechte. Man kann aber auch solche Aktien erwerben, dass man anschließend etwas zu sagen hat. Das alles regeln Sie in Verordnungen. Auf diese haben wir aber keinen Einfluss, selbst wenn ein Ausschuss davon erfährt. Der Bundestag hat dann nichts mehr zu entscheiden. Darauf können wir uns nicht einlassen.
Wir sagen: Wohin staatliches Geld fließt, muss auch staatliches Eigentum entstehen; denn die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind dann auch am Gewinn zu beteiligen.
Zweitens. Wenn man so etwas macht und das der Regierung überlässt, dann muss man - das wurde hier vielfach erklärt - Grundvertrauen in die Regierung haben. Das haben wir nicht, weil sie es zerstört hat. Das möchte ich Ihnen gerne begründen.
- Das kann schon sein. Wir hatten aber auch noch nie einen Grund, so etwas zu entwickeln.
Herr Bundesfinanzminister, am 16. September 2008 haben Sie im Bundestag wörtlich erklärt:
Es gibt keinen Anlass - das sage ich sehr bewusst -, an der Stabilität des deutschen Finanzsystems zu zweifeln.
Oh, es hätte viele Anlässe gegeben, zu zweifeln.
Entweder haben Sie es nicht gewusst - dann spricht das gegen Ihre Fähigkeiten -, oder Sie haben es gewusst; dann haben Sie uns nicht die Wahrheit gesagt. Auch das spricht dann gegen Sie.
Drittens. Dann begann die Krise in den USA. Frau Bundeskanzlerin, Herr Glos, was haben Sie denn gesagt? Sie, Herr Glos, haben gesagt, die USA sollten vor der eigenen Tür kehren, das Ganze gehe Deutschland nichts an. Sie hatten gar nicht verstanden, dass wir ein international verwobenes Finanzsystem haben, in dem uns auch eine Bank in Island etwas angeht.
Es ist doch grotesk - wir leben in einer verrückten Welt -, dass die Linke dieser Bundesregierung sagen musste: Sie müssen mit der US-Administration unter Bush zusammenarbeiten. - Aber das ist die Wahrheit. Wir haben das gesagt.
Dann wollte Anfang des Monats der französische Präsident Sarkozy eine europäische Lösung. Auch das haben Sie schon vergessen.
Es war Frau Merkel, die dagegen war und immer noch den nationalistischen Weg beschreiten wollte, der aber falsch ist und der auch gar nicht funktioniert.
Ich weiß, dass Sie das jetzt alles begriffen haben. Jetzt machen Sie das international, weltweit, europäisch. Das ist auch sinnvoll, aber Sie müssen doch zugeben, dass Sie erst einmal das Gegenteil betrieben haben. Das hat kein Vertrauen geschaffen, ganz im Gegenteil.
Nehmen wir ein weiteres Beispiel, die Deutsche Industriebank. Ich bitte Sie, Herr Steinbrück! Was haben Sie denn dort geregelt? Erstens sagt ein Mann wie Roland Berger, die Rettung sei gar nicht erforderlich gewesen, weil das Institut viel zu klein gewesen sei. Also kann man schon über die Rettung streiten. Das Zweite, was ich spannend finde, ist: Sie stellen 9,2 Milliarden Euro für Schäden zur Verfügung, die eintreten können. Das sind aber nicht Ihre Gelder, das sind Gelder der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Dann verkaufen Sie das Institut - uns gehörten 38 Prozent der Anteile - an eine Heuschrecke für einen Appel und ein Ei. Jetzt gehört uns gar nichts mehr. Nun kommt der Höhepunkt: Sie haben nicht geregelt, dass diese Bank dann, wenn sie jemals wieder Gewinne macht - und wenn tatsächlich 1 Milliarde, 5 Milliarden oder 9 Milliarden Euro unseres Geldes in Anspruch genommen wurden -, auch nur 1 Cent an uns zurückzahlt. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, Herr Steinbrück. Für mich hat das eine strafrechtliche Relevanz. Was soll denn sonst Untreue sein?
Ich finde, das ist wirklich nicht hinnehmbar, und ich kann das den Bürgern auch nicht erklären.
Jetzt komme ich zur Hypo Real Estate. Ich bitte Sie. Sie haben uns immer erklärt: Die konnte nicht kontrolliert werden, weil die Bundesfinanzaufsicht dafür nicht zuständig war, weil das Institut keine Bank war. Dann ist der Schaden durch die DEPFA angerichtet worden, eine Tochter mit Sitz in Irland. Dazu haben Sie uns erklärt: Auch die konnte nicht kontrolliert werden, weil ihr Sitz in Irland war. - Jetzt sagt uns doch der Chef der Bundesfinanzaufsicht, er habe sie mit der Bundesbank kontrolliert. Der Bericht ist im August an das Bundesfinanzministerium gegangen. Haben Sie davon nichts gewusst, oder haben Sie uns belogen? Das möchte ich jetzt einfach einmal wissen.
Die Finanzaufsicht behauptet auch, in dem Bericht hätten alle Risiken gestanden. Wie, frage ich Sie, soll denn das Vertrauen entstanden sein, das dazu hätte führen können, dass wir jetzt alles der Regierung überlassen? Sie haben das Vertrauen zerstört, das man vielleicht gehabt haben könnte, das wir aber - der Zwischenruf kam zu Recht - nicht hatten.
Über die Verantwortlichkeit der Manager reden wir zwar alle, aber es passiert doch nichts. Herr Funke tritt als Chef der HRE zurück und erhält monatlich über 40 000 Euro Pension. Davon kann man ja einigermaßen leben. Das ist ja eine dolle Strafe, die er hinnimmt. Es ist doch nicht mehr diskutabel, was wir hier in Deutschland erleben.
Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner:
Herr Kollege Gysi, ich möchte Sie an Ihre Zeit erinnern.
Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE):
Frau Präsidentin, da ich Ihnen vertraue, gehe ich davon aus, dass die Zeit leider herum ist.
Das ist schade. - Ich weiß, dass Sie sich freuen. Aber ich hätte Ihnen noch einiges zur Demokratie und auch zur sozialen Frage gesagt.
Überlegen Sie sich das ganz genau, bevor Sie arrogant darüber hinweggehen.
Wenn Sie kein Konjunkturprogramm auflegen, -
Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner:
Herr Kollege Gysi.
Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE):
- wenn Sie die Sozialleistungen nicht stärken, dann werden wir einen Wirtschaftsabschwung erleben, den wir so teuer zu bezahlen haben werden, dass ich es Ihnen und uns allen nicht wünsche. Machen Sie diesbezüglich eine andere Politik!
Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner:
Das Wort hat die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Renate Künast.
Renate Künast (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es passiert mir in dieser Legislaturperiode ehrlich gesagt zum ersten Mal, dass ich als Fünfte ans Redepult gehe und vor meiner vier linke Reden gehalten wurden.
Ich muss wirklich sagen: Bei Ihnen allen stimmen Reden und Handeln nicht überein.
Ich muss mich selbst über die Rede des geschätzten Herrn Kollegen Westerwelle wundern, der hier sagt, Leute würden vielleicht ablehnen, weil man ?sicher sein kann, dass es ohnehin eine Mehrheit erhält?.
Herr Westerwelle, von Ihnen habe ich gar nichts anderes erwartet, weil - das sage ich klar - Sie und Ihre FDP sich nicht ums Land, sondern um die Banker Sorgen machen. So war auch Ihre Rede.
Ich muss einen Satz zitieren:
Ferner muß der politische Einfluss im Bankensektor reduziert werden. Das vergrößert die Chancen des Bankenstandortes Deutschland.
Das stand im Bundestagswahlprogramm der FDP von 2005.
Sie kritisieren hier andere, weil sie nicht zustimmen wollen. Wissen Sie, Herr Westerwelle, Sie verkaufen die parlamentarischen Rechte und die Sorge um das Geld der Bevölkerung in Deutschland für ein Linsengericht.
In dieser Woche geht es um ein Rettungspaket. Wir haben einem Verzicht auf die Fristen zugestimmt. Wir sagen: Ja, es muss ein schnelles Paket sein, es muss ein großes Paket sein. Aber dieses Paket, das die Koalition vorgelegt hat, ist definitiv das falsche, weil es seiner Verantwortung vor den Steuerzahlern nicht gerecht wird.
- Wir stehen hier und sagen: Wir tragen Verantwortung für unser Land; wir tragen - in dieser Gestalt funktioniert das - Verantwortung für den Haushalt. Wir tragen Verantwortung, wenn wir innerhalb von fünf Tagen die doppelte Finanzmenge eines Bundeshaushalts ausgeben.
Wir tragen Verantwortung dafür, dass es einen Entscheidungsspielraum - -
- Herr Kampeter, Sie rufen: ?Sie haben es nicht einmal begriffen!?
Herr Kampeter, Sie sind hier der Rosstäuscher!
Die Tatsache, dass hier teilweise nur Garantien gegeben werden, beweist nicht, dass diese Gelder eines Tages, wenn es schiefgehen sollte, nicht auch fließen müssen.
Die Tatsache, dass wir das Geld dieses Jahr noch nicht ausgeben, ist nicht der Beweis dafür, dass das Geld nicht fließen könnte.
Wir können auch nicht zulassen, dass nur gesagt wird: In Schweden ist es nachher ganz toll gelaufen. - Die Schweden haben sich aber auch Rechte geben lassen. Bei den Schweden ging es um relativ isolierte Probleme; hier geht es um eine Weltkrise. Wer sagt uns denn, dass wir kleine, stille Anteile in ein, zwei Jahren weltweit gewinnbringend verkaufen können, wenn alle verkaufen wollen? Wir sind doch nicht naiv und lassen uns von Ihnen hinters Licht führen!
Wir tragen auch für nachfolgende Generationen die Verantwortung, ihnen nicht noch stärker verschuldete Haushalte zu übergeben. Wir tragen die Verantwortung dafür, dass es nicht zu falschen Wiederholungen kommt. Da sage ich Ihnen: Ihre Vorlage ist an dieser Stelle nicht in Ordnung. Deshalb muss man mit Nein stimmen.
Frau Merkel und Herr Steinbrück haben gesagt - der eine oder andere hat es auch behauptet -, dieses Paket solle nicht den Banken, sondern den Menschen dienen. Da frage ich einmal: Warum wurde es dann unter der Federführung von Martin Blessing, Commerzbank, unter Teilhabe von Josef Ackermann, Deutsche Bank, Klaus-Peter Müller, Commerzbank, und Paul Achleitner, Allianz, erarbeitet?
Ich frage Sie: Wo waren denn die Vertreter der Menschen? Wo waren denn die Verbraucherschützer? Wo waren denn die Finanzwissenschaftler, die nicht die Akteure dieser Krise waren? Sie haben den Bock zum Gärtner gemacht und sich mit den Verursachern zusammengesetzt, um dieses Paket zu schreiben. Dieses Paket ist nicht in Ordnung, und deshalb muss man mit Nein stimmen.
Herr Struck hat sich vorhin zu Herrn Ackermann - das ist der, der mit dem V-Zeichen durch den Gerichtssaal ging - geäußert. Als ich heute früh auf dem Ticker sah: ?Ackermann verzichtet?, war ich eine Sekunde lang voller Hoffnung. Dann las ich: Er verzichtet auf seine Boni. - Lieber Peter Struck, das ist ja noch schlimmer als das, was du über ihn gesagt hast. Dass der Mann überhaupt glaubt, er hätte in diesem Jahr einen Bonus verdient - statt dass er sein ganzes Gehalt abgibt -, ist doch eine ungeheure Chuzpe. Wofür denn eigentlich? Für sinkende Börsenkurse?
Und von denen lässt man sich das Ganze schreiben? Von denen - das atmet das Paket - lässt man sich eine Milliardenhilfe aufschreiben? Dieses Paket atmet: Gib mir Geld, aber misch dich nicht ein! In meine Bücher darfst du nicht schauen. - Das Paket ist nicht in Ordnung. Deshalb stimmen wir mit Nein.
Sie sagen: Es geht um die Bürger. - Aber am Ende steht hier: Bürgschaften zuerst und Rekapitulation - - Rekapitalisierung erst am Ende.
- ?Kapitulation? ist ein guter Versprecher. Kapitulation ist das, was Sie machen.
Sie sitzen quasi mit weißen Fahnen hier im Plenum.
Wenn Sie rekapitalisieren, dann ganz still; bloß nicht ins operative Geschäft rein. Wenn wir diesen Bankern nicht trauen können, wie selbst Herr Kauder in seiner linken Rede zum Besten gegeben hat, dann können wir doch nicht sagen: ?Wir geben euch Geld, aber wir gehen nicht ins operative Geschäft? und darauf hoffen, dass die Ackermanns dieser Welt es verstanden haben. Sie haben es nicht verstanden.
Deshalb sage ich: Dieses Paket ist nicht in Ordnung. Wir stimmen mit Nein.
Sie haben hier wie in den letzten Tagen so getan, als brauche man die Regeln der Marktwirtschaft nur zu beachten; dann sei schon alles in Ordnung. Sie haben so getan, als seien das Fehler einiger schwarzer Schafe. Ich sage Ihnen: Auch die soziale Marktwirtschaft in ihrer heutigen Gestalt ist in einer Vertrauenskrise, weil sie Raffgier und exzessive Selbstbedienung zugelassen hat. Auch da müssen wir die Regeln aufs Schärfste ändern.
Die Menschen haben das Recht, zu sehen und zu erleben, dass mit ihrem Geld wirklich sorgfältig umgegangen wird, eben nicht zu den alten Bedingungen. Sie reden über zwei Schritte: Erst geben wir das Geld - Durchreiche von der Küche zum Esszimmer -, und erst später, in einem zweiten Schritt, müssen wir den fälligen und nötigen Umbau des Finanzmarkts vornehmen. - Ich sage Ihnen heute und hier: In diesem Paket muss der Umbau des Finanzmarkts beginnen. In diesem Paket muss man eine aktive Teilhabe organisieren, muss man Transparenz, parlamentarische Kontrolle und parlamentarische Mitentscheidung organisieren.
Das können Sie nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben.
In diesem Paket steht am Ende nur, dass mehr informiert wird. Sie gründen noch einen Ausschuss, aber das reicht uns nicht. Was wir wollen, ist der größtmögliche Einfluss des Fonds auf die Unternehmenspolitik, die größtmögliche Kontrolle. Wir wollen die Mitentscheidung des Deutschen Bundestages, der 614 Leute, die dafür gewählt worden sind.
Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner:
Frau Kollegin.
Renate Künast (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Mein letzter Satz. - Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren: Dieses Paket ist ein 500-Milliarden-Euro-Blankoscheck. Dieses Paket, das Sie vorlegen, entspricht der alten Systematik. Es ist nicht in Ordnung, und deshalb stimmen wir mit Nein.
Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner:
Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Kollege Westerwelle.
Dr. Guido Westerwelle (FDP):
Frau Kollegin, ich will mich nicht mit Ihrer Rede insgesamt auseinandersetzen, aber da Sie die FDP und das Wahlprogramm der FDP zitiert haben, möchte ich doch eine Bemerkung machen.
Sie haben das aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist in meinen Augen auch in einer aufgeregten Debatte nicht zulässig. Wenn wir von politischem Einfluss gesprochen haben, so bezog sich das ausdrücklich auf den parteipolitischen Einfluss, und es bezog sich auf das große Thema: Staatsbanken und IKB-Anteil.
Sie wissen, wir sagen seit vielen Jahren, es war ein Fehler, dass die Staatsbank KfW sich mit etwa 30 Prozent bei der IKB engagiert hat. Wir haben Ihre Entscheidung, die Sie während Ihrer Regierungszeit getroffen haben, für falsch gehalten. Das ist der entscheidende Kritikpunkt gewesen. Wir waren der Überzeugung, Staatsbanken seien dafür zuständig, bei Existenzgründungen und Forschung sowie mittelständischen Betrieben zu helfen; aber sie sind nicht dafür zuständig, an der Weltbörse herumzuspekulieren. Diese Meinung bleibt unverändert richtig.
Als Zweites möchte ich einfach sagen: Sie haben eine außerordentlich engagierte Rede gehalten. Sie haben vor allem lauter Defizite beklagt. Ich darf Sie daran erinnern: In den letzten zehn Jahren haben Sie sieben Jahre lang regiert. Jede fehlende Regel, die Sie anmahnen, hätten Sie in sieben Jahren durch dieses Haus bringen können.
Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner:
Frau Kollegin Künast, Sie können antworten.
Renate Künast (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Westerwelle, ich weiß nicht, wozu Sie heute debattieren. Ich diskutiere zu dem vorliegenden Maßnahmenpaket der Bundesregierung, dem Sie zustimmen möchten und das wir ablehnen möchten. Ich will aber, weil Sie mir vorgeworfen haben, zu wenig von der FDP zu zitieren, die Gelegenheit nutzen, noch zwei Sätze zu zitieren, die beide von Ihnen sind und die für meine Begriffe bezeichnend sind für das Motiv Ihrer heutigen Zustimmung.
Der eine Satz von Ihnen stammt aus einer Rede aus dem Jahre 2003:
Deutschland braucht eine grundlegende Kurskorrektur in Richtung weniger Steuern, weniger Staat und Deregulierung.
Das heißt, den Bankern, den Finanzdienstleistern, die diesen Schaden angerichtet haben, begegnen Sie mit weniger Staat, weniger Steuern und weniger Regulierung.
Ich kann stundenlang so weitermachen. Ein weiteres Zitat von Ihnen:
Die FDP steht für Entstaatlichung statt Verstaatlichung.
Davon grenze ich mich ab, weil ich glaube: Dass Sie in einer solchen Situation, die gekennzeichnet ist von Milliardenschäden weltweit, von Sorge der Menschen um ihre Altersvorsorge, von Sorge der Kommunen um ihre Absicherung, strahlend da sitzen und Juchhu rufen, nach dem Motto: Entstaatlichung statt Verstaatlichung, während dem Staat und dem Steuerzahler, dem kleinen Mann, das Geld aus der Tasche gezogen wird, um für diese Banker und ihre Abzockerei einen finanziellen Ausgleich zu schaffen, das, finde ich, spricht für sich.
Vizepräsidentin Dr. h. c. Susanne Kastner:
Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, möchte ich ergänzen, dass zwischenzeitlich der Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sowie je ein Entschließungsantrag der Fraktion der FDP, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vorliegen. Über den Änderungsantrag wie auch über den Gesetzentwurf werden wir später namentlich abstimmen. Wir haben zu diesem Tagesordnungspunkt damit zwei namentliche Abstimmungen.
Ich weise schon jetzt darauf hin, dass wir beim nächsten Tagesordnungspunkt, dem Punkt 35, GKV-Beitragssatzverordnung, eine weitere namentliche Abstimmung haben.
Jetzt gebe ich das Wort dem Kollegen Carsten Schneider, SPD-Fraktion.
Carsten Schneider (Erfurt) (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Hinter uns liegt eine ungewöhnliche Woche, ungewöhnlich, was die Form des Gesetzes und die Höhe der öffentlichen Mittel, die hier teilweise bereitgestellt werden, angeht, ungewöhnlich auch im Hinblick auf die Maßnahmen; denn wir ermöglichen mit diesem Gesetzespaket eine Teilverstaatlichung von Banken, und das mit der Zustimmung der CDU/CSU und der FDP. Wer hätte das gedacht?
Es sind auch ungewöhnliche Reden gehalten worden. Frau Künast, ich hätte mich wirklich sehr gefreut, wenn wir die Rede von Herrn Kuhn von Mittwochmorgen hätten aufgreifen können. Die Änderungen, die Sie angemahnt haben, haben wir in großen Teilen eingebracht.
Frau Künast, Ihre Rede war sehr engagiert. Aber sie war auch bar jeder Sachkenntnis.
Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Ich bedaure das sehr.
Wir haben Änderungen hinsichtlich der parlamentarischen Kontrolle vorgenommen. Das, was Sie, Herr Kuhn, und auch Sie, Herr Gysi, eben angemahnt haben, steht in dem Gesetzentwurf. Es soll ein neuer Sonderausschuss mit eigenen Rechten eingerichtet werden, der umfänglich informiert wird, der sogar bei einer Rechtsverordnung ein Vetorecht bei der Abwicklung des Fonds hat und der alle Informationen bekommt. Was wir allerdings nicht wollen, ist eine exekutive Befugnis des Bundestages; das stimmt. Ich will keine Einzelfallentscheidungen treffen; das liegt nicht in unserer Verantwortung.
Die Parlamentsbeteiligung ist jetzt verankert. Ich gebe zu, der erste Entwurf war von der Regierung; die hat das manchmal nicht so gern. Die Parlamentsbeteiligung ist ein wichtiger Anker in einem Gesetz -
ich habe das am Mittwoch als mögliche Zeitenwende bezeichnet -, das zumindest in Bezug auf seine Größenordnung und seine Bedeutung für dieses Land mit nichts zu vergleichen ist.
Ich denke, dass auch die Veränderung, die wir bei der Durchführungsorganisation vorgenommen haben - die Bundesbank stand im ersten Entwurf unter der Rechts- und Fachaufsicht des Finanzministeriums; das ist nun nicht mehr der Fall -, dieser wichtigen Einrichtung entgegenkommt. Damit haben wir insbesondere die Unabhängigkeit der Bundesbank herausgestellt.
Frau Künast - zu den Linken komme ich später -, Sie haben gesagt, die Summe von 500 Milliarden Euro entspreche dem doppelten Bundeshaushalt - das stimmt -, und das sei ganz ungewöhnlich; das stimmt nicht. Wir haben in jedem Haushaltsgesetz, dem auch Sie früher zugestimmt haben, Garantien von über 300 Milliarden Euro.
Jetzt haben wir 400 Milliarden Euro, zusätzlich eine Kreditermächtigung für 70 Milliarden Euro plus eine mögliche Erhöhung durch den Haushaltsausschuss. Das ist der ungewöhnliche Teil. Aber die Garantien sind überhaupt nicht ungewöhnlich. Jetzt haben wir sogar noch mehr Kontrolle als bei den Garantien, die wir sonst als Bürgschaften und Ähnliches geben.
Von daher kann ich Ihre Position nicht verstehen. Bei der Bedeutung, die dieses Gesetz für den Finanzmarkt und den Wirtschaftsstandort der Bundesrepublik Deutschland hat, ist das nicht zu verantworten. Ich bedaure das.
Nun zum Verursacherprinzip. - Herr Präsident, es wird eine Zwischenfrage gewünscht.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Ich erteile dem Kollegen Kuhn das Wort zu einer Zwischenfrage.
Fritz Kuhn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ich möchte wissen, ob wir eigentlich über das Gleiche reden. Wir hatten hier eingefordert, dass, wenn man ein Paket aus Rekapitalisierung und Garantien in der Höhe von 480 Milliarden Euro schnürt, dann das Parlament nicht eine pauschale Ermächtigung an den Bundesfinanzminister geben, sondern letztlich selbst entscheiden soll. Das hatte ich in dieser Woche begründet. Sie haben in Ihrer Rede gesagt, dass Sie dem beitreten wollen. Jetzt findet sich in dem Gesetz, das Sie heute Nacht endverhandelt haben, ein neuer Unterausschuss, der unter Geheimkriterien arbeiten muss und Informationsrechte erhält, aber bei größeren Paketen - ich rede nicht über die Bürgschaften, sondern über die Rekapitalisierung für den Fall, dass eine Bank gerettet werden soll - in der Sache nicht entscheidet.
Meine Frage an Sie ist: Wenn es so ist, wie ich es schildere, können Sie dann wirklich ernsthaft behaupten, es gebe eine parlamentarische Kontrolle? Das ist doch nicht richtig; vielmehr ist das einfach eine Information.
Carsten Schneider (Erfurt) (SPD):
Herr Kuhn, ich habe am Mittwoch zugesagt, wir werden die Parlamentsrechte verbessern. Bisher bestand nur die Möglichkeit einer Unterrichtung des Bundesfinanzierungsgremiums. Das haben wir deutlich verändert. Nun gibt es einen eigenständigen Ausschuss.
Dieser hat das Recht, bei einer Abwicklung des Fonds der Verordnung zuzustimmen.
Das ist entscheidend. Es ist richtig, was Sie gesagt haben: Wir entscheiden nicht über Einzelfälle. Dazu, Herr Kuhn, fühle ich mich auch gar nicht in der Lage.
Dazu habe ich auch nicht die Sachkenntnis. Das will ich als Abgeordneter des Deutschen Bundestages nicht entscheiden, sondern das machen die Bundesbank und die Finanzmarktstabilisierungsanstalt. Wir geben die Richtlinien vor und kontrollieren die Regierung. Das ist die Aufgabe des Parlaments.
Wir erteilen klare Auflagen. Wer Leistung erhalten will, wer unter den Garantieschirm will, wer Eigenkapital erhalten will und wer als letzte Möglichkeit - das haben wir im Gesetz in der Reihenfolge geändert - wünscht, dass wir schlechte Assets, schlechte Posten aus der Bilanz herausnehmen, der muss eine Gegenleistung erbringen. Ich kann die Linke überhaupt nicht verstehen, dass sie dem nicht zustimmt. Mit diesem Gesetzentwurf haben wir endlich die Chance - und die FDP stimmt zu -, einer Verstaatlichung von Banken zuzustimmen.
- Herr Westerwelle, Sie sollten Ihre Zustimmung nicht davon abhängig machen. Ich bin jedenfalls dieser Auffassung.
Sie können aktiv werden, und was tun Sie, Herr Gysi? Sie halten eine schöne, rhetorisch brillante Rede, aber im Endeffekt ändert sich nichts.
Sie beklagen die Pension von Herrn Funke von der Hypo Real Estate. Das ärgert auch mich wahnsinnig. Der Aufsichtsrat hat aber einen Vertrag mit dem Vorstand geschlossen, und der Vertrag gilt. Sie wissen auch, dass das gar nicht anders geht. In bestehende Verträge können Sie nicht eingreifen.
Ich begrüße es jedoch, dass der Aufsichtsrat der Hypo Real Estate jetzt die Konsequenzen gezogen hat und gegenüber Herrn Funke von der Möglichkeit Gebrauch macht, die wir unter Rot-Grün eingeführt haben, nämlich Vorstände von Aktiengesellschaften zu verklagen, sie zur Rechenschaft zu ziehen und von ihnen Schadenersatz zu fordern. Das passiert auch, und das ist zu begrüßen.
Viele Kollegen haben die Frage der Akzeptanz von Demokratie angesprochen. Wir sind sicherlich in einer schwierigen Situation. Ich glaube aber - dabei stimme ich mit Herrn Kollegen Kauder überein -, dass wir als Bundestag, als Bundesrat und als Bundesregierung bewiesen haben: Unsere Institutionen funktionieren.
Ich wünsche mir, die anderen Institutionen, die Banker, die uns die Suppe eingebrockt haben, würden überhaupt einmal an die Öffentlichkeit treten. Ich sehe keinen Herrn Ackermann und keinen Herrn Blessing. Ich schätze sie im Einzelnen, aber wo sind sie denn? Sie haben Kommunikationsstäbe, betreiben Öffentlichkeitsarbeit, machen Kampagnen usw. Sie selbst treten aber nicht auf und übernehmen nicht die Verantwortung. Ich finde, das ist unsäglich.
Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, der meiner Fraktion sehr wichtig ist. Dass dieser Fonds Minus macht, ist erstens nicht Ziel und zweitens nicht entschieden.
Ich glaube, dass dieses Paket funktioniert und dass wir den Markt stabilisieren und die Wirtschaft am Laufen erhalten. Damit ist das schon das beste Konjunkturpaket. Im Übrigen sollte es möglichst nicht in Anspruch genommen werden. Wenn dies aber geschehen sollte, dann muss sich nach meiner Auffassung und nach der Auffassung meiner Fraktion der Deutsche Bundestag damit beschäftigen, wie eine geeignete Refinanzierung aus dem Finanzsektor selbst heraus dargestellt werden kann. Das ist für uns eine Bedingung. Ich bin froh, dass wir das mit in die Beschlussempfehlung aufgenommen haben.
Es kann nicht sein, dass wir als Staat die immens wichtige Finanzwirtschaft und ihre Existenz garantieren; denn nur noch wir sind weltweit der letzte Anker. Irgendwann werden wir die Krise überwunden haben, und das System wird wieder funktionieren. In der Krise gibt es im Übrigen auch Banken, die Geld verdienen. Es wird wieder eine Situation geben, in der die Unternehmen viel Geld verdienen.
Ich finde, dann ist es durchaus selbstverständlich - wir wollen dies politisch -, dass nicht die Kindergärtnerin, nicht der Handwerksmeister und nicht die Krankenschwester, sondern insbesondere die Banken das mit ihren Gewinnen finanzieren. Dann erzielen sie halt eine Zeit lang keine Eigenkapitalrendite mehr von 25 Prozent, sondern nur noch eine Eigenkapitalrendite von 15 Prozent. Das geht auch, das ist verkraftbar. Das ist meines Erachtens ein wichtiges Signal an die Bevölkerung. Die SPD will, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.
Meine Damen und Herren, ich glaube, bei aller Schwierigkeit hat der Bundestag ordnungsgemäß und sauber beraten. Wir haben diesen Gesetzentwurf bis heute Morgen um halb drei bearbeitet. Ich glaube, das ist im Hinblick auf die Bedeutung nicht zu vergleichen. Daher hoffe ich, dass zum einen die Regierung ihre Verantwortung wahrnimmt, die wir ihr in weitreichender Form jetzt geben - wir werden das kontrollieren -, und dass zum anderen dieses Paket tatsächlich wirkt und damit letztlich das erhoffte Ziel erreicht wird, nämlich eine Stabilisierung des Finanzmarktes unter den derzeit kritischen wirtschaftlichen Bedingungen.
Ich bedanke mich bei der Bundeskanzlerin und beim Bundesfinanzminister für diesen Entwurf.
Danke schön.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nächster Redner ist Herr Kollege Otto Fricke für die FDP-Fraktion.
Otto Fricke (FDP):
Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich will als Ausschussvorsitzender versuchen, das darzustellen, was zu nachtschlafender Zeit beschlossen wurde.
Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen Fraktionen für die Arbeit im Ausschuss; denn wir haben das trotz der Belastung und trotz der Eile nicht in einem Hickhack, sondern parlamentarisch gemacht. Man sollte auch nach draußen sagen, dass wir bei allem Unterschied den Ernst der Lage sehen, weil wir alle wollen, dass am Montag Kredite ausgegeben werden, am Montag Geld abgehoben werden kann und der Bürger sagen kann, die Politik kümmere sich um seine Sorgen.
Herr Minister, Sie haben es gesagt. Jetzt ist die Zeit, um Feuer zu löschen. Danach ist sicherlich die Zeit, zu überlegen, wie man das Feuer besser löschen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, es ist aber nicht die Zeit, nur zu sagen: Da brennt es. Es ist Ihre Aufgabe, dabei mitzuhelfen, das Feuer zu löschen. Sie beteiligen sich nicht daran, sondern es ist wie immer: Wenn es ernst wird, dann sind Sie hinter den Büschen und nicht am Brandherd. Das ist Ihr Fehler.
In die Richtung der Grünen sage ich: Unsere Aufgabe als Parlament endet nicht damit, dass wir den Ausschuss einrichten. Ich stimme dem Kollegen Schneider vollkommen zu. Wir als Parlamentarier sollen nicht im Detail sagen, wie wir das machen. Wissen Sie genau, wie Sie mit einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit umgehen wollen? Wissen Sie, wie Sie mit einer Sparkasse oder mit einer Genossenschaftsbank, mit einem Investmentfonds oder mit was auch immer umgehen sollen?
Das bedarf ganz unterschiedlicher schneller Regelungen. Hierzu brauchen wir Fachleute, die schnell entscheiden.
Ich sage ausdrücklich für meine Fraktion: Wenn dabei etwas schiefläuft, wenn meine Fraktion feststellt, dass sich dabei etwas in die falsche Richtung bewegt, dann werden wir hier Gesetzesinitiativen einbringen. Das ist eine Aufgabe, die wir als Parlamentarier haben, nämlich den Vorgang zu überwachen. Ich bin mir sicher, dass die Fraktionen das tun werden und sagen: Wenn das in die falsche Richtung geht, wenn wir als Legislative das nicht so haben wollen, dann müssen wir agieren. Dann werden wir das auch tun. Dann wird die FDP auch aufgrund ihrer Zustimmung bei den Koalitionsfraktionen einfordern, dass dies passiert.
Zu dem, was beschlossen worden ist, will ich zwei Dinge sagen: Erstens. Die Bedenken des Bundesbankpräsidenten sind meiner Ansicht nach ausgeräumt. Ich sage ausdrücklich, das hat die Koalition bereits vorab veranlasst. Das war klar, als wir in die Verhandlungen eintraten, das will ich klarstellen.
Zweitens. Als es um die Beteiligung des Parlaments ging, gab es in der Koalition etwas Widerstand, das will ich auch deutlich sagen. Deswegen ist meine Fraktion sehr froh, dass Sie unserer Ansicht folgen konnten, einen eigenen neuen Ausschuss einzuführen, der ähnlich wie das Parlamentarische Kontrollgremium im Bereich der Geheimdienste agiert. Viele haben noch nicht gesehen, dass wir so einen Ausschuss haben, der dem Bundesrat, der für sich die Zustimmung zur Exit-Strategie haben wollte, gleichgestellt ist. Wir als Parlament müssen ebenso wie der Bundesrat zustimmen, wenn es um die Exit-Strategie geht.
- Für Sie ist das nicht toll, ich weiß. Für Sie ist es egal, ob sich das Parlament beteiligt oder nicht.
- Sie haben sieben Jahre lang nichts gemacht.
Jetzt könnten Sie etwas tun, aber Sie sind nicht bereit, das zu tun. Das ist Ihre Schwäche, die Sie gerade zu kaschieren versuchen.
Jetzt ist keine Zeit für Euphorie. Es ist auch keine Zeit für Selbstlob oder für Besserwisserei, Herr Gysi. Ich will mit einem Bild enden: In dieser Zeit hat man das Gefühl, dass unsere Marktwirtschaft aus einem Rahmen herausgefallen ist, den wir als Politiker geben müssen. Es ist jedoch nicht die Frage, was in diesem Rahmen gemalt wird. Es geht darum, diese Marktwirtschaft mithilfe des Staates wieder in den Rahmen zu setzen. Es geht darum, diesen Rahmen zu stärken und dafür zu sorgen, dass dieser Rahmen auch in den nächsten Tagen und Jahren trägt.
Herzlichen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält nun der Bundesminister für Wirtschaft, Michael Glos.
Michael Glos, Bundesminister für Wirtschaft und Technologie:
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich meine, dass wir das Maßnahmenpaket, über das wir heute entscheiden, zum richtigen Zeitpunkt geschnürt haben. Es bewegt sich im internationalen Geleitzug. Es bewegt sich im europäischen Gleichklang, und es erlaubt uns, etwas für unsere eigenen Banken zu tun. Ich finde, dass das der richtige Weg ist.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, bereits bevor dieses Paket abschließend verabschiedet ist, hat es auf den internationalen Märkten Wirkung gezeigt. Es hat zur Beruhigung beigetragen. Ein Grund dafür liegt auch darin, dass sehr frühzeitig grundsätzliche Zustimmung von vielen Seiten des Hauses signalisiert worden ist. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich.
Die Menschen blicken heute wieder sehr stark auf den Staat und seine Handlungsfähigkeit, weil man gemerkt hat, dass andere Akteure, die so getan haben, als ob man den Staat und staatliche Autorität nie bräuchte, versagt haben.
Ich meine, es ist in den letzten Tagen und Wochen viel Vertrauen verloren gegangen. Wir wissen, dass die Krise in allererster Linie von den Vereinigten Staaten ausgegangen ist, weil es sehr viel leichtes Geld gegeben hat und dadurch die Maßstäbe ein Stück verrückt worden sind. Wir wissen, Vertrauen ist sehr rasch zerstört, aber es ist nur sehr langsam wiederzugewinnen.
Eines der Vertrauensverhältnisse überhaupt ist normalerweise das Vertrauensverhältnis zwischen einem Bankkunden und seiner Bank. Es gehört zu den Dingen, die gepflegt wurden, die ein Stück bürgerliche Tugenden waren, dass man gut beraten worden ist, man sich darauf verlassen hat und sich die Bank darauf hat verlassen können, dass der Kunde wenn immer möglich zurückzahlt. Da ist sehr viel kaputtgegangen. Das finde ich ganz besonders schlimm. Wie soll denn ein Bankkunde seiner Bank weiter trauen, wenn er weiß, die Banken trauen sich untereinander nicht mehr und benehmen sich untereinander wie konkurrierende sizilianische Clans?
Deswegen müssen wir alles tun, damit auch zwischen den Banken Vertrauen wieder möglich ist; denn die Banken müssen natürlich den Blutkreislauf der Wirtschaft immer wieder mit Geld und Kredit versorgen und beleben.
Ich bin auf der einen Seite traurig, dass es einer solchen Krise bedurft hat, damit man wieder die Dinge vom Kopf auf die Füße stellt. Auf der anderen Seite finde ich, in einer Zeit, in der man so viel von Politikverdrossenheit redet, ist es großartig, dass die Menschen noch so viel Vertrauen in die Politik und die Handlungsfähigkeit des Staates haben.
Ich bedanke mich bei allen für die Bereitschaft, mitzumachen und rasch zu handeln. Ich weiß, es ist Ihnen sehr viel zugemutet worden. Aber wir handeln nicht für die Banken, wie viele glauben, sondern in allererster Linie für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, für die Wirtschaft und damit für die Arbeitsplätze.
Das Paket ist zwar an die Finanzwirtschaft adressiert; doch die eigentlichen Empfänger - ich sage es noch einmal - sind die Menschen in unserem Land, vor allen Dingen die kleinen und mittleren Betriebe. Die eigentlichen Empfänger sind die Regionen, die für die Zukunft unserer Volkswirtschaft stehen. Der Wohlstand unseres Landes wird in der Relation zu anderen Volkswirtschaften nur in geringem Umfang in den Bankentürmen und den Versicherungszentralen erwirtschaftet. Renditen, die dort aufscheinen, haben im Grund nur Bestand, wenn sie zuvor in den Fabriken und Handwerksbetrieben, im Handel und in den freien Berufen durch Hand- und Kopfarbeit erarbeitet worden sind.
Einige angeblich besonders fortschrittliche Länder - wir Deutsche sind da oft als rückschrittlich bezeichnet worden - haben geglaubt, dass man Geld am besten mit dem Handel mit Geld verdienen kann. Entsprechend aufgebläht ist dort die Finanzbranche gewesen, und entsprechend tief ist der Fall dieser Volkswirtschaften.
Wir in Deutschland hingegen haben immer auf einen starken Industriesektor gesetzt. Heute ist in keinem Land vergleichbarer Größenordnung der Anteil der Industrie an der Bruttowertschöpfung so hoch wie bei uns - und das erfreulicherweise mit steigender Tendenz.
Umso mehr gilt: Wir müssen jetzt unsere produzierende Industrie stützen. Niemand kann zurzeit sagen, welche Auswirkungen die Krise der Finanzmärkte auf die produzierende Wirtschaft hat. Aber eines steht fest: Wer von einer allgemeinen Krise der Volkswirtschaft redet, will nur Panik machen wie die linke Seite dieses Hauses
und daraus politisches Kapital schlagen.
Wahr ist: Viele Branchen haben sich bisher als ungeheuer widerstandsfähig erwiesen. Das müssen wir weiter stützen und erhalten. Das bestätigen mir vor allen Dingen die Vertreter der Wirtschaft, die ich zu Gesprächen in mein Haus eingeladen hatte. Sie betonen: Zur Panik gibt es keinen Grund, aber wohl einen Grund zur Vorsicht und zur Vorsorge. Die Finanzmarktkrise wird selbstverständlich nicht ohne Auswirkungen auf die Konjunktur- und Wachstumsentwicklung bleiben. Schon vor der Krise der Finanzmärkte hat sich die Lage eingetrübt. Deshalb rechne ich für das kommende Jahr mit einem Wachstum von 0,2 Prozent. Dieser in Relation zu den vergangenen Jahren geringe Zuwachs überdeckt die positiven Erscheinungen in Teilbereichen. Der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ist derzeit in einer guten Verfassung. In diesen turbulenten Tagen wird ein Riesenerfolg kaum zur Kenntnis genommen, nämlich die Tatsache, dass zum ersten Mal seit 2001 in diesem Herbst mehr Ausbildungssuchende einen Ausbildungsplatz finden, als die Wirtschaft anbieten kann. - Das heißt, umgekehrt.
- Ich sage es ganz klar, Herr Kuhn: Es gibt inzwischen sehr viel mehr Ausbildungsplatzangebote als dafür geeignete Bewerber. Das ist der Unterschied zu früher.
Die Zahl der Beschäftigten in unserem Land ist um 1,5 Millionen gestiegen. Das ist eine ungeheuer große Stütze und sorgt für zusätzliches Einkommen und damit natürlich auch für zusätzliche Einnahmen aus Steuern und Abgaben in den öffentlichen Kassen. Der Konsum profitiert ebenfalls davon. Deswegen steigt der Konsum bei uns im Land trotz der Finanzmarktkrise noch an. Nur die Nachfrage nach langlebigen Wirtschaftsgütern wie zum Beispiel Autos leidet derzeit. Aber auch hier haben wir die Möglichkeit, Unsicherheiten vom Markt zu nehmen. Ein Beispiel: Wenn wir das Problem der sogenannten CO2-Besteuerung möglichst rasch lösen, dann hört auch der Attentismus auf, den es derzeit bei den Automobilkäufern gibt, weil man nicht weiß, wie das künftig besteuert wird.
Etwas anderes wird den Konsum ebenfalls stützen. Die Preissteigerungsrate geht wieder zurückgeht. Hinzu kommt die Tatsache, dass sich der Dollar-Euro-Kurs - wenn man so sagen will - wieder exportfreundlicher eingependelt hat. Vor allen Dingen werden die zurückgehenden Öl- und Energiepreise stark dazu beitragen. Hier haben wir ja riesige Bocksprünge erlebt. Noch im Juli hat Öl auf den Märkten mehr als doppelt so viel gekostet wie heute. Ich glaube, es hat noch nie eine Zeit gegeben, in der so viele Bocksprünge in der Weltwirtschaft sozusagen über uns hereingebrochen sind.
Ich finde, insgesamt haben wir das alles gut gemeistert. Deswegen gibt es überhaupt keinen Grund für Pessimismus. Im Gegenteil: Wir können die Probleme lösen.
Die Lehre ist ganz klar: Jetzt müssen die Reformen weitergehen. Unsere Wirtschaft verträgt in dieser schwierigen Zeit keine weiteren zusätzlichen Belastungen. Sie steht ohnehin unter Stress. Unternehmen und Bürger brauchen jetzt Rückenwind und nicht zusätzlichen Gegenwind. Deswegen muss man jetzt über ein Belastungsmoratorium nachdenken. Konkret werde ich darauf drängen - auch unsere Bundeskanzlerin kämpft in Brüssel dafür -, dass unsere Automobilindustrie nicht durch überzogene Regeln in ihrer Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt wird.
Manches von dem, was wünschenswert ist, lässt sich aber nicht in entsprechender Geschwindigkeit verwirklichen und umsetzen. Dafür müssen wir uns halt ein bisschen mehr Zeit lassen.
Die Androhung von Strafzahlungen in Milliardenhöhe, wenn eine Technologie nicht rasch genug eingeführt wird, halte ich in der gegenwärtigen Zeit für ein vollkommen falsches Signal.
Natürlich müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die Wirtschaft weiterhin auf Touren zu halten. Dazu gehört auch eine Rückbesinnung auf die Tugenden der sozialen Marktwirtschaft.
Wir fordern nicht Kapitalismus. Das war nie unser Weg. Im Gegenteil: Der Kapitalismus in seiner brutalen Form ist gegen die Wand gelaufen, wie wir gerade auf den Finanzmärkten gesehen haben. Soziale Marktwirtschaft ist das Gebot der Stunde.
Trotzdem gibt es keinerlei Grund, auf eine Staatswirtschaft zu setzen. Das wäre ein Holzweg. Ein staatlich beherrschter Bankensektor wäre für mich ein Schreckensszenario.
Stattdessen ist es besser, mit Klugheit und Voraussicht internationale Regeln zu schaffen, die diese Spekulationsblasen in Zukunft nicht zulassen. Weder neunmalkluge Finanzmanager noch staatlich beauftragte Banker oder Aufseher können die Probleme lösen.
Man braucht vielmehr ein Stück Maß und Verantwortungsgefühl.
Deswegen meine ich: Jetzt, da der Brand, wie wir hoffen, bald ausgetreten ist
und die Löschzüge - ich bleibe in dem Bild, das Herr Fricke vorhin gezeichnet hat - abgefahren sind, gilt es, den Ordnungsrahmen der Finanzwirtschaft national, europäisch und international passend zu reformieren.
Wir werden dabei aber nicht alle künftigen Probleme und Gefahren voraussehen können. Deshalb gilt mein erster Appell allen, die in Staat und Wirtschaft an den Schalthebeln sitzen. Sie tragen - genauso wie wir als Parlamentarier und Regierungsmitglieder - Verantwortung für die Menschen und nicht nur Verantwortung für das eigene Bankkonto.
Deswegen, finde ich, ist es ein erstes erfreuliches Zeichen, wenn sich der Vorstand einer großen Bank in Deutschland dazu entschließt, seine ihm zustehenden Bonizahlungen jetzt nicht in die eigene Tasche zu stecken.
Ich glaube, diesem Beispiel müssen viele andere folgen. Wir müssen auch die Gier bekämpfen, die sich bei den Akteuren - weniger in Deutschland, sondern anderswo - breitgemacht hat.
Ich möchte schließen, indem ich dem Parlament und allen, die mitgeholfen haben, dieses Rettungspaket möglich zu machen, herzlich für ihre Arbeit danke. Ich bedanke mich auch bei der FDP dafür, dass sie als Opposition zustimmt, weil sie spürt, dass wir das alles tun müssen, um unser Land wieder in eine bessere Zukunft führen zu können.
Herzlichen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Alexander Bonde ist der nächste Redner für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.
Alexander Bonde (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bundesregierung erwartet heute von uns, dass wir ihr fast 500 Milliarden Euro der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler anvertrauen. Ich will Sie ernsthaft fragen: Wie können Sie eigentlich von uns erwarten, dass wir in der größten Wirtschaftskrise, die diese Republik in den letzten Jahren erlebt hat, einer Regierung vertrauen, die so einen Wirtschaftsminister hat?
Herr Glos, wir haben uns ja schon gewundert, weshalb Sie in der wirtschaftlichen Situation, die wir erleben, auf Tauchstation gegangen sind. Nach dieser Viertelstunde muss ich ehrlich sagen, Sie hätten besser weiter geschwiegen.
Ich will sagen: Wir alle gemeinsam haben keine einfache Woche hinter uns.
Wir haben uns als Fraktion sehr intensiv mit der Situation befasst. Auch wir sind der Auffassung, dass die Krise auf den Finanzmärkten ein Rettungspaket in Deutschland notwendig macht. Wir sind der Auffassung, dass es ein schnelles und wirksames Paket braucht. Deshalb haben wir ja auch auf die uns zustehenden Rechte in der Frage der Fristen und Ähnlichem verzichtet. Wir haben bis letzte Nacht um 2 Uhr mit ganz konkreten Angeboten an die Koalition und auch in Verhandlungen mit der FDP deutlich gemacht, dass wir uns nicht aus der Verantwortung stehlen, aber dass wir klare Anforderungen an ein Rettungspaket haben.
Diese Anforderungen lauten: Wir sind in der jetzigen Krise, in der das Parlament erkennbar handlungsfähig sein muss, nicht bereit, die Parlamentsrechte an die Regierung blanko abzutreten.
Herr Westerwelle, wir sind auch nicht bereit, es dafür zu tun, dass man uns im Kinosaal der Bundesregierung statt der Holzbank jetzt das Plüschsofa in der VIP-Loge gibt. Das sind ja Ihr Ausschuss und die Konstruktion, die Sie hier vornehmen. Entschieden wird nach wie vor von der Regierung. Das Einzige, was passiert, ist: Es wird ein bisschen näher an die Bühne herangerückt. Das ist nicht die Parlamentsbeteiligung, wie wir sie uns vorstellen.
Wir haben hier zur Parlamentsbeteiligung konkrete Vorschläge eingebracht, über die wir nachher namentlich abstimmen. Dann können wir ja sehen, wie eng Sie hier zusammenarbeiten.
Ich komme zu unserem zweiten Anspruch. Sie haben gesagt: Leistung gibt es nur gegen Gegenleistung. - Das ist aber in diesem Gesetzentwurf nicht geregelt. Es gibt zwar die Möglichkeit, Leistung gegen Gegenleistung zu erhalten. Das setzt aber voraus, dass diese Bundesregierung eine Verordnung beschließt, auf die wir als Parlament keinen Einfluss haben und von der wir nicht wissen, ob damit all das, was hier verkündet wird, tatsächlich umgesetzt wird.
Ich muss schon sagen: Sie muten uns viel zu. Sie verlangen von uns, dass wir der Regierung glauben, dass sie die Härte, die sie hier ankündigt, tatsächlich umsetzt, etwa in der Frage der Managerbezüge oder der Einwirkung auf die Geschäftspolitik. Die gleiche Regierung, die am Dienstag Herrn Tietmeyer, den Paten des Versagens auf den internationalen Finanzmärkten, zum Retter küren wollte,
darf hier nicht ernsthaft annehmen, dass wir ihr weiterhin vertrauen. Diese Regierung war sogar bereit, diese zentralen Kontrollfragen, die Verantwortung für die Regelung der Fragen von Einfluss im Dienste der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler blanko an Herrn Tietmeyer abzutreten, und merkt nicht einmal, dass dieser als Aufsichtsratsmitglied der HRE für die erste größte Belastung für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mitverantwortlich war.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege Bonde, bitte denken Sie an Ihre Redezeit.
Alexander Bonde (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ich will abschließend sagen: Wir haben Ihnen bis zur Erschöpfung Angebote gemacht. Wir legen sie hier erneut in einem Antrag vor. Wir machen die Türe nicht zu. Aber wir haben eine klare Verantwortung gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, die aus unserer Sicht in Ihrem Paket nicht ausreichend geschützt sind. Es geht um die einfachen Bürger, nicht um die Banker. Dies spiegelt Ihr Gesetzentwurf nicht wider. Da vertrösten Sie uns mit Verordnungen. Aber dafür haben Sie als Bundesregierung zu viel Vertrauen verspielt.
Unsere Türe ist für weitere Gespräche und Verhandlungen offen, um die Regelungen dieses Pakets zu verbessern. Aber für das, was heute zur Abstimmung steht, können Sie uns nicht mit in die Haftung nehmen. Dieses Paket ist mit zu heißer Nadel gestrickt und setzt erkennbar zu viel Vertrauen in die Bundesregierung voraus, das sie nach den Aktionen in den letzten Wochen von uns nicht mehr erwarten kann.
Herzlichen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Dr. Hans-Ulrich Krüger, SPD-Fraktion.
Dr. Hans-Ulrich Krüger (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auslöser für unsere heutige Diskussion - das kann nicht oft genug wiederholt werden - ist und bleibt die amerikanische Hypothekenkrise, die die Weltfinanzmärkte und damit auch Deutschland erschüttert hat. Es wurden Produkte, die an allen Bilanzen und Regeln vorbei nicht zu durchschauen waren, allein mit dem Ziel geschaffen, ungeheure Profite anzuhäufen.
Schlechte Darlehensforderungen wurden mit guten vermengt und mit erheblichem Profit als sogenannte Pakete verkauft. Durch unkalkulierbares Zocken und grobes Fehlverhalten ist diese Krise entstanden, von der Unternehmen, Rentnerinnen und Rentner, Handwerker, Beamte, Verbraucherinnen und Verbraucher, von denen der Mensch auf der Straße schlechthin betroffen ist, wenn er auf einmal keinen Kredit zu vernünftigen Konditionen mehr bekommt.
Deshalb stehen wir heute hier und werden in einer der gefährlichsten Finanzsituationen, die wir je hatten, Schaden von Deutschland abwenden. Die Große Koalition hat robust reagiert, um die zentrale Aufgabe zu erfüllen: die Wiederherstellung des Vertrauens zwischen den Marktteilnehmern.
Als letzte Instanz tragen wir dazu bei, dass sich Banken untereinander wieder trauen und ihre Aufgabe erfüllen. Dazu dienen die schon mehrfach angesprochenen 400 Milliarden Euro an Garantien und die zusätzlichen 80 Milliarden Euro.
Aber jenseits dieser aktuellen Diskussionen - damit komme ich zu meinem Schwerpunkt - ist eines zu beachten: Es geht bei diesem Gesetz nicht - egal, wer etwas anderes sagt - um den Schutz der Banken und Manager, sondern um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Für diese übernehmen wir mit diesem Paket Verantwortung in diesem Lande.
Außergewöhnliche Marktbedingungen machen außergewöhnliche Maßnahmen erforderlich. Aber mit dem Gesetz, um das es heute geht - darauf lege ich ebenso großen Wert -, enden unsere Bemühungen nicht. Nein, sie beginnen. Jedem in diesem Hause muss bewusst sein, dass weitere Schritte folgen müssen, wenn wir eine neue, eine bessere Finanzarchitektur schaffen wollen.
Eckpunkte dieser besseren Finanzarchitektur sind: Die Aufsicht über die Ratingagenturen muss international reguliert werden. Es ist nicht einzusehen, warum wir Europäer uns damit abfinden, dass es drei amerikanische ?weltbeherrschende? Ratingagenturen, aber kein europäisches Pendant gibt. Es müssen neue Transparenzpflichten für Risiken geschaffen werden. Jeder Finanzmarktakteur, der etwas anbietet, muss gleichzeitig eine eigene zu dokumentierende Risikoabschätzung beifügen. Kreditinstitute müssen Geld, das sie ausgeben - das gilt für jeden Euro und jeden Cent -, mit Eigenkapital unterlegen. Jedwedes Risiko muss innerhalb der Bilanz und darf nicht außerhalb der Bilanz dokumentiert werden.
Es ist bereits angesprochen worden, dass die Kontrolle über die Finanzmärkte zu verbessern ist. Selbstverständlich müssen wir auf europäischer und internationaler Ebene zusätzlich zu unserer guten nationalen Aufsicht, bestehend aus Bundesbank und BaFin, weitere Akzente setzen.
Eines vermag ich nicht einzusehen: dass Finanzmarktprodukte auf Dauer keiner Zulassungspflicht oder Ähnlichem unterworfen werden. Jedes Hustenmittel, das wir in einer Apotheke kaufen, hat umfangreiche Testreihen hinter sich. Warum nicht auch ein Finanzmarktprodukt, durch das ein Schaden in Milliardenhöhe angerichtet werden kann?
Wieso Leerverkäufe für das ordnungsgemäße Funktionieren einer Börse von Bedeutung sein sollen, ist und bleibt mir unerfindlich. Wir müssen auch bei Leerverkäufen ansetzen und darüber hinaus jeden Privatanleger so schützen, dass er, wenn er sich für ein riskantes Produkt entscheidet, genau weiß, welches Risiko er eingeht. Dieser Hinweis darf nicht mehr nur irgendwo im Kleingedruckten zu finden sein.
Ein weiterer Bereich, der geregelt werden muss und der das Gerechtigkeitsempfinden aller Menschen in diesem Land verletzt hat und nach wie vor verletzt, ist die Entwicklung der Managervergütungen, die in den letzten Jahren stattgefunden hat. Auch hier haben falsche Anreizsysteme dazu beigetragen, dass diese Krise so ist, wie sie ist.
In diesem Zusammenhang nur an die unternehmerische Ethik oder an das gesellschaftliche Verantwortungsgefühl zu appellieren, ist vielleicht ein bisschen naiv. Daher haben wir Sozialdemokraten schon vor Monaten eine Arbeitsgruppe gebildet, die intensiv die rechtlichen Möglichkeiten prüft, Managergehälter und Vorstandsbezüge zu regulieren.
An dieser Stelle möchte ich auch die persönliche Haftung von Vorständen und Aufsichtsräten erwähnen. Natürlich ist in verschiedenen Vorschriften des Aktienrechts eine normierte Haftung von Aufsichtsräten und Vorständen vorgesehen. Sie führt aber ein Schattendasein. Sie ist ein Mauerblümchen. Wir müssen durch eine Aktualisierung dieser Regelungen dafür sorgen, dass sich jeder Vorstand bewusst ist, dass er ein Risiko eingeht, wenn er sich seinen Aktionären gegenüber nicht verantwortlich verhält.
Einen anderen Aspekt möchte ich, obwohl er schon angesprochen worden ist, besonders hervorheben. Selbstverständlich erwarten wir, die Sozialdemokraten, dass sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene dafür einsetzt - hier sind die Interessen des deutschen Steuerzahlers die gleichen wie die des irischen oder des englischen Steuerzahlers -, dass diejenigen, die diese Misere verursacht haben, das am Ende der Veranstaltung möglicherweise vorhandene Defizit ausgleichen,
seien es die betroffenen Banken, die bei der Inanspruchnahme einer Garantie einen Garantiezins zu entrichten haben, sei es die Branche insgesamt. Wir müssen klipp und klar sagen: Wir wollen, dass beim Steuerzahler die schwarze Null verbleibt. Wenn das am Ende der Veranstaltung nicht der Fall ist, dann muss nicht der Steuerzahler, sondern dann müssen die Banken bzw. die privilegierten Institute das entstandene Defizit ausgleichen.
In diesem Zusammenhang bringt es nichts, Herr Kollege Gysi, mit vermeintlichen Ko-Ursachen zu operieren. Ich greife Ihr Beispiel von den Hedgefonds auf. Ja, es ist richtig: Durch das Investmentmodernisierungsgesetz sind auch in der Bundesrepublik Deutschland - und ich bitte, diese Nuance zu beachten - regulierte Hedgefonds, die der Aufsicht der BaFin unterstehen, mit besonderen Regelungen des Anlegerschutzes und der Risikostreuung dem Privatanleger zugänglich gemacht worden. Warum? - Weil bis zum Jahre 2004 eine große Flut unregulierter Finanzmarktprodukte aus Europa - wir sind ja keine Insel - zu uns herüberschwappte. Daraufhin haben wir im Interesse des Schutzes der Verbraucher gesagt: Ja, wir bieten deutsche Hedgefonds an, aber in diese müssen die eben von mir skizzierten Sicherheitsböden eingezogen sein. Ich meine heute noch, dass das richtig war und richtig ist.
Lassen Sie mich daher eine Schlussbemerkung machen. Wir stecken in einer Finanzmarktkrise, die unser Land verunsichert. Mit diesem Maßnahmenpaket, meine Damen und Herren, haben wir die Chance, zukünftig den Menschen in diesem Land das Vertrauen in die Stabilität des Finanzmarktes zurückzugeben und zu dokumentieren: Politik ist handlungsfähig, Politik ist handlungsstark, und Politik übernimmt Verantwortung, und zwar nicht im Interesse der Banken und der Manager, sondern im Interesse der Menschen in diesem Land.
Von daher bedanke ich mich herzlichst bei all denjenigen gerade im Bundesfinanzministerium, die praktisch rund um die Uhr - man kann fast schon ?schlaflos? sagen - dafür gesorgt haben, dass wir heute binnen kürzester Zeit diesen Bearbeitungsstand erreicht haben. Ich bitte um eine möglichst breite Unterstützung in diesem Hause für eine gute Zukunft in unserem Land.
Ich danke Ihnen.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Ich schließe die Aussprache.
Wir kommen nun zur Abstimmung über den von den Fraktionen der CDU/CSU und der SPD eingebrachten Gesetzentwurf zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes.
Der Haushaltsausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 16/10651, den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf der Drucksache 16/10600 in der Ausschussfassung anzunehmen.
Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf der Drucksache 16/10661 vor, über den wir zuerst abstimmen. Auf Verlangen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stimmen wir über diesen Änderungsantrag nun namentlich ab, bevor anschließend die Abstimmung über den eingebrachten Gesetzentwurf in der veränderten Ausschussfassung stattfindet.
Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen und mir ein Zeichen zu geben, wenn alle Abstimmungsurnen besetzt sind. - Ich sehe, das ist der Fall. Dann eröffne ich die Abstimmung.
Darf ich fragen, ob es anwesende Kolleginnen oder Kollegen gibt, die ihre Stimmkarte noch nicht abgegeben haben? - Das ist offenkundig nicht der Fall. Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen.
Ich mache darauf aufmerksam, dass wir die Sitzung bis zum Vorliegen des Ergebnisses dieser Abstimmung über den Änderungsantrag unterbrechen müssen, weil dies die Voraussetzung für die Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf ist.
Ich unterbreche die Sitzung bis zum Vorliegen des Auszählungsergebnisses.
Dr. Norbert Lammert (CDU/CSU):
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet.
Die Geschwindigkeit bei der Auszählung entspricht der ganz besonderen Schnelligkeit des Beratungsprozesses dieser Woche, wofür ich mich bei den Stimmzählerinnen und Stimmzählern auch ausdrücklich bedanken möchte.
Ich gebe das von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt: Abgegebene Stimmen 574. Mit Ja haben gestimmt 51, mit Nein haben gestimmt 499, und enthalten haben sich 24 Mitglieder des Hauses. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt.
Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. - Wer stimmt dagegen? - Wer enthält sich? - Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung mit großer Mehrheit angenommen.
Bevor wir zur
und Schlussabstimmung kommen, weise ich darauf hin, dass mir zahlreiche Erklärungen nach § 31 unserer Geschäftsordnung zum jeweiligen Abstimmungsverhalten zu dem Entwurf des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes vorliegen, und zwar von Kolleginnen und Kollegen aus allen Fraktionen des Hauses. Diese Erklärungen werden wie üblich dem Protokoll beigefügt.
Wir stimmen nun über den Gesetzentwurf auf Verlangen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD namentlich ab. Auch hier bitte ich, mir ein Signal zu geben, ob die Schriftführerinnen und Schriftführer die vorgesehenen Plätze wieder oder immer noch eingenommen haben. -
Das scheint der Fall zu sein. Dann eröffne ich die Abstimmung.
Gibt es anwesende Kolleginnen und Kollegen, die ihre Stimmkarte für die Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf noch nicht abgegeben haben? - Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Wir geben das Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt, sobald es vorliegt. Nach dem schönen Beispiel von eben wird das nicht allzu lange dauern.
Wir fahren in der Zwischenzeit mit der Abstimmung über die Entschließungsanträge fort. Wir kommen zuerst zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der FDP auf Drucksache 16/10660. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? - Wer stimmt dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? - Damit ist der Entschließungsantrag mit großer Mehrheit im Hause abgelehnt.
Wer stimmt für den Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 16/10652? - Wer stimmt dagegen? - Wer enthält sich? - Auch dieser Entschließungsantrag ist mit einer ähnlich großen Mehrheit abgelehnt.
Wer stimmt für den Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 16/10662? - Wer stimmt dagegen? - Wer enthält sich? - Auch dieser Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der übrigen Fraktionen bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion abgelehnt.
Ich unterbreche für einen Augenblick die Sitzung, bis uns das Ergebnis der Auszählung vorliegt,
weil es sicher der Bedeutung dieses Gesetzgebungsvorhabens entspricht, das Ergebnis nicht in der laufenden Beratung eines weiteren Tagesordnungspunktes zu Protokoll zu geben.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet.
Ich kann Ihnen das von den Schriftführern und Schriftführerinnen ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes mitteilen. Es handelt sich um die Drucksachen 16/10600 und 16/10651. Abgegebene Stimmen 576. Mit Ja haben 476 gestimmt, mit Nein haben 99 gestimmt, enthalten hat sich 1 Kollege. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen.
Ich möchte zum Abschluss dieses Gesetzgebungsvorhabens zwei Anmerkungen machen, zumal es innerhalb und außerhalb des Hauses manche verständliche Besorgnis zu diesem in jeder Beziehung außergewöhnlichen Vorhaben gegeben hat.
Erstens. Das Gesetzgebungsverfahren ist aus den bekannten Gründen zwar eindeutig schneller und kürzer gewesen als üblich, aber es ist keineswegs weniger gründlich und intensiv gewesen.
Ich will deswegen ausdrücklich den Hinweis der Kolleginnen und Kollegen in den unmittelbar beteiligten Ausschüssen auch hier zu Protokoll geben, dass man sich mit diesem Gesetzesvorhaben aus den bekannten Gründen besonders sorgfältig auseinandergesetzt hat - bis weit in den frühen Morgen des heutigen Tages hinein.
Ich will eine Bemerkung zur Sache hinzufügen, weil sie den Bogen von der Beratung am Mittwochmorgen zu der am Freitagmittag herstellt. Am Ende hat der Deutsche Bundestag ein Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen, bei dem sich nicht das Maßnahmenpaket verändert hat. Der Handlungsrahmen und die dazu vorgesehenen Maßnahmen sind am Ende im Kern so geblieben, wie zu Beginn vorgeschlagen. Verändert hat sich das Mitwirkungsrecht des Parlaments.
Wir haben im Verfahren der Beratung dieses Gesetzentwurfs sichergestellt, was wir zu Beginn angekündigt haben, nämlich dass der Deutsche Bundestag zu jedem Zeitpunkt in der Lage bleibt, über die Implementierung und die Abwicklung der beschlossenen Maßnahmen Informationen zu erhalten und diese Maßnahmen, wann immer ihm das notwendig erscheint, in der geeigneten Weise zu flankieren.
Ich glaube, das muss festgehalten werden, um die Ernsthaftigkeit nicht nur des Anliegens, sondern auch des Verfahrens noch einmal ausdrücklich zu bestätigen.
Ich bedanke mich bei allen, die dieses Ergebnis möglich gemacht haben und die vor allen Dingen mit einem zum Teil bemerkenswerten, wiederum außergewöhnlichen persönlichen Engagement dazu beigetragen haben, dass das tatsächlich bis heute Mittag zum Abschluss gebracht werden kann, sodass nun diese vom Deutschen Bundestag jetzt beschlossene Gesetzgebung unverzüglich dem Bundesrat zugeleitet werden kann, in der Erwartung, dass wir heute Mittag zum Abschluss in beiden Verfassungsorganen kommen. Herzlichen Dank!
Ich rufe nun unsere Tagesordnungspunkte 35 a und 35 b auf:
a) Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-OrgWG)
- Drucksachen 16/9559, 16/10070 -
Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Gesundheit (14. Ausschuss)
- Drucksache 16/10609 -
Berichterstattung:
Abgeordnete Jens Spahn
Dr. Carola Reimann
Daniel Bahr (Münster)
Frank Spieth
Birgitt Bender
b) Unterrichtung durch die Bundesregierung
Unterrichtung des Deutschen Bundestages über den beabsichtigten Erlass nachfolgender Verordnung gemäß § 241 Abs. 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch:
Verordnung zur Festlegung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Beitragssatzverordnung - GKV-BSV)
- Drucksache 16/10474 -
Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, über den wir später wiederum namentlich abstimmen werden, liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion der FDP vor.
Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache eineinviertel Stunden vorgesehen. - Dazu höre ich keinen Widerspruch. Dann können wir so verfahren.
Ich eröffne die Debatte und erteile das Wort zunächst der Bundesministerin Ulla Schmidt.
Ulla Schmidt, Bundesministerin für Gesundheit:
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Angesichts der schwierigen Debatten, die wir auch heute Morgen geführt haben, bin ich einer Tatsache wegen sehr froh: Wir haben in all den Jahren und bei all den Reformen daran festgehalten, dass die sozialen Sicherungssysteme nicht - obwohl uns auch viele Ökonomen genau das raten wollten - auf Kapitaldeckung umgestellt wurden. Vielmehr sind wir dabei geblieben, dass Menschen für Menschen einstehen und dass damit auch die Sicherheit der Finanzierung gewährleistet ist.
Auch mit den Reformen, die im kommenden Jahr umgesetzt werden, halten wir an diesem Grundsatz fest.
Es bleibt dabei: Ab 1. Januar 2009 wird unser Gesundheitssystem ein großes Stück übersichtlicher. Mit dem heute vorliegenden Gesetzentwurf vollziehen wir die letzten - eher technischen - Schritte zu einer neuen Finanzierung der Krankenkassen über den Gesundheitsfonds. Entgegen aller immer wieder vorgetragenen Kritik, die sehr offensichtlich interessengeleitet ist, bleibe ich dabei: Der Gesundheitsfonds macht das System einfacher, gerechter und fairer.
Dieser Fonds bedeutet keinen Aufwand, und er ist kein Bürokratiemonster. Das zeigt sich, wenn man ihn einmal mit der bisherigen Situation vergleicht. Heute erheben 208 Krankenkassen 39 verschiedene paritätische Beitragssätze in einer Spanne von 11,3 Prozent bis 16,5 Prozent. Künftig gibt es einen einheitlichen Beitragssatz von 14,6 Prozent, der um einen Beitragssatz von 0,9 Prozent ergänzt wird, den die Versicherten weiter allein tragen. Wenn alle den gleichen Anspruch auf Leistungen haben, dann ist es nur gerecht und fair, dass auch alle den gleichen Prozentsatz ihres Einkommens für die Finanzierung dieser Leistungen aufbringen.
21 Frauen und Männer im Bundesversicherungsamt organisieren diesen Ausgleich.
Es wird viel darüber geredet, ob der geplante Beitragssatz für 2009 ausreicht. Er beruht auf soliden Berechnungen und ist so bemessen, dass er die Ausgaben, die im kommenden Jahr erwartet werden, zu 100 Prozent durch Einnahmen abdeckt. Entgegen falschen Behauptungen, die auch gestern wieder von interessierter Seite verbreitet wurden,
halte ich daran fest: Die Einnahmen für 2009 sind einvernehmlich geschätzt worden - mit den Krankenkassen und nicht gegen sie.
Die Schätzer sind auch nicht, wie behauptet wird, von einem Wachstum von 1,2 Prozent ausgegangen, sondern sie sind sehr vorsichtig vorgegangen und haben ihre Berechnungen unter Zugrundelegung der zu erwartenden Wirtschaftsdaten angestellt. Wir sind schon bei den Vorlagen für das kommende Jahr davon ausgegangen, dass das Wachstum nahe bei null liegen wird. Auch ein leichter Rückgang der Beschäftigung ist eingerechnet worden.
Sollte es in der Wirtschaft zu Einbrüchen kommen, so würde sich dies in der gesetzlichen Krankenversicherung - dort sind ja 16,5 Millionen Rentnerinnen und Rentner versichert -,erst später zeigen. Aber selbst wenn es im laufenden Jahr dazu käme, würden nicht die Krankenkassen das Risiko tragen; damit werden die Menschen ja jetzt fälschlicherweise in Panik versetzt. Das Risiko trägt im laufenden Jahr der Gesundheitsfonds. Es gibt keinen Grund, anzunehmen, dass im kommenden Jahr flächendeckend Zusatzbeiträge fällig werden, weil die Einnahmeseite nicht mehr stimmt. Gerade in dieser Krise gilt: Die deutschen gesetzlichen Krankenkassen hatten noch nie eine so stabile und eine so sichere Zusage ihrer Einnahmen wie mit der Einführung des Fonds. Man müsste den Fonds mit seinen Finanzierungsströmen geradezu erfinden, wenn das nicht schon geschehen wäre,
um das alles auf eine sichere Basis zu stellen. So sieht das aus!
Pünktlich zum 15. November dieses Jahres erhält jede einzelne Krankenkasse die auf den Cent genaue Angabe, wie viel Geld sie im kommenden Jahr Monat für Monat erhalten wird. Die Krankenkassen können planen,
weil sie ihren Haushalt kennen, weil sie wissen, wie viel Mittel ihnen zur Verfügung stehen.
Sollte es zu Einnahmeschwankungen kommen, werden sie im laufenden Jahr durch den Fonds ausgeglichen. Wir bauen eine Liquiditätsreserve auf. Der Staat steht dafür gerade,
wenn es unterjährig zu Einnahmeausfällen kommt und die Liquiditätsreserve noch nicht aufgebaut ist. Wir kennen das im Übrigen von der gesetzlichen Rentenversicherung, Frau Bender. Wenn es dort unterjährige Schwankungen gäbe, würde auch dort kurzfristig mit Steuermitteln ausgeholfen, und im Laufe des Jahres würde das Ganze wieder ausgeglichen.
Die gesetzlichen Krankenkassen erhalten von uns die Grundlage dafür, dass sie mit diesem Beitragssatz eine optimale Versorgung der Versicherten organisieren können. Wir erwarten von ihnen, dass sie dies mit einer hohen Qualität tun. Ich würde mir wünschen, dass das ganze Engagement, das derzeit in Debatten darüber investiert wird, ob der Fonds kommen soll oder nicht, einem anderen Punkt gewidmet würde. Ich würde mir wünschen, dass sich die Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen nur einen Tag, nur ein einziges Mal über die Frage unterhalten würden: Wie können wir mit den über 10 Milliarden Euro mehr im nächsten Jahr eine optimale Versorgung organisieren? Was können wir mit den Instrumenten tun, die uns der Gesetzgeber an die Hand gegeben hat - Rabattverträge, Preisverhandlungen, besondere Versorgungsverträge, Verträge zur besonderen Qualität, bessere Versorgung der chronisch Kranken -, um dieses Geld, wie es die Versicherten erwarten können, so gut und effizient wie möglich einzusetzen? Dafür werden die bezahlt und nicht dafür, den ganzen Tag nur rumzujammern. Dafür bekommen die Vertreter der Krankenkassen zu viel Geld.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann ja verstehen, dass die Krankenkassen aus ihrem Individualinteresse heraus möglichst viel Geld haben wollen. Aber die Bundesregierung ist nicht für das Individualinteresse zuständig. Die Bundesregierung ist dafür zuständig, dass dem Gemeinwohlinteresse Rechnung getragen wird. Deshalb werden wir dafür sorgen, dass das, was an notwendigen Ausgaben im kommenden Jahr getätigt wird, finanziert ist. Aber wir werden auch dafür sorgen, dass die Beitragszahler und Beitragszahlerinnen, die hart arbeiten müssen, nicht über Gebühr belastet werden. Deshalb werden wir die Beitragssätze auch genau kalkulieren. Wir gehen nicht den Weg, dass Beitragsgelder erst einmal auf die hohe Kante gelegt werden, damit man davon in späteren Jahren nehmen kann, sondern wir wollen, dass die Kassen mit dem, was wir ihnen geben, vernünftig arbeiten, und das können sie.
Es ist richtig: Im kommenden Jahr steigen die Beiträge. Aber das hat nichts mit dem Fonds zu tun, wie es immer falsch diskutiert wird. Der Fonds verursacht keine Kosten. Wenn die Beitragssätze steigen, dann hat das etwas damit zu tun, dass wir politisch, durch Verabschiedung entsprechender Gesetze, entschieden haben, dass es eine neue Honorarordnung für die Ärztinnen und Ärzte gibt, eine Euro-Cent-Gebührenordnung, bei der das Risiko einer Zunahme von Erkrankungen auf die Versicherten übergeht und nicht bei den Ärzten bleibt, wie es derzeit der Fall ist. Es hat damit zu tun, dass die Krankenhäuser so ausgestattet sein sollen - auch im Hinblick auf die Finanzierung von Pflegekräften -, dass sie eine gute Versorgung organisieren können. Es hat damit zu tun, dass wir diese Schritte gehen müssen, damit es auch in Zukunft noch Frauen und Männer gibt, die den schwierigen Beruf des Mediziners oder einen Beruf in der Pflege oder einen anderen medizinischen Beruf ergreifen; damit tun wir etwas für den beruflichen Nachwuchs.
Es hat etwas damit zu tun, dass wir die Leistungen der solidarisch finanzierten Krankenversicherung ausgebaut haben; denn wir halten es für richtig, Rechtsansprüche auf Rehabilitation für ältere Menschen, egal, wie alt sie sind, zu schaffen, die Palliativversorgung auszubauen, die Hospizversorgung zu unterstützen sowie Impfungen, Mutter- bzw. Vater-Kind-Kuren und vieles andere mehr zu unterstützen.
Die Beiträge steigen auch deswegen, weil es mehr ältere Menschen gibt, weil immer mehr Menschen 100 Jahre und älter werden und weil das Krankheitsrisiko im Alter natürlich größer ist als in jungen Jahren. Wir wollen trotz dieser Herausforderungen an einem festhalten, nämlich dass jeder in unserem Land an den Innovationen und an den Fortschritten in der Medizin teilhat. Wir brauchen Geld, weil wir diese Grundlage der gesundheitlichen Versorgung für die Menschen auch in Zukunft sicherstellen wollen.
In diesem Zusammenhang ist der Fonds nichts anderes als ein Instrument, um das Geld der Versicherten fairer und gerechter als bisher zu verteilen. Wir wollen nicht, dass Kassen nur deswegen in Schwierigkeiten geraten, weil sie besonders viele ältere, besonders viele kranke Versicherte oder Menschen mit geringem Einkommen zu versorgen haben. Würden wir die Mittel im Rahmen des Fonds nicht neu verteilen, würde die Kluft zwischen den Beitragssätzen immer größer, und letztendlich hätten diejenigen die höchsten Beitragssätze zu zahlen, die bei einer Kasse versichert sind, in der es fast nur Kranke, Ältere oder Versicherte mit geringem Einkommen gibt. Das kann niemand wollen, der eine gute, finanzierte Gesundheitsversorgung in diesem Land will. Genau deswegen werden in Zukunft über die Neuorganisation der Finanzströme die Krankenkassen, die viele kranke und ältere Menschen versichern, mehr Geld erhalten als diejenigen, bei denen junge und gesunde Frauen und Männer versichert sind. Das ist gerecht so.
Der Gesetzgeber hat den Kassen ein gutes Instrument an die Hand gegeben, damit sie die Versorgung organisieren können. Einige Kassen haben mitgeteilt, dass sie mit den Mitteln auskommen werden, andere Kassen werden sogar Prämien zurückzahlen können, und manche Kassen sagen, sie werden vielleicht einen Zusatzbeitrag erheben müssen. Aber auch da haben wir die Versicherten geschützt: Eine Kasse darf nicht mehr als 1 Prozent des Bruttoeinkommens als Zusatzbeitrag erheben.
Ganz kurz noch einige Bemerkungen zu dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Es ist dringend notwendig, dass das, was auf Bundesebene schon galt, auch auf Länderebene und damit für alle Kassen gilt, nämlich dass sie insolvenzfähig sind. Dann werden alle Kassen nach einheitlichen Gesichtspunkten ihre Bücher führen müssen. Darüber hinaus verpflichten wir die Kassen, für die Versorgungszusagen ein ausreichendes Deckungskapital in einem Zeitraum von längstens 40 Jahren aufzubauen. Damit werden die bisher ungedeckten Verpflichtungen transparent gemacht. Dadurch, dass wir den Kassen Zeit einräumen, wird keine einzelne Kasse überfordert. Das sind Investitionen in die Zukunft; denn auch unsere Kinder und Kindeskinder sollen im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung versorgt werden. Das wollen wir damit erreichen.
Für uns bleibt es dabei: Die Insolvenz einer Kasse ist die Ultima Ratio. Wir haben viele Regelungen zur Verbesserung der Aufsicht und zum Vorrang von Fusionen oder Schließungen geschaffen, um dies sicherzustellen.
Der heute vorliegende Gesetzentwurf ist ein weiterer Schritt hin zu mehr Transparenz, zu mehr Offenlegung. Ich würde mir wünschen, dass wir unsere Diskussionen öfter in dem Sinne führen, was eigentlich gemeinsam zu tun ist, um den schwierigen Herausforderungen durch immer mehr ältere Menschen - worüber wir uns natürlich freuen -, aber auch durch die größeren Möglichkeiten aufgrund des medizinischen Fortschritts zu begegnen und das, was für uns selbstverständlich war, so weit wie möglich in die Zukunft zu übernehmen, damit auch unsere Kinder und Enkelkinder zu einem Arzt gehen können, gepflegt werden können und eine dem medizinischen Fortschritt entsprechende Versorgung erhalten, und zwar unabhängig von ihrem Geldbeutel. Unsere Reformen sind ein entscheidender Schritt auf diesem Weg.
Vielen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält nun der Kollege Daniel Bahr, FDP-Fraktion.
Daniel Bahr (Münster) (FDP):
Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Frau Schmidt hat zum Ende ihrer Rede auf eines der drängendsten Probleme im Gesundheitswesen hingewiesen: die steigenden Kosten durch eine alternde Bevölkerung. Zu Beginn Ihrer Rede, Frau Schmidt, haben Sie aber einen Zusammenhang zwischen der Finanzmarktkrise und der Frage, ob wir zur Finanzierung der steigenden Kosten durch eine alternde Bevölkerung mehr Kapitaldeckung brauchen, hergestellt. Sie haben gesagt, durch die Finanzmarktkrise zeige sich, wie überlegen das Umlagesystem der gesetzlichen Krankenversicherung sei. Konsequenterweise müssten Sie dann auch die Riester-Rente infrage stellen; denn auch das ist eine kapitalgedeckte Vorsorge für steigende Kosten im Alter.
Das ist der Unterschied zwischen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung: In der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es keine Rücklagen, bei denen man darüber diskutieren könnte, ob die Renditen für diese Rücklagen geringer werden. Die gesetzliche Krankenversicherung lebt von der Hand in den Mund. Von den laufenden Beiträgen werden die laufenden Ausgaben beglichen. Bei der privaten Krankenversicherung wird das Prinzip der Eigenvorsorge gestärkt,
indem Rücklagen für die steigenden Kosten im Alter gebildet werden. Sie verhalten sich wie jemand, der die ganze Zeit über seine Verhältnisse gelebt hat und jetzt über den lacht, der sein Geld sorgsam beiseite gelegt hat und nun, wenn er auf dieses Geld angewiesen ist, möglicherweise etwas weniger Rendite hat. Ihre Argumentation ist völlig unseriös.
Dann sind Sie, Frau Schmidt, auf einen Brief eingegangen, den wir Abgeordnete des Deutschen Bundestages gestern erhalten haben. Ein breites Bündnis von Gesundheitsökonomen, Experten aus dem Gesundheitswesen und ehemaligen Politikern hat uns darin aufgefordert, ja geradezu an uns appelliert, den Gesundheitsfonds zu verschieben. Sie antworten darauf mit Detailproblemen. Meinen Sie, dass es einem Herrn Blüm, einer Frau Süssmuth, einem Herrn Dressler oder einer Frau Schaich-Walch, alles Persönlichkeiten, die Sozialgeschichte geschrieben haben, die viele Entscheidungen in der Gesundheits- und Sozialpolitik geprägt haben, darum geht, ob bei der Wachstumsprognose von 1,2 oder 0,2 Prozent ausgegangen wurde? Denen geht es um die Weichenstellung, die Sie mit dem Gesundheitsfonds vornehmen, um eine grundlegende Weichenstellung in die falsche Richtung.
Darum geht es in dem Appell, und deshalb sollten Sie ihn sich meiner Meinung nach zu Herzen nehmen. Wir alle im Deutschen Bundestag hoffen in Bezug auf die Finanzmarktkrise, über die vorhin debattiert wurde, dass es im nächsten Jahr nicht zu einer nachhaltigen Stagnation oder sogar zu einer Rezession kommt. Niemand kann aber bestreiten, dass Gefahren für das nächste Jahr bestehen. Angesichts dieser großen Verunsicherung für die Bevölkerung und für die im Gesundheitswesen Tätigen brauchen wir keine weiteren Unsicherheiten. Der Gesundheitsfonds ist eine weitere Unsicherheit - genauso wie die gesamte Gesundheitsreform. Sie verändern parallel die Ärztevergütung, die Krankenhausfinanzierung, den Risikostrukturausgleich und das Insolvenzrecht. Niemand in diesem Hause und niemand außerhalb dieses Hauses kann abschätzen, wie sich das im nächsten Jahr auf das Gesundheitswesen auswirkt.
Frau Schmidt, deshalb dürfen wir mit dem Gesundheitsfonds keine weitere Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger hervorrufen. Sie haben recht, wenn Sie sagen, das Einnahmerisiko liege nicht mehr bei den Krankenkassen. Das Einnahmerisiko liegt dann aber beim Bundeshaushalt; denn dieser muss das Defizit ausgleichen, wenn die Einnahmen nicht so hoch ausfallen, wie sie geschätzt worden sind. Der Schätzerkreis hat sich in den vergangenen Jahren - zum Beispiel in den Jahren 2003 und 2006 - auch verschätzt. Dies war ein Defizit von jeweils bis zu 3,5 Milliarden Euro. Dieses Defizit wäre dann mit Mitteln aus dem Bundeshaushalt auszugleichen. Damit belasten Sie den Bundeshaushalt in einer Zeit, in der der Bundeshaushalt schon die ganzen Risiken und Probleme einer Finanzmarktkrise zu schultern hat.
Als ob das eine Stabilität der Finanzierung des Gesundheitswesens bewirkt! Dann haben wir nämlich den Streit darüber, ob vielleicht doch die Mittel für das Gesundheitswesen gekürzt werden sollen.
Hinzu kommt das Ausgabenrisiko, das die Krankenkassen zu tragen haben. Herr Kollege Lauterbach, dem ich nicht häufig zustimme, hat vollkommen zu Recht heute gegenüber einer Zeitung gesagt: Bei steigender Arbeitslosigkeit ist mit steigenden Gesundheitsausgaben zu rechnen.
Das heißt, wenn wir in Deutschland im nächsten Jahr eine Verunsicherung hinsichtlich der Wirtschaftslage haben, dann haben wir damit auch eine Verunsicherung bezüglich der Gesundheitsversorgung in Deutschland und somit eine Belastung für die Krankenkassen. Diese steigenden Kosten können die Krankenkassen dann nicht mehr wie jetzt so kurzfristig durch Beitragssatzanpassungen ausgleichen. Wenn man einen Zusatzbeitrag verlangt, dauert es bis zu drei Monate, bis man das Geld hat; denn es müssen neue Konten eingerichtet werden, die Versicherten müssen angeschrieben und um die Angabe der Kontonummer gebeten werden, man braucht eine Einzugsermächtigung, und es müssen Mahnverfahren einkalkuliert werden.
Das alles bedeutet zusätzliche Bürokratie. Die Krankenkassen haben uns in der Anhörung gesagt, dass bei einem Zusatzbeitrag von 10,00 Euro damit zu rechnen ist, dass 2,50 Euro für zusätzliche Bürokratie verwendet werden.
- Ja, jeden Monat. Wir brauchen aber keine zusätzliche Bürokratie, sondern wir brauchen das Geld für die Versorgung. Deshalb wäre es besser, wenn Sie auf den Gesundheitsfonds verzichten würden.
Das alles, was Sie machen, Frau Schmidt, verunsichert weiter das Gesundheitswesen. Die Kassen reagieren bereits im Vorfeld des Gesundheitsfonds darauf und kündigen Verträge. Es hat doch Folgen für die Versorgung, wenn Versorgungsverträge gekündigt werden. Das spüren die Patienten.
Was Sie hier mit der Gesundheitsreform und mit dem uns vorliegenden Korrekturgesetz machen, ist nichts anderes als ein schwarz-roter Feldversuch mit ungewissem Ausgang. Der Gesundheitsfonds ist ein gesundheitspolitisches Experiment auf dem Rücken von Versicherten und Patienten. Es wäre das Beste, Sie verzichten einfach auf den Gesundheitsfonds. Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten, denen wir im nächsten Jahr ausgesetzt sind, wäre das eine verantwortungsvolle Politik, die ich von einer Großen Koalition erwarten würde.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Annette Widman-Mauz von der CDU/CSU-Fraktion ist die nächste Rednerin.
Annette Widmann-Mauz (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Der heutige Tag ist ein wichtiger Tag in der Geschichte des Deutschen Bundestags und seiner Entscheidungen. Er ist von einer Finanzkrise geprägt, wie sie unser Land nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht erlebt hat.
Diese Entwicklungen auf den Finanzmärkten unterstreichen einmal mehr, wie groß die Bedeutung von Transparenz, von Nachhaltigkeit, von Solidität und Verlässlichkeit in unserem Land ist. Auch in der gesetzlichen Krankenversicherung ist deshalb ein klarer ordnungspolitischer Rahmen für die gesetzlichen Krankenkassen und für solide Finanzen notwendiger denn je.
Wir debattieren heute in abschließender Beratung über den Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Außerdem debattieren wir über den künftigen einheitlichen Beitragssatz, den die Bundesregierung vorgeschlagen hat. Wir führen die Insolvenzfähigkeit von Kassen sowie einheitliche Rechnungslegungs- und Buchführungsregeln für alle Krankenkassen ein.
Das ist ein ganz wichtiger Beitrag für dieses System; denn ab dem 1. Januar ist es vorbei mit dem Schuldenmachen der gesetzlichen Krankenkassen. Das ist ein wichtiger Beitrag für die künftigen Generationen.
Dazu haben wir in diesem Gesetz die Vorstände der Kassen genauer in den Blick genommen, denn auch sie tragen Verantwortung, und diese gewinnt zunehmend an Bedeutung. Das reicht bis hin zur persönlichen Haftung. Kassenmanager werden in Zukunft beweisen müssen, dass sie auch noch andere Fähigkeiten besitzen, als Unterschriften unter wenig sachverständige Papiere zu setzen, dass sie noch andere Fähigkeiten besitzen, als schnelle Entscheidungen über Beitragssatzsteigerungen im Hauruckverfahren durchzuführen. In Zukunft können sie zeigen, wie gut sie die Versorgung von Patienten mit qualitativ hochwertiger Medizin und Pflege und einen guten Service für ihre Versicherten und ihre Patientinnen und Patienten organisieren können.
Es geht also nicht mehr nur darum, Beiträge zu verwalten, sondern es geht darum, Versorgung zu gestalten. Darauf wird es bei den Kassen in der neuen Fondswelt ab dem 1. Januar ankommen. Die Krankenkassen erhalten aus dem neuen Fonds im Übrigen kontinuierlich und stetig die dazu notwendigen Mittel, und zwar mehr für Ältere und Kranke als für Junge und Gesunde. Dabei ist es egal, ob die Krankenkassen viele Krebskranke, viele Gutverdiener, viele Familienangehörige, viele Rentner oder viele Arbeitslose versichern. Das sind ganz wichtige Elemente dieses neuen Strukturausgleichs, den der Fonds an dieser Stelle organisiert.
Die Krankenkassen haben - bezogen auf ihre Einnahmen - mehr Sicherheit und mehr Verlässlichkeit als heute, denn wenn es im Laufe eines Jahres zu Schwankungen bei den Beitragseinnahmen kommt - zum Beispiel wenn das Weihnachtsgeld nicht so gezahlt wird, wie man es erwartet hat, oder wenn die Arbeitslosigkeit steigt -, dann trägt nicht mehr die Kasse dieses Risiko, sondern der Gesundheitsfonds. In Zukunft werden unterjährige Einnahmeschwankungen von der Liquiditätsreserve im Fonds und in letzter Konsequenz, wenn diese nicht ausreicht, über den Bundeshaushalt getragen.
Lieber Kollege Bahr, deshalb kann ich das, was Sie heute Morgen wieder von sich gegeben haben, nur als Verunsicherung bezeichnen. Sie verunsichern die Menschen. Sie sind da zwar in Gesellschaft, aber ich muss sagen: Von Sachverständigen im Gesundheitswesen müssen wir auch Sachverstand verlangen können. Daher ist es manchmal besser, das Gesetz und den Gesetzestext intensiv zu studieren, als nur die Postillen von Lobbygruppen zu lesen. Das macht mehr Sinn. Dann müssten manche Briefe, manche Erklärungen und auch manche Reden hier im Parlament nicht geschrieben oder gehalten werden.
Das Einnahmerisiko liegt beim Fonds, und es macht deshalb gar keinen Sinn, eine zu optimistische Schätzung vorzunehmen. Sie wissen es besser. Wir haben im Ausschuss mit dem Präsidenten des Bundesversicherungsamtes darüber gesprochen, dass dies eine solide Kalkulation ist.
Niemand hat etwas davon, wenn er hier zu optimistisch schätzt, denn am Ende ist es nicht zum Nachteil der Kassen, sondern - wenn überhaupt - zum Nachteil des Deutschen Bundestages und der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
Die Prognosen sind also sachgerecht vorgenommen worden. Bei den Einnahmen bestand im Schätzerkreis im Übrigen Einvernehmen, und zwar auch mit den Krankenkassen. Wenn es Differenzen gab, dann gab es diese eher in der Frage der Ausgabenentwicklung. Hierzu muss ich sagen: Da wundere ich mich auch. Ich kenne Papiere aus Krankenkassen, in denen die Ausgabenentwicklung geschätzt wird. Diese waren noch im August absolut identisch mit dem, was am Ende im Schätzerkreis festgelegt wurde. Hier steht also der subjektive Wille des Einzelinteresses manchmal auch stärker im Vordergrund als das, was objektiv erforderlich ist.
Ich kann es verstehen, wenn einzelne Krankenkassen gern etwas großzügiger kalkulieren wollen, wenn sie noch ein Sahnehäubchen auf dem Kuchen wollen. Das würde ihnen besser schmecken, das verstehe ich. Unter Präventionsgesichtspunkten ist dieses Sahnehäubchen aber kontraproduktiv, nämlich nicht gesund. Vor allen Dingen aus der Sicht der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler wäre dies gerade in der jetzigen Situation unverantwortlich.
Der Beitragssatz muss für die gesamte gesetzliche Krankenversicherung das abdecken, was an Leistungen notwendig und erforderlich ist. Er muss nicht mehr und nicht weniger tun. Das ist verantwortbar, und das hat die Bundesregierung in ihrer Beitragssatzfestsetzung auch getan. Im Übrigen ist der Kuchen um 11 Milliarden Euro größer geworden.
Die Kassen behaupten in diesen Tagen, solide Kalkulationen seien überhaupt nicht möglich, weil ihnen die entsprechenden Daten aus dem neuen Risikostrukturausgleich nicht vorliegen würden. Ich kann nur sagen: Der Beitragssatz ist von der Bundesregierung vorgeschlagen, er ist bekannt. Das Klassifikationsmodell für die Berechnung der pauschalen Zuweisungen an die Kassen aus dem Fonds liegt vor. Die Zuweisungsbescheide - dann in Euro und Cent - werden zum 15. November bei jeder einzelnen Krankenkasse vorliegen.
Ich stelle fest: Wenn es um die Berücksichtigung der Morbidität, um die Auswirkungen der Zuweisungen auf die Verwaltungskosten und die Wahrnehmung der Kasseninteressen im Einzelnen geht - insbesondere bei der Diskussion mit den Abgeordneten -, dann ist die Prognoseschärfe der Kassen bei 100 Prozent - man könnte fast meinen, bei 150 Prozent - angelangt. Wenn aber der Faktor derselben Morbidität herangezogen wird, um einen Kassenhaushalt aufzustellen, dann steigt auf einmal wieder Nebel auf, und die Kassenmanager stochern in ihm.
Das ist keine solide Praxis. Deshalb ist das, was wir vorgeschlagen haben, richtig. Jede Kasse kann sich im Moment sehr sorgfältig darauf einstellen.
Ein Wort zur Bürokratie. Hier reden alle, als ob sie in Schottland wären: Keiner hat das Ungeheuer von Loch Ness je gesehen. Die Stelle, das Bundesversicherungsamt, die heute den RSA abwickelt, verwaltet in Zukunft auch den Fonds. Dazu werden genau 7 Personen mehr als heute gebraucht, insgesamt 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Denkt man aber an die 3,5 Millionen Unternehmen in Deutschland - davon 99 Prozent kleine und mittelständische Betriebe -, denkt man daran, wie mühsam in den Personalbüros Krankenversicherungsbeiträge an bis zu 250 Kassen mit bis zu 250 unterschiedlichen Beitragssätzen, also dann auch in unterschiedlichen Euro- und Centbeträgen, abgeführt werden müssen, dann erkennt man das Einsparpotenzial in den Unternehmen. Dies ist ein Beitrag zum Bürokratieabbau. Dies ist ein wichtiger, hunderttausendfacher Beitrag zur Entlastung unserer Wirtschaft.
Sie werden jetzt einwenden - Sie haben dies auch getan -, dass bei den Krankenkassen eine solche Entlastung nicht entstehe und auf sie Zusatzbelastungen zukämen. Dort kann aber nur mehr Aufwand entstehen, wenn überhaupt Zusatzbeiträge erforderlich sind und dafür versichertenbezogene Konten eingerichtet werden müssen. Niemand sagt im Übrigen, dass dafür monatliche Zahlungen erforderlich sind. Ein gewisser Aufwand ist an dieser Stelle - das sage ich ganz bewusst - gewollt; denn dadurch entsteht bei den Kassen der heilsame Druck, zunächst vermeidbare Kosten zu senken, zum Beispiel in der Verwaltung der eigenen Kasse, und nach Einsparpotenzialen und Effizienzreserven zu suchen, bevor wieder der leichte Weg über eine Beitragssatzerhöhung eingeschlagen wird.
Die Versicherten sehen und spüren es gleichermaßen. Beim Versicherten entsteht zum ersten Mal das, was wir Preis-Leistungs-Bewusstsein nennen; denn nur wenn einem höheren Preis ein Mehrwert bei Leistung, Qualität und Service gegenübersteht, lässt sich auf Dauer ein Zusatzbeitrag beim Versicherten durchsetzen. Preisvergleiche werden deshalb nicht nur leichter, sondern insbesondere für Versicherte mit kleinen Einkommen auch lohnender; denn sie können bei einem Kassenwechsel künftig sehr viel mehr Geld sparen als bisher - und nicht nur dann, wenn sie zu Kassen wechseln, die Rückzahlungen vornehmen.
Sie haben ja immer wieder bestritten, dass es zu Rückzahlungen kommen kann und kommen wird. Aber auch das ist kein theoretisches Konstrukt mehr. Vielmehr haben einzelne Kassen wie zum Beispiel die Knappschaft mitgeteilt, dass sie Rückzahlungen bzw. Ausschüttungen an ihre Versicherten erwägen.
Also, herzlich willkommen in der neuen Kassenrealität! Wir haben mit dem heute vorliegenden Gesetzentwurf den Schlussstein zur Einführung eines neuen, transparenten, gerechteren und nachhaltigeren Finanzierungssystems in der gesetzlichen Krankenversicherung gelegt. Wir werden es schaffen. Dieser Fonds wird zum 1. Januar in Kraft treten. Es steht ihm nichts mehr im Wege.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Frau Kollegin!
Annette Widmann-Mauz (CDU/CSU):
Wir tun dies im Interesse der Patientinnen und Patienten; denn für sie ist dieses System da.
Herzlichen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nun erteile ich das Wort dem Kollegen Frank Spieth für die Fraktion Die Linke.
Frank Spieth (DIE LINKE):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Wir haben jetzt sehr viel zum Gesundheitsfonds und sehr wenig zu dem heute vorliegenden Gesetzentwurf gehört. Ich werde versuchen, auf diesen einzugehen. Nachdem jetzt aber im Wesentlichen zum Gesundheitsfonds gesprochen worden ist, ist es fast unmöglich, dazu nicht auch etwas zu sagen.
Deshalb möchte ich schon noch einiges geraderücken.
Der Bund garantiert mit der Rechtsverordnung, dass die gesetzlichen Krankenkassen im nächsten Jahr aus dem Fonds in etwa 167 Milliarden Euro erhalten. Das garantiert der Bund. Insofern ist die Aussage derer, die uns gestern geschrieben haben, falsch.
Sie behaupten, bei einer anderen konjunkturellen Entwicklung würde dieses Defizit zulasten der Versicherten gehen. Das stimmt nicht.
Tatsächlich ist es so, dass der Bund, also die Steuerzahler, dann die fehlenden Mittel einbringen müssen.
Ein Riesenproblem ist allerdings - dieser Vorwurf wurde in der Anhörung am Mittwoch von der Vorsitzenden des Spitzenverbandes Bund und vielen anderen Sachverständigen zum Ausdruck gebracht -, dass Ihre Annahme, mit den rund 167 Milliarden Euro stünden ausreichend Mittel zur Verfügung, um alle Kosten in der gesetzlichen Krankenversicherung abzudecken, schlicht und ergreifend falsch ist. Heute ist nämlich schon bekannt, dass mindestens 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro mehr in der gesetzlichen Krankenversicherung gebraucht werden, allein aufgrund Ihrer Versprechen, die Sie in den letzten Monaten gegenüber verschiedenen Leistungserbringern gemacht haben. Ich erinnere nur an die ärztliche Honorierung.
- Das ist eben nicht alles drin.
Das wissen Sie auch ganz genau.
Das Problem ist: Wenn die über diese Zusagen hinausgehenden Finanzbedarfe der Krankenkassen nicht gedeckt werden können, wird das passieren, was in dem Gesetz angelegt ist, dann werden wir alle, die wir gesetzlich krankenversichert sind, mit weiteren Zusatzbeiträgen belastet, und zwar ohne Beteiligung des Arbeitgebers. Wir zahlen schon heute 65 Prozent der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn man alle Zuzahlungen und Beteiligungen hineinrechnet,
inklusive des Sonderbeitrages in Höhe von 0,9 Prozent für Krankengeld und die Zahnersatzversorgung. Der Zusatzbeitrag kommt dann noch oben drauf. Das heißt, wir verabschieden uns mehr und mehr aus der paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Das neoliberale Modell nimmt seinen Lauf: Am Ende werden die Kosten für die Krankenversicherung allein den Versicherten aufgelastet. Das ist eine soziale Ungerechtigkeit. Das können wir nicht mitmachen.
Das wird die entscheidende Auseinandersetzung in den kommenden Wochen und Monaten sein. Insofern haben die, die uns gestern geschrieben haben, sehr wohl recht, wenn sie sagen: Es ist damit zu rechnen, dass die Mittel, die insgesamt garantiert werden, nicht ausreichen, was schon im nächsten Jahr dazu führen wird, dass viele Kassen Zusatzbeiträge von ihren Versicherten erheben müssen. Dieses Risiko haben Sie nicht ausgeschlossen, sondern ausdrücklich gewollt. Das ist im Gesetz verankert.
Bei der Auseinandersetzung über das heute zu behandelnde Gesetz, das sich GKV-Organisationsweiterentwicklungsgesetz nennt, befinden wir uns in manchen Punkten - so empfinde ich das jedenfalls - auf einer gesundheitspolitischen Geisterfahrt. Ich will das an einem einzigen Punkt festmachen: Wir haben einen Gesetzentwurf erhalten, der 47 Seiten umfasst. Darüber hinaus haben wir Änderungsanträge erhalten, die alles in allem einen dicken Stapel von 180 Seiten ausmachen. Diese Anträge haben im Kern fast nichts mehr mit dem Gesetzentwurf zu tun, sondern befassen sich mit den handwerklichen Fehlern im Wettbewerbsstärkungsgesetz und den verschiedensten Maßnahmen, die jetzt neu eingeführt werden.
- Genau das.
Wir haben also ein Riesenpaket zu bewältigen gehabt. In den Ausschüssen, auch bei den Anhörungen, haben wir uns sehr intensiv damit beschäftigt. Wenn man die Beschlussempfehlung liest, die dem Hohen Haus heute vorgelegt wurde, fasst man sich zum Teil an den Kopf. Die sozialdemokratische Fraktion hat geschrieben, dass sie aus guten Gründen gegen eine Verteilung der pauschalen Verwaltungskosten an die Krankenkassen im Verhältnis 50 : 50 ist. Das steht tatsächlich in dieser Beschlussempfehlung. In Ihrem eigenen Gesetz machen Sie aber genau das, obwohl Sie in der Beschlussempfehlung eine Verwaltungskostenpauschale verlangen, die den Aufwand der Krankenkassen nach Krankheit und Mitgliederzahl im Verhältnis 70 : 30 verteilt. Sie verlangen also in Ihrer Beschlussempfehlung das genaue Gegenteil dessen, was Sie in Ihrem Gesetz machen. Da muss man sich doch an den Kopf packen.
Merken Sie eigentlich noch, was Sie da abziehen? Sie sind doch nicht in der Opposition. Sie sitzen in der Großen Koalition, in dieser Regierung. Das ist eine Geisterfahrt. Ich habe wirklich den Eindruck - ich will hier niemandem zu nahe treten -, dass in diesem Paket so viele Änderungen und so viele offenkundige Missverständnisse - das ist zurückhaltend formuliert - angelegt sind, dass ich behaupte, dass nur noch vielleicht zwei Handvoll Abgeordnete im Hohen Hause in der Lage sind, komplett nachzuvollziehen, was in diesem Riesenmaßnahmepaket tatsächlich alles steht.
Es enthält jetzt eine Regelung, nach der Krankenkassen zukünftig in Insolvenz geschickt werden können. Man fragt sich allen Ernstes: Warum das? Alle Fachleute haben gesagt: Wir haben jetzt im Gesetzgebungsverfahren Schließungsregelungen. Diese Schließungsregelungen würden nach Auffassung aller Sachverständigen voll und ganz ausreichen. Wenn Krankenkassen nicht transparent und nicht wirtschaftlich arbeiten, gibt es eine Möglichkeit, sie zu schließen. Wenn jetzt eine Insolvenzregelung eingeführt wird, fragt man sich doch: Mit welchem Grundgedanken wird dies gemacht? Krankenkassen werden ganz offenkundig wie private Unternehmen am üblichen Markt betrachtet.
Krankenkassen haben keine andere Aufgabe, als die durch das Grundgesetz garantierte gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten.
Wir, der Gesetzgeber, und in Ausführung die Bundesregierung haben die Krankenkassen beauftragt, diese Aufgabe wahrzunehmen, Beiträge dafür einzuziehen und Leistungen bereitzustellen. Wenn sie das nicht ordentlich machen, müssen sie geschlossen werden. Aber sie in Insolvenz zu treiben mit allen Risiken, die in einem solchen Insolvenzverfahren stecken, ist eine Geisterfahrt.
Das ist unverantwortlich. Mehr kann ich dazu eigentlich kaum sagen.
Das haben auch viele Sachverständige gesagt.
Es ist eine Tatsache, dass diese Insolvenzregelung so überflüssig wie ein Kropf ist. Das kann ich hier nur noch einmal verstärkt einbringen.
Bei der gesetzlichen Krankenversicherung geht es nicht um privat handelnde Unternehmen. Deshalb brauchen wir dort auch kein Insolvenzrecht.
Im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahrens wurde jetzt im Vorfeld der Landtagswahl in Bayern noch eine Regelung geschaffen. Den bayerischen Hausärzten wurde versprochen, eine Sonderregelung für die zukünftige Vertragsregelung des Hausärzteverbandes zu schaffen. Vor der bayerischen Landtagswahl habe ich mit Blick auf die CDU/CSU-Fraktion politisch noch ein bestimmtes Verständnis dafür gehabt, dass man hier eine Lex Bayern bildete, um - so ist es dann anschließend geschehen - die Zusage von der bayerischen Ärzteschaft, jedenfalls der Hausärzteschaft, zu bekommen, die Transparente und Plakate gegen die CSU-Landesregierung aus den Praxen zu entfernen. Das haben sie auch gemacht. Sie haben sofort nach diesem Versprechen ihre politische Kampagne gegen die CSU beendet.
Aber diesen Quatsch jetzt nach der Landtagswahl, die Sie sowieso zu Recht verloren haben,
weiterzuführen und eine Verunsicherung ins Land, in die gesamte Ärzteschaft, zu bringen, Risiken hinsichtlich der Notfallversorgung der Patienten, die überhaupt nicht mehr gewährleistet ist, und hinsichtlich des Sicherstellungsauftrags der Ärzteschaft zu schaffen, ist nach meiner Auffassung angesichts massenhaft unterversorgter Regionen in Deutschland mehr als fahrlässig.
Deshalb können wir Ihr Gesetz zur Organisationsweiterentwicklung nicht nur nicht akzeptieren, sondern wir lehnen es aus tiefster Überzeugung ab.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege Spieth, Sie werden bemerkt haben, dass ich Ihnen jetzt die zusätzliche Redezeit gewährt habe, die ich Ihnen gestern ärgerlicherweise vermeintlich verwehrt habe.
Nun ist die nächste Rednerin die Kollegin Birgitt Bender für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.
Birgitt Bender (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Von der Bundesgesundheitsministerin haben wir vorhin gehört: Mit dem Gesundheitsfonds wird alles einfacher, gerechter und fairer.
Nun kommen Sie in die Situation, Frau Ministerin, den Autoren und Autorinnen des offenen Briefes, der hier schon erwähnt wurde - er stammt von Leuten aus der Gesundheitsökonomie, den Kassen, der Ärzteschaft und auch aus der Politik -, vorhalten zu müssen, sie hätten nicht ganz genau verstanden, wie der Fonds funktioniert. Woran liegt das wohl? Vielleicht nicht an der Dummheit derer, die den Brief geschrieben haben, sondern an der Konstruktion des Fonds, die eben nicht einfach ist.
Von fair und gerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Koalition, kann schon deswegen nicht die Rede sein, weil die Kassen durch den Fonds zwischen rigidem Sparzwang auf der einen Seite und dem drohenden Zusatzbeitrag für ihre Versicherten auf der anderen Seite wählen müssen. Der Fonds ist weder fair noch gerecht. Er ist einfach eine Fehlkonstruktion.
Die Kritiker haben oft die Begriffe ?Verstaatlichung? und ?Vereinheitlichung? eingebracht. Die Berechtigung dieser Begriffe zeigt sich jetzt besonders an der Beitragsfestsetzung.
Der Fonds bedeutet, dass den Kassen die Beitragsautonomie genommen wird und es keine unterschiedlichen Beitragssätze mehr gibt.
Diese Beitragsfestsetzung, Herr Kollege Zöller, ist damit politischem Kalkül ausgeliefert. Das sieht man doch in diesen Tagen besonders deutlich; denn die Bundesregierung will den Beitragssatz eben nicht so festlegen, dass damit die Anforderungen aus dem Gesundheitswesen berücksichtigt werden, sondern es geht nur um Arithmetik.
Die politische Vorgabe heißt: Im Wahljahr darf der Gesamtsozialversicherungsbeitrag nicht steigen.
Denn damit würde das Reformversagen der Regierung zu offensichtlich. Was tut man also? Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag wird um einen halben Prozentpunkt gesenkt: für ein Jahr. Daraus ergibt sich, dass der Gesundheitsversicherungsbeitrag um einen halben Prozentpunkt steigen darf; denn am Ende muss plus/minus Null herauskommen.
Dieses Rechenexempel führt dazu, dass uns ein Kassenbeitrag von 15,5 Prozent präsentiert wird. Aber dass dieser Beitragssatz ausreichen wird, um die Ausgaben der Kassen zu finanzieren, ist bei weitem nicht belegt. Versprochen hatten Sie, dass die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds an die Kassen 2009 ausreichen würden, um die Ausgaben zu decken.
Dieses Versprechen werden Sie brechen.
Wir haben es in der Anhörung am Mittwoch noch einmal deutlich gehört: Die Deckungsquote des Gesundheitsfonds im nächsten Jahr wird nicht bei 100 Prozent, sondern nur bei 98,5 Prozent der Ausgaben liegen.
Diese 1,5 Prozent haben es durchaus in sich. Es geht nämlich um einen Fehlbetrag von 3 Milliarden Euro.
Dass wir inzwischen im Zuge der Finanzmarktkrise immer von zwölfstelligen Beträgen reden, heißt noch lange nicht, dass 3 Milliarden Euro im Gesundheitswesen wenig wären. Das ist viel Geld.
Viele Krankenkassen, vor allem die mit vielen Kranken und deswegen hohen Ausgaben, werden im nächsten Jahr in der Situation sein, dass sie eigentlich Zusatzbeiträge erheben müssten. Ich sage deswegen ?eigentlich?, weil natürlich jeder Kassenvorstand weiß, was passiert, wenn die erste Kasse einen Zusatzbeitrag verlangt. Sie fällt dann im Kassenwettbewerb weit zurück. Weil die Bundesregierung das weiß und daran nicht selber schuld sein will, beschimpft sie schon einmal vorab mögliche betroffene Kassen.
Die Bundesgesundheitsministerin und auch die Bundesfamilienministerin - wahrscheinlich versteht sie besonders viel davon - erklären schon vorab: Zusatzbeiträge werden nur von unwirtschaftlich arbeitenden Kassen erhoben.
Aber zumindest die Gesundheitsministerin sollte es besser wissen. Zusatzbeiträge werden je nach der Mitgliederstruktur einer Krankenkasse erforderlich werden. Viele Kranke, Geringverdienende und beitragsfrei mitversicherte Kinder
sind die Gruppen, die in Ihrer Logik eine Kasse in ihrer Mitgliedschaft möglichst vermeiden sollte, wenn sie ohne Zusatzbeitrag auskommen will.
Im Übrigen führt, Herr Zöller, das Gerede von der Unwirtschaftlichkeit natürlich dazu, dass viele Kassen schon im Vorhinein schlechtgeredet werden. Jede Kasse, die einen Zusatzbeitrag erheben wird, wird sich öffentlich vorhalten lassen müssen, sie verschleudere Versichertengelder. Das kommt auf dem Krankenversicherungsmarkt einem Todesurteil gleich. Also werden die Kassen im nächsten Jahr einen rigiden Sparkurs fahren. Das werden besonders die Patientinnen und Patienten zu spüren bekommen, die eben nicht in dem neuen Finanzausgleich berücksichtigt sind, denn inzwischen gibt es ja zwei Klassen von Kranken. Eine Reihe von Selbsthilfeorganisationen hat darauf schon aufmerksam gemacht. Sie wissen, was auf sie zukommt.
Auch für innovative Versorgungsmodelle, Frau Widmann-Mauz, für die erst einmal eine Anschubfinanzierung benötigt wird, bevor sie sich rechnen, werden die Kassen kein Geld übrig haben.
Trotzdem werden die Kassen auf die Dauer nicht vermeiden können, einen Zusatzbeitrag zu erheben. Spätestens im Jahr 2010 wird alles Sparen nicht mehr helfen. Dann werden die Kassen flächendeckend Zusatzbeiträge verlangen. Das wissen Sie ganz genau, und das wollen Sie auch.
Indem die Ministerin schon jetzt ankündigt, der Beitragssatz werde auch im Jahr nach der Einführung des Gesundheitsfonds 15,5 Prozent betragen, also stabil bleiben,
sagt sie nichts anderes, als dass die Deckungsquote dann nicht mehr bei nur 98,5 Prozent der Ausgaben liegen wird, sondern noch darunter. Sie haben sogar in den Gesetzentwurf geschrieben, dass die Deckungsquote dann nur noch 95 Prozent betragen soll. Insofern ist die Ankündigung, dass der Beitragssatz stabil bleibt, in Wirklichkeit kein Versprechen, sondern eine Drohung.
Angesichts dieser Aussichten ist es nicht verwunderlich, dass die Koalition die Ausweitung des Insolvenzrechts auf alle Kassen auf ihre Agenda gesetzt hat. Grundsätzlich kann man von den Kassen durchaus erwarten, dass sie mit den Beitragseinnahmen vernünftig umgehen. Dafür sind allerdings Anreize notwendig. Dazu gehört auch das Risiko, ökonomisch zu scheitern, immer vorausgesetzt, dass die Ansprüche von Versicherten, Beschäftigten und Leistungserbringern in ausreichendem Maße gesichert sind.
Sie brauchen den heutigen Gesetzentwurf vor allem deshalb, um ein Problem zu lösen, das Sie in dieser Dimension selbst schaffen. Durch die Ablösung des kassenindividuellen Beitragssatzes via Einheitsbeitrag, die Senkung der Deckungsquote des Gesundheitsfonds auf 95 Prozent und einen falsch konstruierten Zusatzbeitrag werden viele Kassen geradezu ausgehungert.
Die Krankenkassen, die viele Geringverdiener und viele beitragsfrei mitversicherte Kinder unter ihren Mitgliedern haben, werden die ersten sein, die dann nicht mehr mithalten können. Der heute vorliegende Gesetzentwurf ist ein Baustein einer falschen Reformstrategie und für uns daher nicht zustimmungsfähig.
Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Die nächste Rednerin ist Dr. Carola Reimann für die SPD-Fraktion.
Dr. Carola Reimann (SPD):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem heute vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung bringen wir weitere Maßnahmen im Rahmen der Gesundheitsreform 2007 auf den Weg und sorgen dafür, dass auch die nächsten Stufen dieser Reform erfolgreich starten können.
Ziel des sogenannten GKV-OrgWG - ein unschöner Name für ein wichtiges Gesetz - ist es, einen fairen Wettbewerb zwischen den Kassen zu gewährleisten. Im Zentrum steht dabei die Herstellung der Insolvenzfähigkeit aller Kassen.
Lieber Kollege Spieth, Sie sind einer der Kollegen, die diese Diskussion mitverfolgt haben und den Inhalt des Gesetzes kennen. Die Insolvenzordnung ist nicht neu;
sie wird jetzt lediglich auf alle Kassen angewendet.
Das ist die neue Regelung dieses Gesetzes.
Ab dem 1. Januar 2010 findet die Insolvenzordnung auf alle Krankenkassen, auch auf die landesunmittelbaren Krankenkassen, Anwendung.
Dann werden für alle Kassen gleiche Bedingungen gelten.
Fairer Wettbewerb zwischen den Kassen ist eines der Hauptziele der Gesundheitsreform und des Gesundheitsfonds. Durch die Verbesserungen des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs und den 100-prozentigen Ausgleich der Einnahmen wird sich der heutige Wettbewerbsvorteil der Krankenkassen, bei denen vorrangig gesunde Gutverdiener versichert sind, merklich reduzieren. Das ist auch richtig so; denn die Krankenkassen sollen ihre Energie vor allem darauf verwenden, ihren Versicherten im Krankheitsfall die bestmögliche Versorgung und Betreuung zu bieten, nicht darauf, in einen schädlichen Wettbewerb um gesunde, gut verdienende Versicherte zu investieren.
Der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich war immer ein Anliegen der SPD. Ich freue mich, dass er zum 1. Januar 2009 Realität wird.
Im Sinne eines fairen Kassenwettbewerbs ist auch die jetzt im Gesetzespaket eingefügte pauschale mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisungen bei Fondsunterdeckung. Dadurch wird klargestellt, dass Kassen mit vielen Kranken im Falle einer Fondsausstattung unter 100 Prozent nicht höher belastet werden. Eine prozentuale Änderung der Zuweisungen hätte zur Folge, dass die positiven Mechanismen des neuen Morbi-RSA konterkariert würden. Eine pauschale versichertenbezogene Zuweisungsveränderung hätte vor allen Dingen negative Auswirkungen auf Kassen mit vielen Familienmitversicherten und Kindern. Das wollen wir nicht. Mit der pauschalen mitgliederbezogenen Veränderung wird jetzt sichergestellt, dass der Wettbewerb zwischen den Kassen auch im Falle einer Fondsunterdeckung fair bleibt.
Der Fonds wird also für eine gerechte Verteilung der Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung sorgen. Doch nicht nur das - das möchte ich betonen -: Er garantiert den gesetzlichen Krankenkassen auch konstante Einnahmen.
Dies sage ich gerade vor dem Hintergrund der Briefe, die uns erreicht haben. Mir war klar, dass für die Fondsgegner sozusagen als allerletzte Munition die Finanzmarktkrise und die konjunkturelle Entwicklung herhalten müssen, um auf den Fonds zu schießen. Das ist allerdings erstens extrem verantwortungslos, weil es Menschen in der nicht gerade einfachen Situation, in der wir uns befinden, völlig unnötig verunsichert.
Zweitens, Herr Kollege von der Opposition, ist es auch ein Eigentor.
Das Gegenteil ist der Fall: Der Fonds wirkt in dieser Situation als Schutz für die Kassen,
weil die 166,8 Milliarden Euro, die im kommenden Jahr über den Fonds verteilt werden,
staatlich garantiert sind. Die Risiken auf der Kassenseite waren noch nie so gering wie mit dem Fonds.
Ich muss noch eine Anmerkung zu der Aussage machen, mit der geplanten Summe könne man die Versorgung nicht organisieren. Es sind 166,8 Milliarden Euro. Politisch sind für den Krankenhausbereich 3,5 Milliarden Euro und für die Ärzte 2,5 Milliarden Euro zugesagt worden.
Das sind nach Adam Riese 6 Milliarden Euro. Das heißt: Wenn es rund 10 Milliarden Euro mehr gibt als in diesem Jahr und wir 6 Milliarden Euro davon zugesagt haben, dann müsste eigentlich genug Luft für weitere Preissteigerungen sein. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass man mit fast 167 Milliarden Euro keine ordentliche Versorgung in diesem Land sicherstellen kann.
Die Fondsgegner, die die Finanzmarktkrise nutzen wollen, um etwas heraufzubeschwören, was nicht da ist, habe ich schon erwähnt. Aber eine konjunkturelle Abkühlung fällt ja nicht vom Himmel; im Übrigen ist sie in diese Beitragssatzkalkulation eingeflossen. Es wurde nämlich unterstellt, dass die bisher immer positive Arbeitsmarktentwicklung im Jahre 2009 stagniert und dass die Beschäftigung bei konstanter Arbeitslosigkeit leicht zurückgeht.
- Nein, das ist die Annahme, mit der kalkuliert wurde.
- Nein, es war keine konservative Annahme, sondern es ist die vorsichtigste Annahme berücksichtigt worden.
Im Übrigen bestand bei allen Kassen und Schätzern Einigkeit darüber.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem vorliegenden GKV-OrgWG haben wir auch im Bereich der Hilfsmittel wichtige Maßnahmen ergriffen. Zu nennen sind Präqualifizierungsverfahren für die Leistungserbringer, aber auch das Ausschreibungsgebot, das wir in eine Kannvorschrift umwandeln. Darüber hinaus haben wir noch einmal präzisiert, welche Hilfsmittel für Ausschreibungen geeignet und welche ungeeignet sind. Bei der Erarbeitung der Empfehlungen werden in Zukunft auch Patientenvertreter mitwirken.
Dass die Kollegen der Linkspartei ausgerechnet diesem Änderungsantrag zur Patientenbeteiligung im Ausschuss nicht zugestimmt haben,
spricht Bände.
In gesundheitspolitischen Debatten wird ja gerne über die Kosten und weniger über die Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems gesprochen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle die Leistungen hervorheben; denn sie sind hierzulande auf qualitativ höchstem Niveau. Schon bei der Gesundheitsreform haben wir den Leistungskatalog erweitert. Ich nenne Rehabilitation, Mutter-Vater-Kind-Kuren und Schutzimpfungen. Nun wird auch die sozialmedizinische Nachsorge für schwerstkranke Kinder und Jugendliche zur Pflichtleistung. Das ist wichtig, weil durch die Nachsorge Leistungen koordiniert und stationäre Aufenthalte verkürzt werden können. Davon profitieren gerade schwerkranke junge Patientinnen und Patienten. Ich finde, auch darüber muss in einer gesundheitspolitischen Debatte gesprochen werden.
Natürlich muss man klar sagen: Das kostet zusätzlich Geld. Ich sage aber auch: Das muss es uns wert sein. Das gilt auch für die noch größeren Summen, die wir für die moderne Spitzenmedizin, für umfangreiche medizinische Innovationen und für die weit über 4 Millionen Beschäftigten im Gesundheitssystem aufwenden. Ich finde, das ist gut investiertes Geld. Das bleibt aber nicht ohne Auswirkungen auf den Beitragssatz - ob mit oder ohne Fonds.
In der derzeitigen politischen Konstellation führt deshalb kein Weg an höheren Beitragssätzen vorbei. Für uns Sozialdemokraten bleiben das Thema Beitragssätze und das Problem einer gerechteren Finanzierung weiter auf der Tagesordnung. Mit der Bürgerversicherung haben wir ein Konzept, das entlastend auf die Beitragssätze wirkt und die Kosten gerechter verteilt.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin, Sie müssen bitte zum Ende kommen.
Dr. Carola Reimann (SPD):
Dafür werden wir uns weiter stark machen.
Vielen Dank.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Für die FDP-Fraktion gebe ich jetzt dem Kollegen Dr. Konrad Schily das Wort.
Dr. Konrad Schily (FDP):
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Um es mit dem Titel eines Romans von Hubert Selby zu sagen: Wir stehen an der ?letzten Ausfahrt Brooklyn?. Heute haben wir noch einmal die Chance, ein meines Erachtens wirklich misslungenes Gesetz zu verhindern.
Ich gestehe ja jedem in diesem Hause zu, dass er das Beste will. Die Grundfrage ist, ob es der richtige Weg ist, dass die Zentralisierung und Vereinheitlichung der gesamten Gestaltung dem Staat obliegt, während die Verantwortung den jeweils Betroffenen vor Ort aufgebürdet wird. Große Einrichtungen und Organisationen sind immer intransparenter als kleine und bewegliche, verehrte Frau Widmann-Mauz; das haben wir vielfach festgestellt. Auch der Fortschritt kann nur über kleine Einrichtungen organisiert werden.
Auf die Frage, wie die bestmögliche Hilfeleistung für die jeweils Betroffenen erreicht werden kann, gibt die Große Koalition mit diesem Vorhaben keine gute Antwort. Sie hat sich von dem Versuch einer föderalen und regionalen Verbesserung der Versorgungs- und Finanzierungsprozesse verabschiedet und stattdessen den wettbewerbsfeindlichen Gesundheitsfonds ins Leben gerufen. Dieser Fonds ist eben doch ein bürokratisches Ungetüm, der nichts besser, aber sehr vieles schlechter machen wird.
Offene Systeme, wie die FDP sie vorschlägt und wie sie auch in unserem Entschließungsantrag noch einmal dargestellt werden, sind für den Fortschritt offen. Für zentralistische Systeme wie den Gesundheitsfonds - ebenso für die Umsetzung des gesamten Gesetzes - sind hingegen große Bürokratien nötig; sie sind nur technokratisch zu steuern. Durch zentralistische Systeme wird dem einzelnen Handelnden die Möglichkeit zur eigenen Gestaltung genommen. Die zunehmend zentralistische Ausrichtung unseres Gesundheitssystems behindert die Therapiefreiheit der Ärzte und die Reaktionsmöglichkeiten der Kassen vor Ort. Sie wird auch keine Hoffnung sein für eine bessere Versorgung im ländlichen Raum.
Dabei wird die Verantwortung den jeweils Betroffenen aufgebürdet, ohne ihnen das Recht auf zielorientiertes Handeln einzuräumen. So werden 70 Millionen Versicherte ab dem 1. Januar 2009 für ein Projekt bezahlen, das jenseits der Regierungsbank - Herr Bahr hat darauf aufmerksam gemacht - nun wirklich niemand will.
Es kann ja sein, dass das Ministerium das will, aber das allein ist nicht die Öffentlichkeit.
Im Gegenteil: Die Gesundheitsreform eint in ihrer Ablehnung ganz unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen. Arbeitnehmervertreter sind genauso dagegen wie Arbeitgeberverbände, Ärzte treffen sich mit Patienten und Krankenkassen zum gemeinsamen Protest.
- Doch, so ist es. - Man verspricht den Patienten ein Rundum-sorglos-Paket. Dieses Rundum-sorglos-Paket wird es nicht geben. Dafür werden - das ist schon angesprochen worden - die bereits jetzt absehbaren und die noch nicht absehbaren wirtschaftlichen Entwicklungen sorgen. Gerade angesichts der ökonomischen und konjunkturellen Unwägbarkeiten der Gegenwart brauchen wir systemische Antworten, die ein großes Maß an Bewegungsfreiheit und Flexibilität gewährleisten.
Die derzeit vorgesehene Regelung der vorausschauenden zentralen Festsetzung der Beitragshöhe beschreitet genau den falschen Weg. Die wirtschaftliche Optimierung der Krankenkassen auf die Frage zu beschränken, ob ein Zusatzbeitrag erhoben wird oder nicht, ist viel zu kurz gegriffen. Zudem setzen die Beitragssatzerhöhungen - auch das ist schon angesprochen worden - um mindestens 0,6 Prozentpunkte in konjunktureller Hinsicht ein falsches Signal.
Schon jetzt ist klar, dass die Gesundheitsreform das grundsätzliche Problem der Finanzierung nicht lösen wird.
Spätestens nach der Bundestagswahl 2009 werden die Fehler der Konstruktion in einer Notoperation ausgebügelt werden müssen. Darüber hinaus muss allen Entscheidungsträgern klar sein, dass die von der Großen Koalition auf den Weg gebrachten Regelungen nur dann Sinn machen, wenn am Ende dieses Weges die Einheitskasse liegt: die Bundes-AOK oder die Bundesknappschaft.
Welche Konsequenzen eine solche Vereinheitlichung hat, kann man am historischen Beispiel des DDR-Gesundheitssystems besichtigen: Mangelverwaltung, Innovationsstau und eine mit der Zeit abnehmende Versorgungsqualität.
Aus diesen Überlegungen kann es nur eine Konsequenz geben: Wir müssen weg vom trägen und innovationsfeindlichen Zentralismus zurück zu einem verbesserten System dezentraler Verantwortlichkeiten,
zur Beibehaltung der Beitragssatzautonomie und zur Anpassungsflexibilität auf der Ebene selbstverwalteter Krankenkassen. Wir müssen hin zu mehr Wettbewerb in einem soliden ordnungspolitischen Rahmen und zu einem verbesserten Handlungsspielraum der Ärzte, in dessen Zentrum der einzelne Patient mit seinen individuellen Bedürfnissen steht.
Wie gesagt, wir stehen an der ?letzten Ausfahrt Brooklyn?. Wir hoffen auf Ihre Einsicht.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Jetzt hat Jens Spahn das Wort für die CDU/CSU-Fraktion.
Jens Spahn (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte eingangs auf den Gesetzentwurf, den wir heute beraten, eingehen. Sie haben vorhin gesagt, Herr Kollege Spieth, dass es eine begrenzte Zahl von Kollegen gebe, die ihn verstehen. Als ich Ihnen anfangs zuhörte, dachte ich, Sie gehörten auch dazu, aber je länger Sie gesprochen haben, desto mehr Sorgen machte ich mir, dass das nicht der Fall ist. Ich werde noch auf die eine oder andere Behauptung eingehen, die Sie wider besseres Wissen aufgestellt haben.
Mit dem Gesetzentwurf wollen wir drei Ziele erreichen. Erstens führen wir für die gesetzlichen Krankenkassen - zwar nicht eins zu eins, aber mit der Wirkung der Transparenz - die Regelungen der Insolvenzordnung ein. Dabei gilt - das betrifft einen der Punkte, die Sie angesprochen haben -: Schließung vor Insolvenz; das ist die klare Reihenfolge. Unser Grundanliegen besteht doch darin - bisher hatte ich den Eindruck, dass es unser gemeinsames Anliegen ist -, dass es endlich zu Transparenz über die Verbindlichkeiten und die wahren finanziellen Zustände der Krankenkassen kommt. Das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, dass sich im Krankenkassensystem Milliarden Euro an Schulden und Verbindlichkeiten aufbauen, die nicht transparent sind und von denen keiner etwas weiß, wird mit diesem Gesetzentwurf abgestellt. Das ist eine gute und wichtige Regelung.
Zweitens entwickeln wir einige Regelungen für den Fonds, der am 1. Januar 2009 in Kraft tritt, weiter. Dazu gehören unter anderem die viel diskutierte Konvergenzregelung und eine Ausgabenorientierung bei der Zuweisung an die Krankenkassen. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf den Brief der vermeintlich vielen Sachverständigen im Gesundheitswesen eingehen, der alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages erreicht hat. Ich sage Ihnen voraus, dass mancher, der diesen Brief unterschrieben hat, dies bereuen wird, und zwar nicht deshalb, weil es sich um eine politische Aussage handelt, sondern weil er sachlich falsche Angaben enthält, die bei einem Blick in den Text des Gesetzentwurfes nicht hätten geschrieben werden dürfen.
Ich kann doch von Professoren im Sachverständigenrat verlangen, dass sie einen Gesetzentwurf lesen, bevor sie solche Briefe unterschreiben. Wir werden darüber sicherlich noch die eine oder andere Diskussion führen müssen.
Der dritte Punkt betrifft die Regelungen, die nicht direkt mit dem Fonds im Zusammenhang stehen. Wir heben die 68er-Grenze für Vertragsärzte und Zahnärzte auf; sie dürfen also über diese Altersgrenze hinaus tätig sein. Wir tun auch etwas für die bessere Versorgung in der Psychotherapie und für die Rechtssicherheit im Vergaberecht. Ich finde, das ist ein gutes Zeichen vonseiten der Politik; denn nach der letzten Gesundheitsreform hat es Probleme und rechtliche Unklarheiten gegeben, wie bei Vergabestreitigkeiten zu verfahren ist. Wir haben aus diesen Problemen gelernt und sorgen nun für Rechtssicherheit und Klarheit in den Verfahren. An der einen oder anderen Stelle hätte man sich sicherlich etwas anderes vorstellen können. Wichtig ist aber, dass es nun Klarheit gibt. An dieser Stelle hätte ich mir das eine oder andere zustimmende und unterstützende Wort von der Opposition gewünscht.
- Herr Kollege, wenn die Regierung und die Koalition etwas richtig machen, können Sie sie ruhig loben. Das wäre nicht so falsch.
Noch zwei, drei Sätze zur Debatte über den Beitragssatz, der zum 1. Januar 2009 festgesetzt wird. Man muss die Debatte vom Kopf auf die Füße stellen. Den Krankenkassen werden ab dem 1. Januar 2009 knapp 11 Milliarden Euro bei einem Gesamtvolumen von 166 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stehen. Diese Gelder sollen vor allem in die Verbesserung der ärztlichen ambulanten Versorgung und Vergütung fließen. Wir haben versprochen, dass die niedergelassenen Ärzte eine sichere, planbare und bessere Vergütung gerade nach den letzten Jahren bekommen. Ich hatte den Eindruck, es sei ein gemeinsames Anliegen, dass die Krankenhäuser eine bessere finanzielle Ausstattung bekommen. Darüber hinaus werden den Krankenkassen ab dem 1. Januar 2009 zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Eines geht jedenfalls nicht - die Opposition macht das wahlweise mit unterschiedlichen Methoden -: Man kann nicht auf Veranstaltungen der Ärzteschaft, der Krankenhäuser und der Apotheker sagen, sie müssten mehr Geld bekommen, und dann hier am Pult die Beitragssatzentwicklung kritisieren. Das geht nun wirklich nicht.
Auch etwas anderes geht nicht, Herr Kollege Spieth: Man darf angesichts von 11 Milliarden Euro zusätzlich im nächsten Jahr nicht Panikmache betreiben, wie Sie es getan haben. Wir sollten bei allen vorhandenen politischen Differenzen die Entwicklungen ehrlich benennen. 11 Milliarden Euro mehr für die Gesundheitsversorgung in Deutschland sind alles andere als das, was Sie gerade beschrieben haben.
Nach der Anhörung vom Mittwoch habe ich noch etwas anderes langsam satt, und zwar das Verhalten der Verantwortlichen der Krankenkassen, insbesondere der Vorstandsvorsitzenden, die fortwährend - auch in dem erwähnten Schreiben - über die Entwicklung jammern. Den Krankenkassen stehen - ich sage es noch einmal - 11 Milliarden Euro mehr im nächsten Jahr zur Verfügung. Anstatt zu jammern, sollten sie darüber nachdenken, wie sie die Instrumente, die wir ihnen an die Hand gegeben haben, nutzen können. Ich nenne als Beispiele nur die Rabattverträge mit der Pharmaindustrie, die Ausschreibungen im Hilfsmittelbereich und - das ist das Allerwichtigste - Verträge für die gute Versorgung insbesondere der chronisch kranken Versicherten. Dabei muss es darum gehen, von der Betrachtungsweise wegzukommen, was ein Patient die Krankenkasse in einem Jahr kostet. Man muss vielmehr sehen, dass ein gut versorgter chronisch Kranker - Diabetes ist dafür ein klassisches Beispiel - am Anfang vielleicht etwas mehr kosten mag, mittel- und langfristig aber mehr Lebensqualität hat und schließlich weniger Kosten verursacht. Das sollten die Krankenkassen berücksichtigen, anstatt jeden Tag aufs Neue die gleiche Leier anzustimmen.
Wir alle müssen den Menschen ehrlich sagen, dass das Gesundheitswesen in Deutschland, in einem Land, in dem die Menschen weniger und älter werden, im Zweifel nicht günstiger, sondern teurer werden wird. Jeder, der in der politischen Diskussion suggeriert, dass die Entwicklung in Deutschland aufgrund irgendwelcher Reformen anders verlaufen könne, macht den Menschen etwas vor, streut ihnen Sand in die Augen. Wir können darüber streiten, wie man es finanziert. Aber wir sollten den Menschen ehrlich sagen, dass es teurer wird, wenn wir allen einen hochwertigen Zugang zum medizinisch Notwendigen auf dem Stand der Technik ermöglichen wollen, und zwar nicht nur in den Großstädten, sondern auch in der Fläche, auf dem Land. Das sollten Sie ehrlich sagen, anstatt sich an der einen oder anderen Stelle der Demagogie hinzugeben.
Solange wir das Gesundheitssystem beitragssatzabhängig finanzieren, befinden wir uns ständig im Spagat zwischen der Beitragssatzentwicklung - diese wird von allen Beteiligten ständig kritisiert - und der Forderung nach mehr Geld und finanziellen Spielräumen für die Versorgung der Patienten, deren Zahl angesichts der demografischen Entwicklung - ich habe es bereits gesagt: weniger und älter - steigt. Ich finde, wir sollten den Menschen die Wahrheit über die Ausgabenentwicklung sagen und von den Beteiligten einfordern, dass die Versichertengelder effizient eingesetzt werden. Wir sollten gleichzeitig für eine vernünftige Finanzierung des gesetzlichen Krankenversicherungssystems in Deutschland sorgen. Wir sollten uns dieser Aufgabe stellen und gemeinsam dafür werben.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege Spahn, möchten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Spieth zulassen?
Jens Spahn (CDU/CSU):
Da meine Redezeit gerade zu Ende ist, gerne.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Spieth.
Frank Spieth (DIE LINKE):
Herr Kollege Spahn, die 167 Milliarden Euro, über die wir reden, erfordern nach Ihrem Modell in der Tat einen Beitragssatz von 15,5 Prozent. Würden wir aber die durch die gesetzliche Krankenversicherung abgedeckten versicherungsfremden Leistungen plus die abgesenkten Beiträge für Arbeitslosengeld-I- und -II-Bezieher durch Steuern finanzieren, könnten wir theoretisch - das hat das Fritz-Beske-Institut gestern veröffentlicht - mit einem Beitragssatz von 11 Prozent auskommen,
ohne Einschränkungen in der Gesundheitsversorgung vorzunehmen, und all das finanzieren, was jetzt zugesagt worden ist. Können Sie bestätigen, dass 15,5 Prozent nur in Ihrem System die Ultima Ratio ist und dass es mit steuerlichen Zuschüssen wesentlich preiswerter ginge?
Jens Spahn (CDU/CSU):
Zuerst einmal freue ich mich, dass Sie, Herr Kollege Spieth, unter den gegebenen Umständen den Beitragssatz von 15,5 Prozent als richtigen Wert anerkennen. Das hat vorhin in der Diskussion der eine oder andere nicht getan.
Zum Zweiten wissen Sie, dass wir bereits mit der letzten Gesundheitsreform festgeschrieben haben, dass die Steuermittel, die in das Gesundheitswesen fließen, langsam steigen, gerade um versicherungsfremde Leistungen zu finanzieren. Aber die Wahrheit ist natürlich - das sage ich auch angesichts der Debatte, die wir heute Morgen zur Finanzmarktsituation geführt haben -, dass das zusätzliche Steuergeld, das in das Gesundheitswesen fließen soll, finanziert werden muss. Eines akzeptiere ich nicht, nämlich dass Sie fordern, es solle mehr Steuergeld in das Gesundheitssystem fließen, aber gleichzeitig Ihre Fraktion im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags für Krankenhauszuschüsse, für Zuschüsse für die Pharmaforschung und für Präventionsmaßnahmen, die Sie übrigens in einen Fonds packen wollen, 4 Milliarden Euro zusätzlich beantragt - ich wiederhole die Zahl: 4 Milliarden Euro zusätzlich -, ohne zu sagen - selbst auf dreimaliges Nachfragen von mir -, wie das finanziert werden soll.
Das macht einmal mehr deutlich: Das ist eine haushaltspolitische Geisterfahrt, aber keine solide Finanzierung.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Jetzt hat der Kollege Peter Friedrich für die SPD-Fraktion das Wort.
Peter Friedrich (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte in Erinnerung an die Debatte von heute Vormittag, als wir über die Frage des Parlamentseinflusses gestritten haben, sagen: Ich kann schon verstehen, dass viele Personen in den Selbstverwaltungsgremien der Kassen nicht froh darüber sind, dass sie nicht mehr selber die Beitragssätze festsetzen dürfen und ihnen dieses Königsrecht genommen wird. Man kann nicht ernsthaft erwarten, dass sie darüber glücklich sind. Aber wenn wir erleben, dass es über den Beitragssatz und über die Auswahl des Gesündesten zu einem Wettbewerb kommt, dann ist es ein Akt von politischer Verantwortung, zu sagen: Wir lassen diesen Wettbewerb über den günstigsten Beitragssatz und über die gesündesten Versicherten nicht mehr zu.
Es ist eine schwere Aufgabe, die wir auf uns nehmen. Wir würden die Debatte hier in der Form vielleicht gar nicht führen, wenn wir nicht genau diese Verantwortung übernehmen würden, aber dies ist notwendig, um in dem Solidarsystem der gesetzlichen Krankenversicherung zu einer gerechten Form des Wettbewerbs zu kommen. Deswegen führen wir sie auch.
Mein zweiter Punkt: Frau Kollegin Widmann-Mauz, ich habe mich sehr über das Bekenntnis der CDU/CSU zum morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich gefreut. Wir haben diesen seit langem gefordert. Ich finde, es ist ein großer Erfolg, dass wir endlich hinbekommen, dass das Geld im Gesundheitswesen tatsächlich für die Behandlung von Krankheiten zur Verfügung gestellt wird und das Geld der Krankheit folgt. Auch da schaffen wir endlich faire Wettbewerbsbedingungen. Insofern freuen wir uns, dass wir das gemeinsam hinbekommen haben. Wir hätten uns noch einiges mehr gewünscht; das weiß man. Vielleicht erreichen wir in Zukunft zusammen noch mehr. Es tut mir übrigens leid, dass ich kein ähnlich feuriges Bekenntnis zum Zusatzbeitrag ablegen kann. Ich halte das Instrument des Zusatzbeitrags nach wie vor für sehr schwierig.
Wir werden sehen, wie es sich auswirkt. Gleichwohl haben wir beim morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich einen gemeinschaftlichen Erfolg erzielt.
Ich möchte an die Oppositionsparteien appellieren. Wenn wir die Anhörungen und die Beratungen dieser Woche zur Kenntnis genommen haben - wir waren ja alle miteinander da und haben zugehört -:
Es ist doch wirklich nicht zu glauben, dass Sprecher und Vorstandsmitglieder der Kassen in der Öffentlichkeit und in den Anhörungen sagen: ?Wir wissen gar nichts; wir wissen nicht, wie viel Geld wir bekommen; wir wissen nicht, wie das alles funktionieren soll?, während ihre eigenen Mitarbeiter längst mit der Software und den ganzen Hinweisen an ihren Arbeitsplätzen sitzen und es berechnen können.
Sie wissen ganz genau, Herr Kollege Bahr - Sie haben doch selber danach gefragt und eine Antwort bekommen -: Seit dem 22. September liegt das komplette Modell vor. Am 15. November kommen die Zuwendungsbescheide. Mehr Planungssicherheit für die Krankenkassen gab es noch nie.
Stimmen Sie doch nicht in den Chor derer ein, die hier versuchen, Verunsicherung zu schüren! Die Kassen wissen ganz genau, wie viel Geld sie bekommen.
Sie wissen es rechtzeitig, und sie können damit auch planen. Was wir uns wünschen - daran müssen wir gemeinsam arbeiten -, ist, dass die Kassen die Instrumente, die wir ihnen gegeben haben, auch nutzen.
Herr Schily, zum Thema Wettbewerb und zur Frage der Transparenz: Es ist doch wirklich ein starkes Stück, dass wir hier gesetzliche Details in Angriff nehmen müssen, um die Kassen dazu zu bringen, sich beim Vertragswettbewerb an ordentliche Ausschreibungsverfahren, an ordentliche Verfahren der Auftragsvergabe, der Vertragsermittlung zu halten. In einigen Kassen ist zwischenzeitlich viel Fantasie entwickelt worden. Der Kollege Zöller hat in der letzten Debatte zu diesem Thema einmal beschrieben, was alles angefordert wurde. Wir schaffen an dieser Stelle jetzt Wettbewerbsklarheit. Wettbewerb braucht klare Regeln. Was wir mit diesem Gesetz sicherstellen, ist, dass die Kassen und die Leistungserbringer wissen, nach welchen Regeln Aufträge vergeben und Verträge geschlossen werden, sodass in diesem Bereich nicht mehr Wildwest herrscht.
Das gilt übrigens - ich muss sagen: leider auch - für die Frage des Übergangs für die Angestellten. Wir müssen noch einmal gesetzlich klarstellen, dass die Kassen verpflichtet sind, sich um ihre eigenen Mitarbeiter, die sie aufgrund der neuen Struktur nicht mehr brauchen, zu kümmern. Wir sollten ihnen dafür vier Jahre Zeit einräumen. Ehrlich gesagt, halte ich das nicht für einen Beweis der Willigkeit der Krankenkassen, in diesem Bereich tatsächlich für ihre eigenen Leute zu sorgen.
Herr Spieth, Sie haben angesprochen, dass wir uns bei der Aufteilung der Verwaltungskosten etwas anderes gewünscht hätten. Da haben Sie recht. Aber Sie wissen doch genauso gut - ich bin von Ihren demokratischen Fähigkeiten überzeugt, Herr Kollege -, dass Demokratie kein Wunschkonzert ist. Es war für uns allemal wichtiger, zustande zu bringen, dass die möglicherweise entstehenden Defizite nicht auf die Kinder und die Familienangehörigen abgewälzt werden und dass die Kassen zum Schluss die Doofen sind, die die Familien und die Kinder versorgen. Deswegen war es uns an dieser Stelle wichtiger als an anderer Stelle, uns durchzusetzen. Wir hätten uns auch da mehr gewünscht. Wir werden schauen, wie es sich auswirkt. Eventuell kommen wir in nächster Zeit tatsächlich dazu, das zu korrigieren.
Wenn ich mir aber anschaue, was die Kassen vom Aufwuchs bei den Verwaltungskosten her für sich selber schon veranschlagt haben, dann muss ich ganz ehrlich sagen: Ich hoffe sehr, dass dort die Zeichen der Zeit erkannt sind, dass es in der Verwaltung auf Sparsamkeit ankommt und nicht auf einen weiteren Ausbau.
Insofern sind wichtige Grundlagen geschaffen worden. Zuletzt wurden einige Korrekturen vorgenommen, die notwendig waren.
Wir bleiben dabei: Die Grundsatzfrage ?Bürgerversicherung versus Kopfpauschale? wird weiterhin Teil des Kampfes um politische Mehrheiten sein. Ich bin mir sehr sicher, dass wir da die besseren Argumente haben. Wir haben als Große Koalition an dieser Stelle Richtiges und Gutes getan.
Danke.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Der Kollege Max Straubinger spricht jetzt für die CDU/CSU-Fraktion.
Max Straubinger (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir sind jetzt am Schluss des Gesetzgebungsverfahrens zur Modernisierung und auch Stärkung unseres Gesundheitswesens. Ich glaube, dass wir mit Fug und Recht behaupten können: a) Wir haben die beste gesundheitliche Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land - sie wurde hier über viele Jahre und Jahrzehnte erarbeitet; vor allen Dingen wird sie auch weiterhin solidarisch finanziert -, und b) wir leisten heute mit dem Abschluss dieses Gesetzgebungsverfahrens einen weiteren Beitrag dazu.
Angesichts der Finanzkrise ist es für die Bürgerinnen und Bürger sehr bedeutungsvoll, dass sie sich auf ein solidarisches Gesundheitssystem verlassen können, dass dieses System modern ausgestaltet wird und vor allen Dingen angepasst wird an neue Gegebenheiten und neue Möglichkeiten der medizinischen Versorgung, und zwar für alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrer Leistungsfähigkeit, unabhängig von ihren Möglichkeiten, einen Finanzbeitrag zu leisten, sodass alle Bürgerinnen und Bürger am medizinischen Fortschritt teilhaben können. Das ist eine große Errungenschaft des sozialen Staatswesens, das wir gebildet haben.
Es ist auch bedeutungsvoll, was mit dem ersten Gesetz zur Stärkung unseres Gesundheitswesens eingeleitet worden ist und heute mit diesem Weiterentwicklungsgesetz fortgesetzt wird. Damit ist verbunden, dass die Schulden, die in den gesetzlichen Krankenkassen in der Vergangenheit angehäuft worden waren, mittlerweile zurückgeführt werden und am 31. Dezember dieses Jahres abgebaut sein werden,
sodass die Beitragsmittel, die bisher zur Entschuldung eingesetzt worden sind, zukünftig wieder für die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen.
Damit waren auch mehr Leistungen verbunden. Mit dem heute zu beschließenden Gesetz sind ebenfalls mehr Leistungen verbunden, etwa Ausweitung der enteralen Ernährung; darüber hinaus sollen zum Wohle der Patientinnen und Patienten aber auch sozialpsychiatrische Dienste gestärkt werden. Das sollte man nicht gering schätzen. Das ist mit Ergebnis dessen, was wir hier heute bewältigen.
Heute ist vielfältigst über die solidarische Finanzierung gestritten worden. Vor allen Dingen wurde bemängelt, dass es zukünftig einen einheitlichen Beitragssatz geben wird. Man kann sich natürlich darüber streiten: Ist das tatsächlich richtig und notwendig? Die Frau Bundesministerin hat die bisherige Spannbreite von 11,6 Prozent bis 16,5 Prozent angesprochen. Da kann man durchaus fragen, ob das sozial gerecht ist. Es scheint sozial gerechter zu sein, einen einheitlichen Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung einzuführen.
Die Kolleginnen und Kollegen von der FDP bemängeln, dass in der Finanzierung zu wenig Nachhaltigkeit im Sinne der älteren Bürgerinnen und Bürger gegeben sei, und verweisen auf die private Krankenversicherung. Gerade wir als CSU stehen für den Erhalt der privaten Krankenversicherung, weil es wichtig ist, ein wettbewerbliches Modell zu haben, die gesetzliche Krankenversicherung und die private Krankenversicherung zu haben. Herr Kollege Bahr, auch eine Untermauerung mit Kapitaldeckung bedeutet ja nicht, dass die Beiträge nicht steigen; im Gegenteil.
Viele Bürgerinnen und Bürger, die in der privaten Krankenversicherung sind, jammern gerade darüber, dass sie mit weit höheren Beitragslasten konfrontiert werden, wenn sie in ein bestimmtes Alter kommen. Das wird in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeglichen.
Beide Systeme haben eine gute Funktion für die Stärkung der gesundheitlichen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, dass man die Vor- und Nachteile ganz offen ansprechen sollte. Eine Präferenz für das eine oder andere System gibt es nicht.
Das Umlagesystem gibt die Möglichkeit, Ausgabensteigerungen, die von den Bürgerinnen und Bürgern verlangt werden - im Krankenhauswesen, bei der ärztlichen Versorgung vor Ort; das geht mit einer entsprechenden Honorierung einher -, auszugleichen. Ich sage ganz offen: Das bedeutet dann auch Beitragssatzsteigerungen. Wenn wir mehr für Honorare der Ärzte ausgeben, wenn wir mehr für die Sicherung unserer Krankenhäuser tun, vor allen Dingen im ländlichen Raum entsprechend Finanzmittel zur Verfügung stellen, wenn die Bürgerinnen und Bürger Gott sei Dank älter werden können, aber dazu mehr Medikamente benötigen, dann bedeutet das Ausgabensteigerungen, und die Mittel zur Deckung dieser Ausgabensteigerungen müssen die Bürgerinnen und Bürger berappen. Das ist aber gut angelegtes Geld. Die gesundheitliche Versorgung hat nämlich den höchsten Stellenwert für die Menschen in unserem Land.
Heute ist vielfach über die Beitragsbelastung gesprochen worden, und es ist dargestellt worden, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch eine Senkung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung entlastet werden. Oft entsteht dadurch in der Öffentlichkeit der Eindruck, dass die Rentnerinnen und Rentner zu stark belastet sind. Daher möchte ich hier ausdrücklich feststellen, dass die Belastung der Rentnerinnen und Rentner in Deutschland 0,5 Euro bis 6 Euro im Monat beträgt. Ich glaube, das ist eine sozial verantwortliche Beitragsgestaltung, die wir da vorgenommen haben.
Werte Damen und Herren, ich möchte noch kurz zwei Dinge ansprechen. Wir haben dafür gesorgt - das war für die CSU ein wichtiges Anliegen -, dass eine vernünftige Konvergenzregel gefunden worden ist. Ich danke dem Bundesministerium, das mit dazu beigetragen hat, diese Lösung zu finden. Vor allem für die Länder, die befürchten mussten, mit der Fondslösung viele Finanzmittel zu verlieren, ist hiermit eine sachgerechte Lösung gefunden worden.
Der Kollege Spieth hat in seiner Rede davon gesprochen, dass die Regelung zu den Hausarztverträgen zukünftig zu einer hausarztzentrierten Versorgung - § 73 b - führen wird. Ich bin über diese Aussage und auch über die Kritik verwundert. Im bayerischen Landtagswahlkampf hat die Linke immer das Horrorgemälde gemalt, die ärztliche Versorgung vor Ort sei nicht mehr gesichert, die Qualität werde sowieso sinken und so weiter. Im Gegensatz zu den Linken halten wir als CSU Wort. Wir bleiben bei dem, was vor der Wahl gesagt worden ist; das halten wir auch nach der Wahl. Es ist im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, der Patientinnen und Patienten, dass wir so verfahren.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen, bitte.
Max Straubinger (CDU/CSU):
Wir sind keine Ypsilantis. Ich glaube, wir leisten damit einen guten Beitrag für eine breite hausärztliche Versorgung der Bürgerinnen und Bürger. In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf.
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und der Frau Präsidentin herzlichen Dank für die Geduld.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 16/10609, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf den Drucksachen 16/9559 und 16/10070 in der Ausschussfassung anzunehmen.
Zu dieser Abstimmung liegen persönliche Erklärungen der Kollegin Gitta Connemann sowie der Kollegen Dr. Rolf Koschorrek und Kurt Rossmanith vor.
Ich bitte jetzt diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen.
- Das ist jetzt aber schwierig. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Ich gehe davon aus, dass das Abstimmungsverhältnis so ist, dass die Koalitionsfraktionen zugestimmt und die Oppositionsfraktionen dagegen gestimmt haben. Enthaltungen konnte ich von hier aus nicht sehen.
und Schlussabstimmung. Wir stimmen auf Verlangen der FDP-Fraktion namentlich ab.
Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. - Sind alle Urnen besetzt? - Ja. Dann ist die Abstimmung eröffnet.
Ist ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme noch nicht abgegeben hat? - Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der Abstimmung geben wir Ihnen später bekannt.
Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 16/10625. Wer stimmt für den Entschließungsantrag? - Die Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Der Entschließungsantrag ist bei Zustimmung durch die FDP-Fraktion, Gegenstimmen der Koalitionsfraktionen und der Linksfraktion sowie Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt.
Tagesordnungspunkt 35 b. Unterrichtung durch die Bundesregierung über den beabsichtigten Erlass einer Verordnung zur Festlegung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ich gehe davon aus, dass Sie die Unterrichtung auf Drucksache 16/10474 zur Kenntnis genommen haben.
[Der folgende Berichtsteil - und damit der gesamte Stenografische Bericht der 184. Sitzung - wird am
Montag, den 20. Oktober 2008,
an dieser Stelle veröffentlicht.]