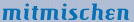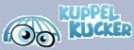187. Sitzung
Berlin, Donnerstag, den 13. November 2008
Beginn: 9.30 Uhr
* * * * * * * * V O R A B - V E R Ö F F E N T L I C H U N G * * * * * * * *
* * * * * DER NACH § 117 GOBT AUTORISIERTEN FASSUNG * * * * *
* * * * * * * * VOR DER ENDGÜLTIGEN DRUCKLEGUNG * * * * * * * *
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nehmen Sie bitte Platz. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Sitzung ist eröffnet.
Ich begrüße Sie alle herzlich.
Vor Eintritt in die Tagesordnung darf ich Ihnen mitteilen, dass der Kollege Horst Seehofer am 5. November auf seine Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag verzichtet hat.
- Das ist Ihnen vor dieser ultimativen Entscheidung offensichtlich nicht mit der gleichen Deutlichkeit vorgetragen worden, wie das jetzt nachträglich der Fall ist. - Jedenfalls ergibt sich nun die definitive Konsequenz, dass als Nachfolger der Kollege Matthäus Strebl im Deutschen Bundestag zu begrüßen ist, der uns bereits aus früheren Wahlperioden bestens vertraut ist.
Lieber Kollege Strebl, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ihnen muss ich besonders wenig erläutern, in welcher guten Gesellschaft Sie sich hier befinden. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind und auf die weitere Zusammenarbeit.
Interfraktionell ist vereinbart worden, die verbundene Tagesordnung um die in der Zusatzpunktliste aufgeführten Punkte zu erweitern:
ZP 5 Weitere Überweisungen im vereinfachten Verfahren
(Ergänzung zu TOP 47)
a) Erste Beratung des von den Abgeordneten Hans-Joachim Otto (Frankfurt), Jörg van Essen, Gudrun Kopp, weiteren Abgeordneten und der Fraktion der FDP eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Wahrung der Rechtssicherheit bei der Telekommunikationsüberwachung und anderen verdeckten Ermittlungsmaßnahmen
- Drucksache 16/10838 -
Überweisungsvorschlag:
Rechtsausschuss (f)
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie (f)
Ausschuss für Kultur und Medien
Federführung strittig
b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Winfried Hermann, Peter Hettlich, Dr. Anton Hofreiter, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Feinstaubreduktion im Straßenverkehr fortsetzen - Filteraustausch umsetzen, Prüf- und Messverfahren für Dieselrußpartikelfilter einführen
- Drucksache 16/9802 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (f)
Finanzausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen
Union
c) Beratung des Antrags der Abgeordneten Christine Scheel, Dr. Gerhard Schick, Britta Haßelmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Transparenz an den Finanzmärkten schaffen - Anschleichtaktik bei verdeckten Unternehmensübernahmen verhindern
- Drucksache 16/10640 -
Überweisungsvorschlag:
Finanzausschuss (f)
Innenausschuss
Rechtsausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
d) Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg, Eckart von Klaeden, Anke Eymer (Lübeck), weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU
sowie der Abgeordneten Dr. Rolf Mützenich, Gert Weisskirchen (Wiesloch), Gerd Andres, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD
Nichtstaatliche militärische Sicherheitsunternehmen kontrollieren
- Drucksache 16/10846 -
Überweisungsvorschlag:
Auswärtiger Ausschuss (f)
Innenausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Verteidigungsausschuss
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung
e) Beratung des Antrags der Abgeordneten Wolfgang Gehrcke, Monika Knoche, Hüseyin-Kenan Aydin, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE
Pakistan und Afghanistan stabilisieren - Für eine zentralasiatische regionale Sicherheitskonferenz
- Drucksache 16/10845 -
Überweisungsvorschlag:
Auswärtiger Ausschuss (f)
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Verteidigungsausschuss
ZP 6 Weitere abschließende Beratungen ohne Aussprache
(Ergänzung zu TOP 48)
a) Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (19. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Thilo Hoppe, Ulrike Höfken, Marieluise Beck (Bremen), weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Überschüssige Mittel aus EU-Agrarhaushalt für Bekämpfung der Hungerkrise nutzen
- Drucksachen 16/10591, 16/10912 -
Berichterstattung:
Abgeordnete Anette Hübinger
Dr. Sascha Raabe
Hellmut Königshaus
Alexander Ulrich
Thilo Hoppe
b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Gesundheit (14. Ausschuss) zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung (inkl. 11307/08 ADD 1 bis 11307/08 ADD 3)
KOM(2008) 414 endg.; Ratsdok. 11307/08
- Drucksachen 16/10286 A.55, 16/10911 -
Berichterstattung:
Abgeordneter Jens Spahn
c) Beratung des Antrags der Abgeordneten Grietje Staffelt, Jerzy Montag, Manuel Sarrazin, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Internetnutzerinnen und -nutzer nicht massenhaft kriminalisieren - Novellierung des EU-Telekommunikationspaketes nicht für Urheberrechtsregelungen missbrauchen
- Drucksache 16/10843 -
ZP 2 Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktion DIE LINKE:
Bahnchef Mehdorn ablösen, Verkehrsminister Tiefensee entlassen, Börsengang der Deutschen Bahn endgültig absagen
ZP 7 Beratung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Missbilligung der Amtsführung und Entlassung von Bundesminister Wolfgang Tiefensee
- Drucksache 16/10918 -
Von der Frist für den Beginn der Beratungen soll, so weit erforderlich, abgewichen werden.
Der Tagesordnungspunkt 21 a - dabei handelt es sich um das Jahressteuergesetz 2009 - muss abgesetzt werden. In der Folge sollen die Tagesordnungspunkte 23, 25, 29 und 21 b jeweils nach den Tagesordnungspunkten 20, 22, 24 und 28 aufgerufen werden. - Das scheint niemanden wirklich zu beunruhigen, sodass wir das so vereinbaren können.
Schließlich ist vorgesehen, den Entwurf des Erbschaftsteuerreformgesetzes auf den Drucksachen 16/7918 und 16/8547 nachträglich gemäß § 96 unserer Geschäftsordnung zusätzlich an den Haushaltsausschuss zur Mitberatung zu überweisen:
Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts (Erbschaftsteuerreformgesetz - ErbStRG)
- Drucksachen 16/7918, 16/8547 -
überwiesen:
Finanzausschuss (f)
Rechtsausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Haushaltsausschuss gemäß §
96 GO
Sind Sie auch damit einverstanden? - Das ist offenkundig der Fall. Dann ist das so beschlossen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf der Ehrentribüne hat der Präsident des Storting des Königreichs Norwegen, Herr Thorbjørn Jagland, mit seiner Delegation Platz genommen.
Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, von denen Ihnen einige bereits in den letzten Tagen begegnet sind, begrüße ich Sie ganz herzlich.
Sehr geehrter Herr Präsident, es ist uns eine große Freude, Sie und Ihre Begleitung zu einem offiziellen Besuch in Deutschland zu Gast zu haben. Der Deutsche Bundestag misst der Zusammenarbeit unserer Parlamente - gerade wegen der immer größeren Bedeutung der europäischen Kooperation - große Bedeutung bei. Ihr Besuch in Deutschland ist Ausdruck der freundschaftlichen und engen Beziehungen. Wir hatten schon gestern Gelegenheit, unsere gemeinsame Freude darüber zum Ausdruck zu bringen, dass nicht nur die Beziehungen zwischen unseren Ländern exzellent sind, sondern dass sich auch und gerade die Beziehungen zwischen unseren Parlamenten in den vergangenen Jahren in einer erfreulichen Weise vertieft haben. Daran wollen wir weiterarbeiten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen angenehmen und ergebnisreichen Aufenthalt in Deutschland. Herzlich willkommen!
Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 15 auf:
Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Förderung von Familien und haushaltsnahen Dienstleistungen (Familienleistungsgesetz - FamLeistG)
- Drucksache 16/10809 -
Überweisungsvorschlag:
Finanzausschuss (f)
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Gesundheit
Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96
GO
Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache eineinviertel Stunden vorgesehen. - Dazu höre ich keinen Widerspruch. Dann können wir so verfahren.
Ich eröffne die Aussprache. Das Wort erhält zunächst die Kollegin Lydia Westrich für die SPD-Fraktion.
Lydia Westrich (SPD):
Vielen Dank, Herr Präsident. - Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen! Heute bringen wir den Entwurf eines Familienleistungsgesetzes ein, und darüber freue ich mich sehr. Vor kurzem habe ich in einer Zeitung gelesen, das Klügste, was ein Politiker oder eine Politikerin beim Thema Kindergeld machen könne, sei es, einfach zu schweigen. Wir können hierbei im Grunde nichts richtig machen. Erhöhen wir das Kindergeld, dann ist es nicht genug; lehnen wir eine Erhöhung ab, dann sind wir natürlich familienfeindlich. Erhöhen wir den Kinderfreibetrag, dann nützt es nur den Besserverdienenden; machen wir es nicht, verstoßen wir gegen die Verfassung.
Diese Zeitungsbeschreibung erinnert mich an einige Anhörungen, Briefe und Presseerklärungen aus den letzten Jahren, die unsere Gesetze, die Kindergelderhöhungen beinhaltet haben, regelmäßig begleitet haben. Ich habe mindestens vier dieser Gesetze bereits mutig mit gestalten können, und jedes von ihnen hat die Situation der Familien verbessert. Deswegen arbeite ich auch dieses Mal voll Lust daran mit, trotz aller Widrigkeiten, die uns bestimmt ins Haus stehen werden.
Als ich 1990 in den Bundestag kam, haben wir für Kindergeld und Kinderfreibetrag umgerechnet gerade einmal 5,7 Milliarden Euro ausgegeben. 2005/2006, also 15 Jahre später, waren es dann über 35 Milliarden Euro. Das Volumen hat sich in dieser Zeit also verfünffacht, und jeder Cent davon ist gut angelegt.
Mit diesem Gesetz kommen noch einmal 2 Milliarden Euro hinzu. Der Kinderfreibetrag wird auf das neu ausgerechnete sächliche Existenzminimum für Kinder von 6 024 Euro angehoben. Im Gesetz steht zwar noch der Betrag von 6 000 Euro; hier war das Kabinett mit seiner Entscheidung schneller als die Rechner. Schon bei der Einbringung können wir also diesen Änderungsantrag ankündigen. Noch einmal: Der Kinderfreibetrag beläuft sich auf 6 024 Euro. Das Kindergeld wird pro Kind um 10 Euro erhöht; ab dem dritten Kind kommen weitere 6 Euro hinzu.
?Das ist gut?, hat meine Mitarbeiterin gesagt, ?da habe ich ja schon die Hälfte meiner Mieterhöhung wieder herein; jeden Monat 20 Euro mehr kann man gut brauchen.? Meine Nachbarin ist eine alleinerziehende Mutter und Studentin. Sie hat mir erzählt, dass sie nun endlich ein kleines Sparbuch anlegen wird.
So bescheiden die Erhöhung für die einzelnen Familien ausfällt, so summieren sich die Ausgaben ja doch auf mehr als 2 Milliarden Euro. Dazu addieren Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Kindertagesstättenausbauprogramm mit 4 Milliarden Euro, die letzten Reste vom Ganztagsschulprogramm, die Abzugsfähigkeit von Kinderbetreuungskosten, also für Kindergartenbeiträge, Tagesmütter usw., die Anhebung des BAföG, die Anhebung des Wohngeldes, das erfolgreiche Elterngeld und die Erhöhung des Kinderzuschlages. Damit erreichen wir innerhalb von nur zwei Jahren eine mehr als stattliche Summe, die die Große Koalition den Familien zur Verfügung gestellt hat.
Bei all diesen Maßnahmen haben wir immer die individuellen Lebensplanungen der Familien berücksichtigt, also keine Direktiven ausgegeben, sondern Angebote unterbreitet, die die bunte Vielfalt der Lebensformen unterstützen und fördern. Dabei ist der Ausbau der Kindertagesbetreuung ein ganz besonders wichtiger Schritt für uns gewesen, versehen mit einem Rechtsanspruch, über den sich die SPD-Fraktion selbstverständlich besonders freut. Ich habe nicht geglaubt, dass wir für die Familien so weit vorankommen werden.
Die Unterstützung der verschiedenen Familien- und Lebensphasen gilt auch für den zweiten Bereich des Familienleistungsgesetzes, das mit vollem Namen ?Gesetz zur Förderung von Familien und haushaltsnahen Dienstleistungen? heißt. Versuche, die Rolle von Haushalten als Arbeitgeber zu forcieren und den hohen Anteil von Schwarzarbeit in diesem Bereich zurückzudrängen, laufen schon seit vielen Jahren mit mehr oder minder viel Erfolg.
Es gibt viele Studien, die einen hohen Arbeitskräftebedarf im Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen feststellen, aber so richtig im Fluss ist dies noch nicht, vor allem im Hinblick auf legale, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Bisher waren die Fördermöglichkeiten in Regelungen hierzu in verschiedensten Bereichen versteckt, sodass die Leute sie kaum finden konnten. Mit diesem Gesetz ist es nun gelungen, alle Regelungen zu Steuerermäßigungen in Bezug auf haushaltsnahe Dienstleistungen und Beschäftigungsverhältnisse übersichtlich in einem Paragrafen des Einkommensteuerrechts zu verankern. Zudem haben wir den Umfang der Förderung erheblich ausgeweitet. 20 Prozent auf alles, angelehnt an einen bekannten Werbeslogan, kann man hier sagen. Ob Kochen, Putzen, Bügeln oder Pflegeleistungen zusätzlich zur familiären Pflege oder im betreuten Wohnen oder im Heim - die Kosten für diese Dienstleistungen mindern die tarifliche Einkommensteuer der Auftraggeber. Es sind nicht einfach nur Freibeträge, die sich erst bei den Beziehern höherer Einkommen richtig vorteilhaft auswirken, sondern es ist ein Abzug von der Steuerschuld, der sich auch bei Beziehern kleiner Einkommen voll bemerkbar machen wird. Ich bin sehr froh darüber, dass die SPD-Bundestagsfraktion das durchsetzen konnte.
Meine andere Nachbarin ist eine alte Dame, die zur Familie ihrer Tochter gezogen ist, um dort besser versorgt zu werden. Sie hat ihr altes Haus im Dorf vermietet und zahlt deshalb etwas an Steuern. Sie hat richtig gestrahlt, als ich ihr erklärte, dass sie die Kosten für ihre Bügelfrau aus der Sozialstation nun von der Steuer absetzen kann. Da könne sie sich nächstes Jahr noch ein paar Stunden mehr Hilfe von der Sozialstation erlauben, sagte sie. Das hat sie ganz glücklich gemacht.
Das bewirkt genau das, was wir mit dieser Förderung erreichen wollen: Stabilisierung und Ausweitung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse bei Sozialstationen, Dienstleistungsagenturen, Pflegediensten oder wie sie alle heißen und Erleichterung der Familienarbeit in all ihren Facetten, von der Kinderbetreuung bis zur Hilfe bei der Pflege von Angehörigen. Das ist ein wichtiger Baustein bei den Bemühungen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen.
Für mich ist das eine ganz besondere Familienförderung. Der steuersubventionierte Einkauf von Leistungen schenkt der Familie Zeit für sich und das Zusammenleben. Man muss nicht mehr sagen: ?Schönes Wetter, aber schade, ich muss Fenster putzen?, sondern kann mit den Kindern unbeschwert den Gang ins Grüne antreten oder den genussreichen Friseurbesuch machen, während die Oma gut versorgt zu Hause ist.
Das sind immer nur ganz kleine Facetten, aber - das müssen Sie zugeben, Kolleginnen und Kollegen - diese machen die Lebensqualität von Familien erst aus, und das unterstützen wir bei Familien nachhaltig. Ich bin davon überzeugt, dass die Ausweitung und Vereinfachung der Förderung von haushaltsnahen Dienstleistungen ein guter Beitrag dazu ist.
Der dritte wichtige Punkt des Gesetzentwurfs ist das Schulbedarfspaket. Das lässt mich nun wirklich mit einem lachenden und einem weinenden Auge hier stehen. Lange, lange hat die SPD-Fraktion für dieses Schulbedarfspaket gekämpft. Ich habe mich schon geschämt, wenn die Caritas mir wieder Briefe geschickt hat, in denen sie auf die finanziellen Grenzen von Hartz-IV-Empfängern bei der Schulbedarfsbeschaffung hingewiesen hat. Nun haben wir das Paket in diesem Gesetzentwurf verankert. 100 Euro pro Kind pro Schuljahr, das ist eine echte Hilfe für Familien, die ihren Kindern trotz Schulbuchgutscheinen und Ähnlichem nicht das erforderliche Material - Schulranzen, Farbkästen, Hefte usw. - zur Verfügung stellen können. Ich freue mich schon auf den Brief, den ich jetzt an die Caritas schreiben kann.
Aber - das ist der große Wermutstropfen für mich und die gesamte sozialdemokratische Bundestagsfraktion - dieses Schulbedarfspaket ist bis zum 10. Schuljahr befristet, und das darf nicht sein. Gerade die Familien, die es trotz niedrigstem Einkommen schaffen, ihren Kindern eine gute Schulausbildung zu ermöglichen, dürfen nicht im Regen stehen gelassen werden.
Hinzu kommt natürlich, dass die Ausgaben in den höheren Schulklassen steigen.
Da appelliere ich noch einmal ganz ausdrücklich an Sie, Frau Ministerin von der Leyen. Wir reden viel davon, dass es darum gehen muss, Wege zu finden, die Kinderarmut zu bekämpfen. Wir dürfen Familien, die Unterstützung zum Lebensunterhalt benötigen, doch nicht signalisieren: Eure Kinder unterstützen wir nur bis zur 10. Klasse, also Hauptschul- oder Realschulabschluss. - Das ist undenkbar.
Alle bisherigen Studien, vor allem internationale, beanstanden in Deutschland die Undurchlässigkeit des Schulsystems. In keinem Land ist die Herkunft für das Bildungsfortkommen so maßgebend wie bei uns. Dass wir diesen, wie ich finde, schrecklichen Makel unseres Landes, in dem doch alle Kinder mit ihren Talenten und Fähigkeiten so dringend gebraucht werden, auch noch durch ein Familienleistungsgesetz sozusagen festschreiben, ist für uns Sozialdemokraten unvorstellbar.
Wir können doch nicht einen höheren Freibetrag für Kinder einführen, die an Privatschulen unterrichtet werden - das tun wir, und das ist auch gut -, und fast gleichzeitig entscheiden, dass wir die jährlich 100 Euro für Kinder aus Hartz-IV-Familien, die sich den Weg zum Gymnasium sicher mehr als hart erkämpft haben, nicht übrig haben.
Der dritte Teil dieses Gesetzes bringt den Familien, die es brauchen, wirkliche Erleichterung. Aber die dortigen Regelungen müssen entfristet werden. Ich kann mir das Signal, Bildung ernst zu nehmen, ganz anders vorstellen: Wir könnten zum Beispiel Kindern aus Familien, die Zuschuss zum Lebensunterhalt benötigen und das elfte Schuljahr besuchen, einen höheren Schulbedarfssatz zusprechen. Über die Höhe können wir ja noch gemeinsam diskutieren. Ich hoffe, dass wir uns auch in diesem Punkt einigen. Dann, Kolleginnen und Kollegen, wird das Gesetz ein weiterer Meilenstein hin zu einer nachhaltigen Familienförderung sein. Wir haben mit der Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages, mit der Ausweitung und Vereinfachung der steuerlichen Absetzbarkeit von haushaltsnahen Dienstleistungen und mit dem Schulbedarfspaket zur Förderung der Bildung, über das wir sicher noch konstruktiv beraten werden, schon bisher viel für die Familien getan und werden diesen Weg auch weitergehen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Carl-Ludwig Thiele ist der nächste Redner für die FDP-Fraktion.
Carl-Ludwig Thiele (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Liebe Frau Kollegin Westrich, ich glaube, in einem Punkt stimmen wir bei den Beratungen über dieses Gesetz in diesem Haus überein: Unsere Gesellschaft muss familienfreundlicher werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, darf es nicht allein um die Frage gehen, welche finanziellen Leistungen gewährt werden, sondern es muss auch die Grundeinstellung unseres Landes hinterfragt werden, also wie unsere Gesellschaft mit Kindern umgeht. Es gibt leider Menschen, die in Bereichen unserer Gesellschaft leben, in denen es gar keine Kontakte mehr zu Kindern gibt. Diese haben keine Kinder in ihrem Umfeld. Ich finde, wir alle sollten hier gemeinsam dafür Sorge tragen, dass den Bürgern vermittelt wird, welche Freude Kinder bereiten können. Natürlich bereiten Kinder nicht nur Freude, sondern verursachen auch Stress und Anstrengungen, und von älteren Kindern wird man vielleicht auch als Vater oder Mutter einmal kritisiert werden. Das gehört dazu.
Kinder bereichern unsere Gesellschaft. Dass alle Teile der Gesellschaft von dieser Bereicherung profitieren, dafür sollten wir uns alle gemeinsam einsetzen.
Deshalb halten wir es auch nicht für angezeigt, die ganze Diskussion über Familien nur auf den finanziellen Teil zu reduzieren. Das habe ich ja gerade in meinem Vorwort dargestellt. Aber natürlich muss man sich, wenn man sich mit der Situation der Familien beschäftigt, auch damit auseinandersetzen, wie die gesellschaftliche Wirklichkeit in unserem Land für die Familien aussieht. Kinderfreundlichkeit der Gesellschaft ist die eine Seite der Medaille. Kinder kosten aber auch Geld.
Die letzte Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages erfolgten 2002, also vor sieben Jahren. Wir alle wissen, dass seit diesem Zeitpunkt die Preise erheblich gestiegen sind, nicht zuletzt durch die Mehrwertsteuererhöhung. Seitens der Koalition ist über die Jahre nichts erfolgt, um den Familien zu helfen. Das haben wir schon oft kritisiert; das werden wir weiter kritisieren. Das ist aber auch der Grund, warum wir uns konstruktiv in das Gesetzgebungsverfahren einschalten werden. Wir wollen nämlich erreichen, dass den Familien konkrete Hilfe zuteil wird.
Wenn man sich anschaut, wann dieser Gesetzentwurf vom Kabinett verabschiedet wurde, dann stellt man fest, dass er am selben Tag verabschiedet wurde, an dem auch der einheitliche Beitragssatz zur Krankenversicherung festgesetzt wurde. Damit einher geht eine deutliche Mehrbelastung für Familien. Den Familien wurde nun zwar suggeriert, man gebe ihnen mehr Geld, aber das, was auf der einen Seite gegeben wurde, wurde auf der anderen Seite schon wieder einkassiert. Das halten wir für falsch. Wir wollen, dass ein klares und deutliches Signal zugunsten von Kindern und Familien in unserer Gesellschaft gesetzt wird.
In unserem Steuerprogramm für eine niedrige, einfache und soziale Steuer sehen wir schon seit Jahren ein einheitliches Kindergeld von 200 Euro und einen einheitlichen Kinderfreibetrag von 8 000 Euro pro Kind vor.
Wir sind auf dem Wege dorthin und werden uns weiter dafür einsetzen. Das haben wir im vergangenen Wahlkampf gemacht. Das werden wir auch im nächsten machen. Wir bitten Sie allerdings auch, zu prüfen, ob die Erhöhung des Kindergeldes um 10 Euro ausreichend ist oder ob es nicht eventuell um 16 Euro erhöht werden sollte. Denn eines muss man den Bürgern unseres Landes ja sagen:
Das Kindergeld belief sich immer auf glatte Zehnerbeträge: Bis 1996 waren es 70 DM, dann stieg es auf 200 DM, 220 DM, 250 DM, 270 DM und dann auf 300 DM. Die 300 DM wurden krumm auf Euro umgerechnet. Seitdem beläuft sich das Kindergeld auf 154 Euro. Ich bitte zu prüfen, ob das weiter sein muss; denn sonst kommt jemand auf die Idee, zu sagen: Moment, müssen es 164 Euro sein, oder sollen es nicht 164,50 Euro sein? An dieser Stelle passt es dann nicht mehr richtig, sodass ich an Sie appelliere: Geben Sie sich einen Ruck und kehren Sie zurück zu den glatten Beiträgen!
Wir wissen um die Haushaltsnot. Das ist völlig klar. Wir wollen auch nicht mit der Gießkanne über das Land gehen. Wir brauchen aber klare Regelungen und klare Bestimmungen, gerade in diesem Bereich. Insofern wäre ich dankbar, wenn Sie im Gesetzgebungsverfahren hierüber noch einmal nachdenken könnten.
Dieser Appell gilt insbesondere auch für den Kinderfreibetrag; denn die Gewährung des Kinderfreibetrags ist kein Almosen des Staates. Sie beruht auf dem Recht eines jeden Bürgers, seine Existenz aus unversteuertem Einkommen bestreiten zu dürfen.
Insofern ist dies eine Bringschuld, die der Staat zu erfüllen hat. Es ist schon erstaunlich, das auf unsere Forderungen auf Erhöhung hin in den vergangenen Jahren immer gesagt wurde, man könne noch nicht entscheiden, da der Bericht zum Existenzminimum noch nicht vorliege. Jetzt erleben wir, dass die Koalition entschieden hat, ohne dass der Bericht zum Existenzminimum vorliegt. An dieser Stelle zeigt sich, dass diese Argumentationskette über die vergangenen Monate und Jahre hinweg überhaupt nicht gehalten hat und überhaupt nicht halten kann.
Sie wollten die Erhöhung des Kindesgeldes und des Kinderfreibetrages nicht. Haushaltszwänge konzedieren wir. Dass diese aber zulasten der Familien gegangen sind, das halten wir für falsch.
Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zum Schulbedarfspaket, das Sie angesprochen haben, Frau Kollegin Westrich, einige Ausführungen machen. Ich halte es für einen Fehler des Gesetzgebers, dass seinerzeit im Rahmen der Hartz-IV-Gesetzgebung die notwendigen Ausgaben für Bildung nicht berücksichtigt wurden. Man orientierte sich an den Erwachsenen. Man unterstellte, dass sie bereits Bildung hätten. Für die Kinder wurde analog zu den Erwachsenen ein niedrigerer Förderbetrag vorgesehen.
In vielen Kommunen haben sich deshalb Bürgerinitiativen gebildet. Viele Bürger haben gesagt: Wir sehen an unseren Mitbürgern, welche Not die Einzelnen haben, die nicht in der Lage sind, den Kindern Schulhefte, Stifte und Ähnliches zu kaufen. Wir wollen hier tätig werden.
Im ganzen Land verteilt gibt es inzwischen zig Vereine, wie zum Beispiel ?Kinder in Not? in Osnabrück, die helfen und tätig werden wollen. Die FDP hat den Vorstand dieses Vereins zur Anhörung eingeladen.
Wir bitten Sie zu überprüfen, ob der Gesetzentwurf, so wie er angedacht ist, richtig ist; denn im Gesetzentwurf findet sich aus meiner Sicht ein Passus, der diskutiert werden sollte. Dort heißt es: Wenn diese 100 Euro gewährt werden, dann kann im begründeten Einzelfall ein Nachweis über die Verwendung des Geldes gefordert werden.
Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich zitiere Finanzminister Steinbrück aus einem Interview mit der Zeit vom 24. April dieses Jahres.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege Thiele.
Carl-Ludwig Thiele (FDP):
Ich komme zum Ende, Herr Präsident.
Was ist besser für die Kinder, eine Kindergelderhöhung im Wert von zwei Schachteln Zigaretten beziehungsweise drei Pils - oder der Ausbau der Betreuungsinfrastruktur...?
Insofern möchte ich an Sie alle appellieren. Wer will, dass dieses Geld tatsächlich bei den Kindern ankommt, die es benötigen, sollte überlegen, aus dieser Kannbestimmung eine Sollbestimmung zu machen. Konkret werden wir im Finanzausschuss erörtern, wie wir sicherstellen können, dass dieses Geld tatsächlich dort ankommt, wo es unserer Meinung nach ankommen soll.
Herzlichen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält nun die Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen.
Dr. Ursula von der Leyen, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bundesregierung hat beherzte Schritte in der Familienpolitik unternommen. Wir haben das Elterngeld eingeführt. Wir beschleunigen den Ausbau der Kinderbetreuung durch gezielte Investitionen in Höhe von 4 Milliarden Euro. Gerade bei diesen beiden Themen - Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie frühkindliche Bildung - besteht in Deutschland großer Nachholbedarf. Deshalb ist diese Investition richtig.
Mit dem heute zu beratenden Familienleistungsgesetz wird eine dritte, ebenso unverzichtbare Säule gestärkt, nämlich die Ausgleichszahlungen an die Familien, die Kinder erziehen. Familien mit Kindern - da stimme ich mit Ihnen vollkommen überein, Herr Thiele - erfahren sicherlich ein ganz großes persönliches Glück durch diese Kinder. Aber Familien mit Kindern investieren auch Tag für Tag Zeit, Kraft, Geld und Zuwendung in die nächste Generation. Davon profitieren alle in diesem Land. Deshalb ist es richtig, dass Familien mit Kindern weniger besteuert werden als andere. Deshalb ist es auch richtig, dass Familien mit Kindern, die kleine Einkommen haben und die nicht von Steuererleichterungen profitieren, Ausgleichszahlungen über das Kindergeld bekommen.
Das sehen die Menschen in Deutschland auch so. Das Kindergeld ist die familienpolitische Leistung mit dem höchsten Ansehen in der Bevölkerung.
Seit 2002 ist das Kindergeld für das erste und zweite Kind nicht mehr erhöht worden. Wir alle wissen, wie viele Güter des täglichen Bedarfs seitdem teurer geworden sind. Der Existenzminimumbericht liegt den Ressorts zur Abstimmung vor und wird nächste Woche im Kabinett behandelt. Dieser Bericht zeigt die Entwicklung sehr deutlich auf. Es wird also höchste Zeit, Familien genau an dieser Stelle zu entlasten. Das Kindergeld ist Schutz vor Armut. Ohne das Kindergeld wären 1,7 Millionen mehr Kinder von Armut betroffen. Das zeigt: Das Kindergeld ist keine nachrangige Leistung, sondern es schafft Gerechtigkeit und sozialen Ausgleich in diesem Land.
Der Kern des Familienleistungsgesetzes sind das erhöhte Kindergeld und das gestaffelte Kindergeld. Das gestaffelte Kindergeld ist eine ganz gezielte Leistung - auch in anderen europäischen Ländern -, um kinderreiche Familien zu stärken. Wir haben in der familienpolitischen Debatte zu Recht gefragt, warum die Kinderlosigkeit in Deutschland so hoch ist. Das über Jahre zu beobachtende Abnehmen der Kinderzahlen hat als Ursache zwei Phänomene.
Das erste Phänomen ist, dass der Mut fehlte, Familien zu gründen; denn es ist schwierig gewesen - und ist es zum Teil noch -, Beruf und Kindererziehung in Einklang zu bringen. Aber hier scheint sich eine positive Trendwende in den letzten anderthalb Jahren abzuzeichnen.
Das zweite, weniger bekannte Phänomen ist, dass in Deutschland viel schneller als in anderen Ländern die kinderreiche Familie aus der Mitte der Gesellschaft verschwunden ist. Diese Familien brauchen ganz gezielt das gestaffelte Kindergeld. Hier gilt nach wie vor der richtige Satz, dass Kinderreichtum nicht zur Armut führen darf.
Es ist unbestritten: Die kinderreichen Familien haben höhere Fixkosten. Sie brauchen eine größere Wohnung; sie geben mehr Geld für Heizung, Lebensmittel und Kleidung aus; die Waschmaschine läuft häufiger. Das kann man nicht nur durch mehr Arbeit ausgleichen.
Ich habe eingangs gesagt, dass zuletzt 2002 das Kindergeld für das erste und zweite Kind erhöht worden ist. Für das dritte Kind und die folgenden Geschwister ist das Kindergeld seit zwölf Jahren, nämlich seit 1996, nicht mehr erhöht worden. Deshalb ist es gut - ich danke, dass das heute gelingt -, dass wir endlich wieder das Kapitel des gestaffelten Kindergeldes aufschlagen. Damit wird die besondere Lage der kinderreichen Familie berücksichtigt.
An alle diejenigen, die immer sagen, dass 10 oder 16 Euro nichts bringen würden und dass man das Geld in andere Projekte stecken sollte, sage ich: Familien mit drei Kindern verfügen demnächst über 432 Euro mehr im Jahr. Familien mit vier Kindern verfügen demnächst über 624 Euro mehr im Jahr. Das ist gut angelegtes Geld.
Das höhere Kindergeld ist also keine Förderung nach dem Gießkannenprinzip, sondern wirkt zielgenau für kinderreiche Familien, für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen in der Mitte der Gesellschaft und gegen Kinderarmut.
Das Kindergeld ist nicht der einzige Baustein des Familienleistungsgesetzes. Kinder und Jugendliche aus Familien, die von Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe leben, bekommen bis zur 10. Klasse zu Beginn jedes Schuljahres 100 Euro für den Kauf nötiger Schulmaterialien. Hefte, Bücher, Stifte und Füller - das sind Bildungschancen zum Anfassen. Daran darf es keinem Kind fehlen.
Ein weiterer Baustein des Familienleistungsgesetzes ist die Förderung von familienunterstützenden Dienstleistungen. Das reicht von der Hilfe rund ums Haus bis hin zur Versorgung zu pflegender Angehöriger. Solche Dienstleistungen entlasten. Sie bedeuten ganz konkret Zeit für Familien. Aber in jedem Fall kosten sie auch Geld. In Zukunft können bis zu 20 000 Euro im Jahr für solche Ausgaben steuerlich geltend gemacht werden. Das hat eine doppelte positive Wirkung: Erstens haben Familien mehr Entlastung im Alltag. Zweitens tragen die familienunterstützenden Dienstleistungen gleichzeitig zu Wachstum und Beschäftigung in Deutschland bei. Das ist in Zeiten einer nachlassenden Konjunktur wichtig.
Mehr Kindergeld, mehr steuerliche Förderung für Familien mit Kindern, mehr familienunterstützende Dienstleistungen, ein Schulbedarfspaket - das sind vier Maßnahmen, ein Familienleistungspaket, das zielgenau wirkt.
Vielen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Dr. Barbara Höll ist die nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke.
Dr. Barbara Höll (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir diskutieren heute über den Entwurf des FamLeistG, des Familienleistungsgesetzes, ein Gesetz zur Förderung von Familien und haushaltsnahen Dienstleistungen. Dieser Gesetzentwurf beinhaltet zwei wesentliche Punkte: die Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages sowie die bessere steuerliche Absetzbarkeit von haushaltsnahen Dienstleistungen.
Ehrlich gesagt erschließt sich mir nicht ganz der innere Zusammenhang zwischen der steuerlichen Förderung, sprich der Subventionierung von Reichen und Superreichen am Starnberger See für ihre Hausangestellten und Gärtner, und der Erhöhung des Kindergeldes um 10 Euro pro Kind für die Kinder dieser Hausangestellten.
In der nächsten Sitzungswoche sollen mit dem Jahressteuergesetz 2009 und dem Gesetz zur Umsetzung steuerrechtlicher Regelungen des Maßnahmenpakets Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung zwei weitere Steuergesetze verabschiedet werden. Man hätte zumindest die zweite Hälfte des heute vorliegenden Gesetzentwurfes dahin packen können. Vielleicht wollten Sie das auch ein bisschen; denn im letztgenannten Gesetz soll die steuerliche Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen bei Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen ausgeweitet und mit Wirkung zum 1. Januar nächsten Jahres auf 1 200 Euro erhöht werden. Im heute zu besprechenden Entwurf des Familienleistungsgesetzes wird vorgeschlagen, die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen ebenfalls ab dem 1. Januar 2009 mit maximal 600 Euro zu fördern. Das bedeutet also alles in allem eine Senkung der zu zahlenden Steuern um 1 800 Euro, allerdings nur dann, wenn man im nächsten Jahr Handwerkerleistungen für mindestens 10 000 Euro in Anspruch nehmen kann und wird.
Das ist nicht mehr als eine kleine Geste an die Bürgerinnen und Bürger, aber nichts, was die Konjunktur nachhaltig ankurbeln wird oder tatsächlich von der Mehrheit der Menschen in Anspruch genommen werden kann, da ihnen das Geld dafür fehlt, von einer solchen Subventionierung überhaupt profitieren zu können.
Da ich nicht davon ausgehe, dass die Hausangestellte am Starnberger See - nennen wir sie Frau Beyer - an diesem Thema überaus interessiert ist, lassen Sie mich zur Kindergelderhöhung zurückkehren. Frau Beyer hat zwei Kinder, ihre Arbeitgeberin und Villenbesitzerin, Frau Schmidt, ebenfalls. Frau Beyer wird ab dem 1. Januar 2009 pro Monat 20 Euro mehr an Kindergeld für ihre Kinder bekommen, das heißt insgesamt 328 Euro pro Monat, pro Kind 164 Euro. Frau Schmidt erhält jedoch 210 Euro pro Kind und Monat. Jedes Kind ist dem Staat gleich viel wert? Mitnichten! Für Kinder reicher Eltern tun Sie mehr - und das ist sozial ungerecht.
Alternativen? Keine, so die lapidare Feststellung auf Seite 2 des Gesetzentwurfs. Ich zitiere Sie, Frau Ministerin:
Wenn man das alles auf ein Niveau bringen will, dann kann man das Ganze doch wohl nicht auf das niedrigste Niveau herunterstufen. Dann muss man vielmehr lege artis auf das höchste gemeinsame Niveau heraufstufen. Das würde 15 Milliarden Euro kosten - eine Illusion, die mit der Realität wenig zu tun hat.
So die Frau Ministerin. Frau von der Leyen, reden Sie doch noch einmal mit Herrn Steinbrück. Er hat inzwischen sehr viel Geld gefunden für einen sehr großen Schirm für die Finanzwirtschaft. Er ist sogar bereit, sein unumstößliches Ziel eines schuldenfreien Haushaltes dafür zu verschieben.
Sollte uns die Gleichbehandlung aller Kinder nicht diese 15 Milliarden Euro Mehrausgaben wert sein? Ich sage: Ja.
Ein kleiner Tipp von mir: Wenn Sie das Ehegattensplitting endlich in eine Individualbesteuerung bei gegenseitiger Übertragbarkeit des steuerfrei zu stellenden Existenzminimums umwandeln würden, hätten Sie 9 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen pro Jahr.
Frau von der Leyen, dann bräuchten Sie mit Herrn Steinbrück nur noch über ganze 6 Milliarden Euro zu verhandeln. Das muss doch wohl möglich sein.
Die Anhebung des Kinderfreibetrages nutzt nur Frau Schmidt, nicht jedoch Frau Beyer. Nur für 17 Prozent aller Kinder kann der Freibetrag vorteilhaft angesetzt werden. Nur deren Eltern haben ein entsprechend hohes Einkommen.
Ich gehe davon aus, dass Frau Schmidt Frau Beyer sozialversicherungspflichtig beschäftigt und anständig bezahlt. Frau Beyer arbeitet gut und zuverlässig für deutlich mehr als den von uns vorgeschlagenen Mindestlohn von 8,50 Euro. Frau Beyer wird sich über die 20 Euro mehr pro Monat sehr freuen. Frau Beyer und allen anderen sei aber ganz klar gesagt: Sie müssen dafür niemandem Danke sagen, weder der CSU noch der SPD, auch der CDU nicht. Diese 10 Euro pro Kind stehen Ihnen zu.
Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Es hat vorgegeben, dass der Staat das Einkommen der Steuerpflichtigen so weit steuerfrei belassen muss, als es zur Schaffung der Mindestvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein benötigt wird.
Die Verschonung gilt für alle Familienmitglieder und umfasst damit explizit auch den Bedarf der Kinder. Die Höhe des steuerlich zu verschonenden Existenzminimums hängt von den allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnissen und dem anerkannten Mindestbedarf ab. Da dieses im Sozialhilferecht bestimmt ist, darf das von der Einkommensteuer zu verschonende Existenzminimum diesen Betrag nicht unterschreiten. Demnach ist der im Sozialhilferecht anerkannte Mindestbedarf die Maßgröße für das einkommensteuerliche Existenzminimum. Da ich darauf schaue, sage ich Frau Beyer und allen anderen: Ihnen steht viel mehr zu; denn die Berechnung des Existenzminimums durch die Bundesregierung spiegelt die reale Entwicklung nicht wider.
Zum Vergleich: Das sächliche Existenzminimum, welches im Existenzminimumbericht 2008 mit 235 Euro pro Kind und Monat ausgewiesen wird, ist die eine Größe. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat nachgerechnet: Für die Bedarfsdeckung hält er einen Regelsatz in Höhe von 299 Euro pro Monat für notwendig, und zwar mindestens, da dieser Betrag nur für die Altersgruppe der 0- bis 6-Jährigen gilt und der Bedarf mit höherem Alter bekanntlich steigt. Grundlage der Berechnung ist die Preisentwicklung bei Warengruppen und Dienstleistungen, die für die Versorgung von Kindern relevant sind.
Deshalb ist es notwendig, das Kindergeld sofort stärker zu erhöhen, und zwar auf mindestens 200 Euro und in der Folge auf 250 Euro.
Für die unteren Einkommensgruppen fordern wir, dass das Kindergeld durch einen entsprechend ausgestalteten Kinderzuschlag so gestaltet wird, dass das Existenzminimum insgesamt gesichert ist. Die Verwirklichung dieser Vorschläge würde Frau Beyer helfen und Frau Schmidt nicht schlechter stellen. In Deutschland sind Kinder nun einmal das größte Armutsrisiko. Rund 2 Millionen Kinder leben in Familien, die mit Hartz IV oder Sozialgeld auskommen müssen. Da ihre Eltern über kein eigenes Einkommen verfügen, ist das Kindergeld für sie eine reine Sozialleistung. Damit begründen Sie, dass die Erhöhung des Kindergeldes um 10 Euro pro Kind mit dem Familieneinkommen verrechnet wird. Das heißt im Klartext: Genau die Familien, die das geringste Einkommen haben, haben nichts von der Kindergelderhöhung. Das ist ein Skandal!
Sie könnten sofort die Anrechnung aufheben bzw. nicht durchführen, und zwar so lange, bis Sie die Regelsätze so angepasst haben, dass sie den realen Bedarf decken. Wir fordern Sie auf, endlich ernsthaft Bedingungen zu schaffen, durch die alle Mütter und Väter in der Lage sind, ihre Existenz und die ihrer Kinder tatsächlich für sich selbst zu erarbeiten. Das umfasst neben einem dichten und qualitativ hochwertigen Netz von Kinderbetreuungseinrichtungen eine angemessene Bezahlung. Das erfordert gesicherte Arbeitsplätze und gleichen Lohn für gleiche Arbeit für Männer und Frauen. Davon sind wir weit entfernt.
Abschließend noch ein Wort zu dem vorgeschlagenen Schulgeld für Schülerinnen und Schüler im Rahmen des SGB II und XII, also Hartz IV und Sozialgeld. Wir begrüßen dies grundsätzlich und ausdrücklich, vor allem vor dem Hintergrund, dass Sie in der rot-grünen Koalition, als Sie die Sozialhilfe umgewandelt haben, alle Sonderbedarfe gestrichen haben. Es wird endlich Zeit, dass Sie dies korrigieren.
Für mich ist es aber völlig unverständlich, dass Sie dieses Schulgeld auf zehn Schuljahre begrenzen wollen. Meinen Sie zynischerweise, dass die Kinder von Hartz-IV-Empfängerinnen und -Empfängern sowieso zu dumm für das Abitur sind? Oder wollen Sie einfach dafür sorgen, dass die Ergebnisse der PISA-Studie auch in Zukunft Bestand haben, wonach in Deutschland der Schulabschluss vom Einkommensstatus der Eltern abhängt?
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Frau Kollegin, denken Sie bitte an die Redezeit.
Dr. Barbara Höll (DIE LINKE):
Das lehnen wir ab. Machen Sie hier eine tatsächliche Erweiterung, zahlen Sie es bis zum Abschluss des Abiturs, also zwölf oder 13 Jahre.
Gehen Sie das Thema endlich richtig an - so wie die Finanzmarktkrise -, und sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mehr das Armutsrisiko in Deutschland sind!
Danke.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält nun die Kollegin Deligöz für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.
Ekin Deligöz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Frau von der Leyen, Sie sind im Wahlkampf und auch am Anfang der Wahlperiode mit dem Versprechen angetreten, die Familienleistungen in Deutschland, die vielfältig und unübersichtlich, kompliziert und bürokratisch sind, zu überprüfen und zu effektivieren. Sie haben dazu ein Kompetenzzentrum einberufen, und Sie haben uns viele Berichte geliefert. Herausgekommen ist nichts.
Sie sind mit dem Versprechen angetreten, Gerechtigkeit zu thematisieren, auch im Sinne der Armutsbekämpfung. Sie sind mit dem Versprechen angetreten, Erziehung und Erziehungsleistungen ernst zu nehmen und zu unterstützen. Herausgekommen sind 10 Euro mehr Unterstützung. Das ist mager. Denn jetzt verpassen Sie gerade die letzte Chance in dieser Wahlperiode, eine wirkliche Reform durchzuführen und all Ihre Versprechen, die Sie gegeben haben, in die Realität umzusetzen. Stattdessen verkaufen Sie uns diese 10 Euro Kindergelderhöhung als Errungenschaft. Sie wissen doch genau, dass diese 10 Euro nicht eine freiwillige Entscheidung dieser Regierungspolitik sind,
sondern eine Konsequenz, die Sie aus dem Existenzminimumberichts ziehen. Weil im Zuge dieses Berichts das Existenzminimum angepasst werden muss. Sie können keinen Wahlkampf durchstehen, wenn ausgerechnet die, die am wenigsten verdienen, nichts bekommen. Deshalb machen Sie das und verkaufen es auch noch als eine Errungenschaft. Aber eine Errungenschaft ist es nicht.
Was ist denn - damit will ich anfangen - mit den Familien im SGB-II- und SGB-XII-Bezug? Was ist mit diesen Familien? Sie sagen, Sie unterstützen diese Familien. Sie bekommen aber keine 10 Euro Kindergelderhöhung. Sind das etwa keine Familien? Sind das keine Erziehenden, die Verantwortung übernehmen? Warum gehen sie leer aus, obwohl wir alle wissen, dass der Bedarf dort am allerhöchsten ist?
Antworten Sie doch einmal darauf. Sie sagen, 10 Euro seien gut angelegtes Geld. Kennen Sie denn die Realität nicht?
Die Mehrwertsteuererhöhung haben Sie durchgeführt. Die allgemeinen Preissteigerungen und die Steigerung der Energiepreise - und des Weiteren, dass der Kaufkraftverlust des Kindergeldes seit 2002 fast 12 Prozent beträgt - müssen Sie zur Kenntnis nehmen. Da sind 10 Euro nicht nur mager, sondern auch einfach nur symbolisch. Wenn Sie die Kindergelderhöhung ernst meinen, dann sollten Sie das auch ernst debattieren und sich nicht hinter einer Symbolpolitik verstecken.
Kommen wir dazu, was Sie machen. Sie sagen: Einige Kinder sind uns mehr wert als andere Kinder, die aus einem gut verdienenden Haushalt kommen, sind uns besonders viel wert. Diejenigen, die in einem Haushalt mit ALG-II-Bezug aufwachsen, sind uns weniger wert. - Der Staat erhöht das Kindergeld, das er aber sofort wieder einkassiert. Das heißt, das ist so, als ob sich der Staat selbst Geld auszahlt und dann so tut, als seien in dieser Sache die Familien die Gewinner. Das sind sie aber nicht.
Kommen wir zu Ihrem 100-Euro-Schulbedarfspaket. Den einen Eltern vertrauen Sie und gehen davon aus, dass sie das Geld für ihre Kinder ausgeben. Den anderen Eltern misstrauen Sie und glauben, dass Sie ihnen gar kein Geld geben können. - Wissen Sie, was letztendlich bei den Menschen ankommt, wenn Sie fordern, dass die Verwendung dieses Pakets von 100 Euro für den Schulbedarf kontrolliert werden muss, damit es wirklich nur für den Schulbedarf ausgegeben wird? Darüber hinaus gilt es nur bis zur 10. Klasse. - Ich frage Sie: Gehen Sie grundsätzlich davon aus, dass Kinder aus ärmeren Haushalten erst gar nicht aufs Gymnasium oder irgendeine andere weiterführende Schule gehen?
Gehen Sie davon aus, dass diesen Familien diese Kosten erst gar nicht entstehen? Oder finden Sie sich etwa damit ab - das wäre noch viel schlimmer -, dass die Situation so ist, wie sie ist, dass nämlich der Schulerfolg eines Kindes von der sozialen Herkunft abhängt und nur die Kinder aus den Akademikerhaushalten die besseren Chancen haben? Das wäre schlimm. Dann würden Sie nämlich sagen: Die Situation ist nun einmal so, und wir können sie nicht ändern. Genau das aber ist unsere Aufgabe. Wir dürfen uns nicht mit dieser Situation abfinden, sondern müssen sie ändern.
Deshalb brauchen wir doch die Kinderbetreuung. Deshalb brauchen wir Ganztagsschulen. Deshalb brauchen wir die Infrastruktur. Deshalb brauchen wir aber auch eine reelle und materielle Unterstützung der Familien. Ein ganz großer Anteil der Familien gibt das Geld für die Kinder aus. Das ist eine Tatsache.
Noch etwas anderes: die Regelsätze. Auch darüber müssen wir reden. Auch da müssen Sie etwas tun. Wenn wir sagen, dass das Existenzminimum zu niedrig bemessen ist, dann gilt das auch für die Regelsätze.
Dann gilt das auch für die Sätze der Kinder. Sie können sich doch nicht blind und taub stellen. In allen Bereichen reden Sie über Gerechtigkeit. Aber Sie reden nicht über die Regelsätze. Wir brauchen endlich eine neue Form, wie wir die Regelsätze für Kinder berechnen. Es kann nicht sein, dass wir sie an dem Erwachsenenbedarf ausrichten oder das prozentual kalkulieren. Dahinter steckt kein Sinn und keine Logik.
Diese Sätze sind de facto zu niedrig. Nehmen Sie das zur Kenntnis. Tun Sie etwas!
Je länger Sie warten, desto größer wird die Spaltung in dieser Gesellschaft. Irgendwann einmal wird uns diese Spaltung einholen. Für diese Spaltung müssen wir die politische Verantwortung übernehmen.
Kommen wir zurück zu Ihren Versprechungen hinsichtlich der Familienförderung. Ja, sie ist kompliziert, sie ist undurchsichtig. Sie ist bürokratisch. Alles, was Sie machen, ist Stückwerk. Einfach auf die bestehende Ungerechtigkeit - dass diejenigen, die mehr haben, mehr bekommen, und dass diejenigen, die weniger haben, weniger bekommen - etwas draufzulegen, wie uns das die Linke vorschlägt - einfach etwas hinzufügen, dann ist das Ganze schon gerecht -, macht die Sache eben nicht gerechter. Vielmehr manifestiert das die Ungerechtigkeit.
Wir haben gute Ideen und gute Erkenntnisse. Wir haben auch gute Strukturvorschläge auf dem Tisch liegen, wie man ein gerechtes Familienfördersystem aufbauen kann. Dazu gehört es auch, darüber zu reden, wie wir besser Kinder und nicht den Trauschein fördern können.
Das Ehegattensplitting, Herr Singhammer, ist unser Lieblingsproblem. 60 Prozent der Familien bekommen heute nichts, keinen einzigen Cent durch das Ehegattensplitting. Sie bekommen nichts, weil sie nicht verheiratet sind.
Wir reden über Eltern, die beide arbeiten müssen, um überhaupt über das Existenzminimum zu kommen, die Geringverdiener. Wir reden nicht über die Großverdiener. Nur 5 Prozent der Haushalte im gesamten Osten profitieren vom Ehegattensplitting, aber 95 Prozent im Westen mit Schwerpunkt Süden. Das Ehegattensplitting ist überholt.
Lassen Sie uns doch endlich die Kinder und nicht den Trauschein fördern.
Sie machen hier nur Symbolpolitik. Sie halten hier Ihre Ideologien hoch. Sie behalten damit Ihre Scheuklappen. Die Realität ist, dass Menschen, die Kinder erziehen, alleine gelassen werden, dass wir durch Transfers den Trauschein fördern und unsere Kinder dabei zu kurz kommen. 60 Prozent der Familien bekommen durch das Ehegattensplitting keinen Cent mehr. Weg damit! Seien Sie mutig! Stehen Sie zu den Kindern, allerdings nicht nur mit warmen Worten, indem Sie immer wieder betonen, dass wir uns alle einig sind, wie wichtig Kinder sind!
Ich bin Mutter von zwei Kindern. Ich bekomme sehr wohl mit, wie das Leben ist. Dafür brauche ich nicht meine Nachbarn und Nachbarinnen. Ich kann Ihnen sagen: Die Eltern in diesem Land setzen sich für ihre Kinder ein, auch dann, wenn sie erwerbstätig sind.
Sie möchten nicht auf große Almosen angewiesen sein. Für diese Familien, Herr Singhammer, brauchen wir Antworten. Für diese Familien haben Sie aber keine Antworten.
Sie verschenken die Chance, echte Reformen auf den Weg zu bringen. Sie verschenken die Chance, die Zukunft unserer Kinder zu verbessern. Dabei geht es um die Zukunft jedes einzelnen Kindes. Es geht nicht nur um die Kinder von Frau Meier und Frau Müller,
sondern auch um die Kinder von Frau Öztürk. Es geht um alle Kinder. Hier haben wir eine Verpflichtung und sind in der Bringschuld. Das, was Sie machen, ist aber nur Symbolpolitik und hat mit der Realität der Familien gar nichts zu tun.
Danke schön.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Die Kollegin Ingrid Arndt-Brauer ist die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion.
Ingrid Arndt-Brauer (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Heute Morgen ging es ein bisschen kreuz und quer. Deswegen versuche ich, ein wenig Systematik in unsere Diskussion zu bringen.
Bevor wir diesen Gesetzentwurf formuliert haben, wurde auch in unserer Partei - aber natürlich nicht nur dort - über die grundsätzliche Frage diskutiert: Sollte man jetzt eine Kindergelderhöhung vornehmen, oder sollte man lieber Geld in die Infrastruktur stecken? Ich persönlich denke, es muss ein Sowohl-als-auch geben. Denn alle, die seit der letzten Kindergelderhöhung im Jahre 2002 Kinder erzogen haben, wissen, dass das Leben mit Kindern seitdem teurer geworden ist. Deswegen ist es wichtig, das Kindergeld zu erhöhen.
Natürlich brauchen wir auch mehr Investitionen in die Infrastruktur. Allerdings haben wir auf diesem Gebiet in dieser Legislaturperiode schon eine Menge angestoßen, und wir werden noch mehr tun.
Ich möchte auf eine Argumentation eingehen, die mir häufig begegnet und die auch heute von den Kollegen der Linken vorgetragen wurde. Sie argumentieren nach dem Motto: Den Banken habt ihr 500 Milliarden Euro gegeben. Gebt doch auch den Familien ein paar Milliarden Euro mehr!
Wir alle hoffen, diese 500 Milliarden Euro nie auf den Tisch legen zu müssen. In diesem Betrag sind Bürgschaften und andere Absichtserklärungen enthalten, diese Tatsache müsste mittlerweile in diesem Hohen Hause bekannt sein. Jetzt können wir nicht einfach sagen: Wir nehmen davon mal eben 12 Milliarden Euro weg. Dieses Geld geben wir dann den Familien, und die Banken bekommen ein bisschen weniger. Wir dürfen diese Themen nicht vermischen. Eine verantwortungsvolle Familienpolitik hat auch mit Haushaltskonsolidierung zu tun. Dieses Ziel müssen wir bei allem, was wir tun, immer im Auge behalten.
Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass die meisten Eltern - ich hoffe, über 95 Prozent - das Geld, das sie für ihre Kinder bekommen, auch für ihre Kinder ausgeben;
davon bin ich fest überzeugt, und das möchte ich betonen.
Die Diskussion darüber, dass eine Verrechnung mit den Hartz-IV-Regelsätzen stattfindet, möchte ich nicht vertiefen. Denn im Rahmen von Hartz IV gibt es Regelsätze, die unabhängig vom Kindergeld gelten. Wenn man der Meinung ist, dass sie zu niedrig bzw. falsch bemessen sind und dass die Inhalte nicht stimmen, kann man darüber an anderer Stelle reden. Das hat aber nichts mit dem Kindergeld zu tun. Wir wissen, dass Hartz-IV-Familien ein Äquivalent zum Kindergeld bekommen. Deswegen kann man ihnen diese Erhöhung nicht obendrauf geben.
- Das finde ich nicht unlogisch. Bei Gelegenheit kann ich Ihnen das einmal genauer erklären.
Im SPD-Programm steht - das ist auch unser Wille -: Jedes Kind sollte dem Staat gleich viel wert sein. Das ist schön und hört sich gut an. Aber die Systematik ist eine andere. Das Bundesverfassungsgericht hat uns vorgegeben, dass wir das Existenzminimum steuerfrei stellen müssen.
Das Existenzminimum folgt der Sozialhilfe plus Wohnkosten, die vom Bauministerium festgelegt werden; diese Definition ist wichtig. Das Ganze ist ein Freibetrag; meine Kollegin hat schon kurz auf die Systematik eines Freibetrags hingewiesen.
Ein Freibetrag auf 6 000 Euro bzw. 6 024 Euro - an dieser Stelle werden wir wahrscheinlich nachbessern müssen - bedeutet bei einem Steuersatz von 45 Prozent, der für die ganz Reichen in Deutschland gilt, einen Vorteil von 225 Euro. Bei einer Steuerbelastung in Höhe von 42 Prozent bedeutet dieser Freibetrag einen Vorteil von 210 Euro.
Jetzt existiert eine Schere, die uns als SPD, aber ich denke, auch vielen anderen, natürlich überhaupt nicht gefällt. Wir erhöhen das Kindergeld für das erste Kind auf 164 Euro. Demgegenüber gibt es im Spitzensteuerbereich einen wesentlich höheren Freibetrag. Die 14 Milliarden Euro, die die Linken irgendwo gefunden und für eine Verwendung vorgeschlagen haben, könnten wir jetzt natürlich noch obendrauf setzen. Wir haben sie bisher aber noch nicht gefunden.
Deswegen befinden wir uns in diesem schizophrenen Zustand, dass wir die Schere auch schließen könnten, wenn wir den Spitzensteuersatz auf 30 Prozent senken würden. Ich warne also alle davor, zu sagen, wir bräuchten höhere Steuersätze, um die Schere schließen zu können. Bei unserer Systematik ist genau das Gegenteil der Fall.
Dieses Problem können wir nicht so einfach lösen.
Ich denke, wir müssen das Kindergeld nach und nach erhöhen. Das ist unser ausdrücklicher Wunsch. Das geht aber nicht von einem Jahr aufs andere und auch nicht innerhalb einer Legislaturperiode. Das sollte aber natürlich unser Interesse sein.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Höll?
Ingrid Arndt-Brauer (SPD):
Ja, natürlich.
Dr. Barbara Höll (DIE LINKE):
Liebe Kollegin, um das noch einmal ganz klar festzuhalten: An die bestehende Systematik, die ja viel Gutes hat, weil es dadurch eine gesicherte Grundlage hinsichtlich der Errechnung der notwendigen Höhe des Existenzminimums für Kinder gibt, darf niemand herangehen. Das ist ein festes Fundament. Wir müssen nur schauen, wie hoch wir das ansetzen.
Auf dieser Basis kann man eine Entlastung natürlich so vornehmen - ich habe nicht umsonst die Familienministerin zitiert -, dass man das höchste Niveau - den Spitzensteuersatz - für alle ansetzt. Das ist in der Systematik nur davon abhängig, was wir wollen. Es kostet mehr Geld. Ich habe die Summe von 6 Milliarden Euro genannt, die letztlich noch notwendig wäre.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Frau Kollegin, eigentlich wollten Sie eine Frage stellen.
Dr. Barbara Höll (DIE LINKE):
Stimmen Sie mir zu, dass das innerhalb des bestehenden Systems sehr wohl möglich und nur eine Frage des politischen Wollens und abhängig von den Finanzen ist?
Ingrid Arndt-Brauer (SPD):
Es ist nur abhängig von den Finanzen. Wenn man das Geld irgendwo findet, dann kann man es natürlich verwenden. Wir haben es bisher aber noch nicht gefunden. Ich fände es Familien und Kindern gegenüber verantwortungslos, das über eine Verschuldung zu regeln.
Zu Herrn Thiele und seinen glatten Zahlen möchte ich sagen: Bei den Lohneinkünften bzw. Einkommen gibt es auch keine glatten Zahlen. Deswegen denke ich, dass die Familien auch mit 164 Euro rechnen und leben können.
- Ginge es auch. Man könnte auch bei Lohnabschlüssen glatte Zahlen vereinbaren und sagen, dass jeder 6 000 Euro
erhält. Das tun wir auch nicht.
Ich denke also, dass das nicht sein muss. Von daher kann das so bleiben.
Als Mutter von vier Kindern finde ich persönlich die Staffelung gut.
Ich weiß, dass das viele anders sehen, aber aus meiner Lebenserfahrung heraus muss ich sagen: Das dritte Kind ist das teuerste.
Ich weiß nicht, wie es mit dem fünften und dem siebten Kind aussieht. Das müsste mir vielleicht die Ministerin sagen.
Ich denke, irgendwann überwiegt in der Familie die Organisationsneigung gegenüber der Konsumneigung. Von daher verschieben sich dann vielleicht auch gewisse haushalterische Gesichtspunkte innerhalb der Familie. Ich persönlich denke aber, dass man mit der Staffelung gut leben kann.
Das Wichtige für uns ist - das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren -, dass es in dieser Gesellschaft einen gewissen Anteil von Menschen gibt, der sich gegen Kinder entscheidet. Das mag gute Gründe haben. Manche hätten auch gerne Kinder, können aber keine bekommen. Deshalb brauchen diejenigen, die eine Familie wollen, Unterstützung dafür, mehr Kinder zu bekommen.
Man muss sie zum dritten Kind ermutigen, sodass sie nicht sagen: Na ja, mit zwei Kindern geht es ganz gut, ab dem dritten Kind brauchen wir aber eine neue Wohnung und ein neues Auto; das ist zu viel. - Ich denke, man muss sie ermutigen und sagen: Wer sich grundsätzlich für Kinder entscheidet, der sollte eine Erleichterung erhalten, damit er die Finanzierung auch bei mehr Kindern noch sicherstellen kann.
Meine Kollegin sagte schon, dass wir 37 Milliarden Euro für Kindergeld und Kinderfreibeträge ausgeben. Man kann sich immer mehr wünschen, was man sich aber vor allen Dingen wünschen sollte, ist, dass auch die Länder ihre Verantwortung wahrnehmen. Ich denke, Lehrmittelfreiheit, kostenlose Nutzung der Schulbusse und auch das Essen in der Schule sind keine originären Bundesangelegenheiten. Das müssen wir immer wieder einfordern.
So wünschenswert es ist, dass wir das alles hier zentral regeln: Andere Dinge dürfen wir auch nicht zentral gestalten. Solange noch jeder selber seine Fremdsprachen festlegt, sollte er auch dafür sorgen, dass in den Schulen einigermaßen gute Zustände herrschen.
Ich bin - ganz im Gegensatz zu Frau Höll - der Meinung, dass nicht nur die Bürgerinnen und Bürger am Starnberger See, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern profitieren, wenn wir haushaltsnahe Dienstleistungen absetzbar machen. Es geht nicht immer nur um das Dienstmädchen, das in irgendeiner Form von Ihnen vorgeführt werden muss,
sondern auch um eine Entlastung der Familien, die vielleicht dazu führt, dass beide Elternteile arbeiten können. Wenn man sich eine Dienstleistung kaufen kann, die man steuerlich absetzen kann, dann geht es nicht darum, angenehm in der Sonne zu liegen. Vielmehr bringt es häufig Familien aus der Armut heraus, wenn beide Elternteile arbeiten können. Das möchte ich noch einmal festhalten.
Meiner Meinung nach gibt es nämlich keine Kinderarmut, sondern nur Familienarmut. Kinder sind nicht selber arm und ihre Familie nicht. In einem solchen Fall ist die gesamte Familie in einer schwierigen Situation, aus der wir ihr heraushelfen müssen, indem beide Elternteile in die Lage versetzt werden, dazuzuverdienen, wenn ein Einkommen nicht reicht. Dann ist es nötig und sinnvoll, sich entsprechende Dienstleistungen zu kaufen.
Alles in allem ist der Gesetzentwurf in einer ausgewogenen Form vorgelegt worden. Wir haben ein paar Kritikpunkte, die ohne Frage geändert werden müssen. Die Förderung bestimmter Zielgruppen kann nicht nach zehn Jahren aufhören. Das ist völlig klar. Aber wir sind im Gesetzgebungsverfahren und werden noch einige Änderungen vornehmen.
Wir freuen uns auf die Diskussion mit Ihnen. Ich denke, als Vorlage kann man mit dem Gesetzentwurf gut leben.
Ich danke Ihnen.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält nun die Kollegin Ina Lenke für die FDP-Fraktion.
Ina Lenke (FDP):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Als erstes möchte ich das Wort an meine Vorrednerin richten. Dass gerade eine SPD-Kollegin von einem Dienstmädchen spricht, wundert mich sehr.
Ich habe eine Hilfe im Haushalt und bin sehr froh darüber, dass sie qualifizierte Arbeit macht.
Nun komme ich zum Gesetzentwurf. ?Investitionen in Familie sind Investitionen in die Zukunft?, heißt es einleitend im Gesetzentwurf. Das ist sicherlich eine treffende Formulierung. Befasst man sich aber mit den Inhalten, dann wird deutlich, dass nur sehr wenig für Investitionen in Familie vorgesehen ist, etwa die 10 Euro Kindergelderhöhung. Mein Kollege Carl-Ludwig Thiele hat bereits darauf hingewiesen, dass die letzte Kindergelderhöhung 2002 erfolgt ist.
Fakt ist: Die Große Koalition - und damit auch die SPD - zieht weiterhin den Familien das Geld aus der Tasche.
Die Mehrwertsteuererhöhung, von der Sie im Parlament nicht gerne hören, spüren wir Tag für Tag, und auch die Familien spüren die Mehrwertsteuererhöhung Tag für Tag. Denn am Ende des Monats ist bei Familien, die rechnen müssen, nichts mehr in der Tasche.
Ich möchte mich nun der CDU zuwenden. Im Sommer vor einem Jahr haben Herr Pofalla und auch Sie von der CDU in einem Zehnpunkteprogramm versprochen, dass Sie die Mehrwertsteuer auf Pampers von 19 Prozent auf den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent senken wollen.
Was ist eigentlich daraus geworden? Haben Sie das mit der SPD besprochen?
Was Sie mit der SPD besprochen haben, ist, dass die Skiliftbetreiber nur noch 7 Prozent statt bisher 19 Prozent auf ihre Umsätze zahlen müssen. Das ist eine tolle Leistung.
Aber wenn wir von der FDP seit Jahren einen Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent für Windeln fordern, dann sind Ihre Ohren verschlossen.
Bei der Diätenerhöhung waren Sie mit den Entscheidungen schneller als der Schall. Da ging alles ganz schnell. Insofern bitte ich darum, dass Sie sich der Mehrwertsteuerermäßigung noch einmal widmen.
Weil die Ministerin dankenswerterweise anwesend ist und wir das Thema sonst nur im Ausschuss problematisieren, möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen zu sagen, dass alles, was Sie mit Ihren Gesetzen machen, Stückwerk ist. Denn Sie haben die 153 ehe- und familienbezogenen Leistungen in der Bundesrepublik Deutschland mit einem Volumen von 185 Milliarden Euro bisher noch nicht evaluiert. Sie haben das die ganze Zeit angekündigt. Im Ausschuss wurde aber gesagt, dass die Fraktionen das selber machen können. Es gibt keine kritische Bewertung der ehe- und familienbezogenen Leistungen. Sie geben hier und da ein bisschen mehr. Aber das reicht nicht, um Familienpolitik aus einem Guss zu gestalten. Das haben Sie in dieser Legislaturperiode nicht geschafft.
Da ich nur noch eine Minute Redezeit habe, will ich ganz kurz auf die Kinderbetreuungskosten zu sprechen kommen. Keiner von Ihnen hat gesagt, dass die Kinderbetreuungskosten, wenn der Mann und die Frau oder Alleinerziehende arbeiten gehen, nur zu zwei Drittel von der Steuer abgesetzt werden können. Das kann ich, die ich Steuerfachangestellte bin, mir überhaupt nicht erklären. Warum sollen wir Frauen, die wir arbeiten gehen, ein Drittel der Kinderbetreuungskosten selbst tragen? Das muss in diesem Gesetz unbedingt geändert werden. Das wird eine Forderung der FDP sein.
Mein Fazit lautet: Das Steuerrecht bleibt weiter kompliziert. Die Kindergelderhöhung ist unzureichend. Weiterhin pflegen Sie von der Großen Koalition das Prinzip ?Rechte Tasche, linke Tasche?. Die Familien in der Bundesrepublik Deutschland werden erst durch eine neue Regierung in der nächsten Legislaturperiode wirklich entlastet werden.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält nun die Kollegin Patricia Lips für die CDU/CSU-Fraktion.
Patricia Lips (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zurzeit wird in diesem Haus über zahlreiche Maßnahmen auf allen Politikfeldern diskutiert, Maßnahmen, die vor allem in naher Zukunft oder mittelfristig unserem Land helfen sollen. Die Finanzmarktkrise hat die Realwirtschaft erreicht. Nahezu alle davon betroffenen Länder rüsten sich richtigerweise für die kommende Zeit. Der Fokus zahlreicher Maßnahmen richtet sich natürlich auf den wirtschaftlich-finanziellen Bereich; das ist auch richtig. Jede Maßnahme verdient es, dass man ihr die nötige Aufmerksamkeit schenkt.
Frau Höll, gestatten Sie mir, auf das Beispiel von Frau Beyer zurückzukommen. Sie sagten, dass diese Frau gut und zuverlässig arbeitet. Das freut uns, und wir unterstützen sie dabei. Wir bedauern aber, dass die Maßnahmen, die im Rahmen des Paketes zur Stabilisierung des Finanzmarktes getroffen wurden, immer wieder angeführt werden, um bestimmte Positionen und Bereiche in unserer Gesellschaft gegeneinander auszuspielen. Das ist nicht richtig; das ist falsch. Die Maßnahmen zur Stabilisierung des Finanzmarktes dienen auch dazu, dass das Unternehmen, bei dem Frau Beyer arbeitet, in Zukunft die benötigten Kredite und Aufträge bekommt. Damit wird der Arbeitsplatz von Frau Beyer nachhaltig gesichert. Leider vergessen Sie das immer in Ihren Ausführungen. Deshalb ist es doppelt wichtig, das an dieser Stelle zu sagen.
Wir begrüßen die Ziele, die mit dem vorliegenden Leistungsgesetz für Familien erreicht werden sollen. Es sind ganz besonders die Familien, die das Fundament einer stabilen Gesellschaft bilden. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dürfen und wollen wir sie nicht am Rande stehen lassen. Auch deshalb ist dieses Gesetz so wichtig. Leistungen für Familien sind immer auch Investitionen in die Zukunft. Mit dem Leistungsgesetz für Familien wollen wir - wir hörten das bereits - einen sehr erfolgreichen Weg fortsetzen. Elterngeld, erweiterter Kinderzuschlag, ausgeweitete Betreuungsangebote, Kindertagesstätteneinrichtungen, Ganztagsschulen und soziale Frühwarnsysteme, dies sind nur einige Marksteine der jüngeren Vergangenheit. Kritik daran wird es immer geben, hier und draußen. Man kann es nicht immer allen recht machen. Aber es wird kaum jemand bestreiten, dass innerhalb kurzer Zeit viele Maßnahmen auf den Weg gebracht wurden. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir heute weitergehen.
Die Erhöhung des Kinderfreibetrages ist - wir hörten schon mehrfach davon - ein richtiger und vor allem ein verfassungsrechtlich notwendiger Schritt. Die Erhöhung des Kindergeldes sieht eine Staffelung vor, bei der Mehrkindfamilien besonders berücksichtigt werden. 4,5 Millionen Kinder leben in solchen Familien. Es gibt zudem Sonderzahlungen zum Schulbesuch, ein ganz neues Element. Die Förderung von haushaltsnaher Beschäftigung und Dienstleistung soll ausgebaut bzw. vereinfacht werden.
Was wollen, was können wir mit diesen Maßnahmen bewirken? Ich möchte das an dieser Stelle in drei Punkten zusammenfassen.
Erstens: die finanzielle Entlastung und Unterstützung von Familien mit Kindern. Wir wollen wirtschaftliche Stabilität schaffen bzw. ausbauen. Vor allem kinderreiche Familien sowie Familien mit mittleren und unteren Einkommen brauchen häufig verstärkt die Hilfe der Gemeinschaft. An dieser Stelle möchte ich aus der aktuellen Debatte heraus die Gelegenheit nutzen, um auf etwas hinzuweisen. Der Regelsatz im SGB II ist von 2002 bis heute für Kinder bis sechs Jahre um 30 Prozent gestiegen.
Wenn wir die Diskussion hier führen, dann sollten wir sie auch komplett führen. Deshalb ist es wichtig, dass das noch einmal an dieser Stelle gesagt wurde.
Zweitens: eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Die Anforderungen sind gestiegen. Wir selbst fordern eine erhöhte Flexibilität am und für einen Arbeitsplatz. Gleichzeitig brauchen wir auch Frauen, die in Kontinuität und ohne ständigen Druck an der Arbeitswelt teilhaben können. Nicht nur Kindererziehung, auch die Pflege von Angehörigen spielt eine immer größere Rolle. Sie hat unmittelbaren Einfluss auf die Gestaltung einer Gemeinschaft, einer Familie. Oft geschieht dies nicht geplant, sondern in tragischen Fällen werden die Familien völlig unvorbereitet davon betroffen.
Drittens. Insbesondere die steuerliche Förderung von haushaltsnaher Beschäftigung und Dienstleistung soll neben der Erleichterung einer eigenen, individuellen Lebensplanung auch dazu beitragen, die Ausschöpfung eines großen Potenzials zum Beschäftigungsaufbau voranzubringen. Der private Haushalt soll noch mehr als bisher zu einem Auftraggeber werden können und zur Schaffung von legalen Beschäftigungsverhältnissen beitragen.
Wenn wir die Debatte heute verfolgt haben, dann stellen wir fest - gestatten Sie mir, dass ich das so sage -, dass wir in der eher komfortablen Situation sind, dass wohl nahezu jeder hier im Haus die grundsätzliche Stoßrichtung aller Maßnahmen begrüßt. Dabei gibt es natürlich nichts, auch nichts Gutes, was man nicht noch besser machen könnte - selbstverständlich. Viele Dinge wurden hier genannt, und es gibt immer jene, die ein Mehr an Leistung fordern. Wie immer wird es so sein, dass nicht alles erfüllt werden kann. Doch wir stehen am Anfang der Diskussion, und ich bin mir sicher, dass wir für vieles Regelungen finden werden.
Kindererziehung ist und bleibt Sache der Eltern. Der Staat, die Gemeinschaft aller, unterstützt dabei vielfältig und schreitet dort ein, wo Eltern nicht allein zum Wohl ihrer Kinder handeln können oder wollen. So soll es sein. Kinderfreundliche Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen, ist aber nicht nur eine Aufgabe des Deutschen Bundestages, sondern wir sind auf allen Ebenen dazu verpflichtet, Regelungen zu finden. Das ist nicht allein eine politische Aufgabe, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Wir wollen diese Leistungen zur Unterstützung hier und heute an einer weiteren Stelle ergänzen. Das Ganze soll bereits im Januar in Kraft treten. Ich freue mich auf Ihre Mithilfe und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält der Kollege Swen Schulz für die SPD-Fraktion.
Swen Schulz (Spandau) (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf für ein Familienleistungsgesetz setzt sehr gute Signale. Es geht um stärkere Unterstützung für Familien, und es geht um gesonderte Hilfe für bedürftige Schülerinnen und Schüler, weil wir auch nach denen schauen, die von der Kindergelderhöhung nicht profitieren werden. Tatsächlich haben wir ein schwerwiegendes Problem im Bildungswesen. Die PISA-Studien zeigen deutlich, dass in keinem Industriestaat der Welt Kinder aus armen und bildungsfernen Familien so schlechte Bildungschancen haben wie in Deutschland. Der nationale Bildungsbericht 2008 hat zum Beispiel festgestellt, dass die Kinder von Beamten mit Hochschulabschluss zu 95 Prozent studieren, dass es aber nur 17 Prozent der Arbeiterkinder bis an die Hochschule schaffen. Dabei wissen wir, dass die Kinder nicht dümmer oder klüger geboren werden. Nein, es sind die gesellschaftlichen Bedingungen, die Bildungschancen ermöglichen oder eben auch verbauen. Dagegen müssen wir etwas tun. Wir wollen optimale Unterstützung und Chancengleichheit für alle in der Bildung.
Darum ist es so wichtig, dass wir in Bildungseinrichtungen investieren, wie wir es etwa unter Rot-Grün mit dem Ganztagsschulprogramm und dem Tagesbetreuungsausbaugesetz oder wie wir es auch in der Großen Koalition mit dem Kinderförderungsgesetz getan haben. Darum wollen wir auch Familien, die nicht so viel Geld haben, unterstützen: damit sie für die Kinder Schulbedarf kaufen können, also Ranzen, Hefte, Füller usw. Das ist ein guter Beitrag dazu, dass Kinder aufgrund der Arbeitslosigkeit ihrer Eltern im schulischen Leben nicht benachteiligt werden. Ich will einmal sagen: Es ist die SPD gewesen, die das initiiert hat, die das in der Koalition durchgeboxt hat.
Ohne den Impuls von Franz Müntefering schon vor einiger Zeit hätte es das nicht gegeben.
Aber wir wollen noch mehr erreichen, als in diesem Gesetzentwurf vorgeschlagen wird. Mir ist vollkommen unklar, warum die CDU/CSU in den Koalitionsverhandlungen darauf bestanden hat, dass dieses Schulbedarfspaket zeitlich begrenzt wird, es also nur bis zur zehnten Klasse in Kraft gesetzt wird. Warum nicht auch bis zum Abitur?
Will die Union nicht, dass Bedürftige Abitur machen? Um das Geld kann es an dieser Stelle ja nicht gehen.
Auch der Bundesrat kann das übrigens nicht nachvollziehen. In seinem Beschluss bezeichnet er diese Begrenzung als - Zitat - ?sachlich nicht gerechtfertigt? und ?kontraproduktiv?. Das ist eine finanzielle Benachteiligung derjenigen, die einen höheren Bildungsabschluss anstreben, und widerspricht der Zielsetzung, mehr und bessere Bildung zu ermöglichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU/CSU, ich bitte Sie herzlich: Das kann so nicht bleiben. Geben Sie sich einen Ruck und stimmen Sie einer Änderung zu!
Uns ist klar, dass durch dieses Gesetz nicht alle Probleme gelöst werden. Die SPD will weitere, größere Schritte gehen. Wir wollen einen eigenständigen Regelsatz für Kinder, deren Eltern arbeitslos sind. Bislang wird der Bedarf für Kinder so festgelegt, als ob sie kleine Erwachsene wären. Das bedeutet, dass sie dann, abhängig vom Alter, 60 oder 80 Prozent dessen bekommen, was Erwachsenen zugestanden wird, mit dem Effekt, dass Kinder etwa für Alkohol und Tabak Geld bekommen, nicht aber für Bildung und kindgerechte Dinge. Ich glaube, da müssen wir noch einmal heran. Das kann so nicht bleiben.
Darüber hinaus wollen wir die Gebührenfreiheit der Kitas genauso wie der Hochschulen. Auch das Mittagessen in den Kitas und in den Schulen sollte für die Eltern kostenfrei sein. Ein Schüler-BAföG ist sinnvoll. Wir wollen gute Bildung für alle ermöglichen. Das ist wichtig für unsere Volkswirtschaft. Das ist aber vor allem ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit. Dafür stehen wir ein.
Der Gesetzentwurf ist ein Schritt in die richtige Richtung. Lassen Sie uns aber noch mutiger sein. Es gibt Gelegenheiten im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens; die Kollegin Lips hat darauf hingewiesen. Ich werte das als Signal dafür, dass mit der CDU/CSU darüber noch geredet werden kann. Ich glaube, dann wird es noch ein richtig gutes Gesetz.
Herzlichen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt ist die Kollegin Ingrid Fischbach, CDU/CSU-Fraktion.
Ingrid Fischbach (CDU/CSU):
Herr Präsident! Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich könnte fast wie immer nach solchen Debatten hier im Deutschen Bundestag sagen: Viel Lärm um nichts.
Ich würde mich freuen, wenn Sie von der Opposition - jetzt schaue ich auch die rechts sitzende FDP an - uns einmal attestieren würden: In den letzten Jahrzehnten ist für die Familien nie so viel wie in den letzten drei Jahren getan worden.
Frau Deligöz, Sie stellen sich hierhin und sagen: 10 Euro mehr, das ist mager. - Ich schaue einmal zurück auf die Zeit, in der Sie in der Regierungsverantwortung waren: Sie haben 2002 zum letzten Mal das Kindergeld erhöht. Man könnte vermuten, das hätten Sie getan, weil Sie die Probleme der Familie erkannt hätten.
Aber ich möchte noch einmal darauf hinweisen: Es war das Verfassungsgerichtsurteil von 1998, das sich eindeutig zur Kinderbetreuung geäußert hat.
Im November 1998 kam das Urteil, und daraufhin haben Sie 2000 reagiert, aber nicht, weil es Ihnen ein Grundbedürfnis war.
Man muss noch einmal sagen, dass dies eine Reaktion war.
Seit 2002 ist nichts mehr geschehen. Obwohl Ihnen das Thema Armut immer so wichtig ist, haben Sie nicht erkannt, dass gerade Familien mit drei und mehr Kindern ein erhöhtes Armutsrisiko tragen. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir jetzt ein gestaffeltes Kindergeld nach vorn bringen.
Darauf sind wir stolz, und wir können es mit Recht sein.
Frau Höll, ich bin jedes Mal sprachlos, wenn die Linke hier steht und suggeriert, sie wolle das Beste für das Volk.
Sie reden über Eckregelsätze, die man erhöhen müsse, und davon, dass wir die Sätze viel zu niedrig ansetzten. Sie wissen aber, wie wir sie auf Bundesebene berechnen: Die sozialrechtlichen Eckregelsätze werden von den Landesregierungen bestimmt; daraus berechnen wir das Mittel.
Ich habe einmal nachgesehen, was Sie in Berlin machen, wo Sie regieren und entsprechende Möglichkeiten haben. Es müsste Ihnen doch ein Grundanliegen sein, gerade die Eckregelsätze derjenigen Menschen, für die Sie sich hier so stark machen, so zu erhöhen, dass sie davon profitieren. Sie haben jedoch genau die gleichen Regelsätze wie die anderen Bundesländer auch, nicht einen Euro mehr. Daran müssen Sie sich messen lassen. Sie sollten sich nicht hier hinstellen und so tun, als ob Sie etwas änderten. Machen Sie es vielmehr da, wo Sie in der Verantwortung sind! Da können Sie etwas verändern, und da sollten Sie es auch tun.
Meine Damen und Herren, ich will noch einmal verdeutlichen, dass wir nicht nur mit der jetzt vorgesehenen Erhöhung des Kindergeldes und des -freibetrages ein deutliches Zeichen setzen, sondern dass während der letzten drei Jahre einige Dinge als Leistung der großen Koalition auf den Weg gebracht wurden, die gerade den Familien zugutekommen. - Der Präsident blinkt schon?
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nein, ich wollte nur fragen, ob Sie bereit sind, eine Zwischenfrage der Kollegin Höll zu beantworten.
Ingrid Fischbach (CDU/CSU):
Nein, heute nicht. Ich mache es sonst immer gern, aber ich möchte es nicht.
- Ich möchte es heute nicht. Nein, regeln Sie das in Berlin! Da haben Sie eine Menge zu tun, und wir reden jetzt hier weiter.
Wir haben, wie gesagt, einiges auf den Weg gebracht, was gut und richtig ist. Wir haben nicht nur das Elterngeld eingeführt, wir haben nicht nur den Ausbau der Kinderbetreuung auf den Weg gebracht.
Wir haben beim Kinderzuschlag - jetzt beziehe ich mich auf die zweite Gruppe, die stark von Armut betroffen ist - die Alleinerziehenden noch einmal ganz besonders in den Fokus genommen und die Absicht bekundet, dass hier eine Verbesserung gerade für sie erfolgen soll. Das haben wir auch getan, und deshalb, Frau Westrich, habe ich die Aussage in Ihrer Rede nicht verstanden - das muss ich jetzt doch einmal kritisch sagen -, dieses Gesetz habe allein die SPD auf den Weg gebracht.
Ich glaube, wir waren durchaus wichtig und haben uns an einigen Stellen sehr deutlich bemerkbar gemacht.
Ich komme noch einmal zum Stichwort ?haushaltsnahe Dienstleistungen?. Ich bin zwar schon etwas älter, aber mein Gedächtnis ist noch sehr gut. Ich kann mich erinnern, dass unsere ersten Vorschläge gerade von Ihnen immer mit der Bemerkung abgetan wurden, das sei eine Unterstützung der gut- und besserverdienenden Familien.
Heute stellen Sie sich hier hin und sagen, das sei das, was die SPD immer gewollt habe. Das hätten wir dann schon viel eher haben können.
Uns hatten Sie da immer auf Ihrer Seite, und Sie werden uns dabei immer auf Ihrer Seite haben.
Gerade damit wollen wir nicht nur erreichen, die Familien in finanzieller Hinsicht besserzustellen, bessere Betreuungsangebote vorzuhalten - und jetzt kommt der Dreiklang, den die Ministerin sehr gut auf den Weg gebracht hat -; vielmehr wollen wir auch dafür sorgen, dass Eltern wieder mehr Zeit für ihre Kinder haben. Wenn wir wollen - dies ist gerade auch in Ihrer Partei, Frau Westrich, ein großer Wunsch -, dass die Frauen nach der Geburt eines Kindes ganz schnell in den Beruf zurückkehren, dann müssen wir Ausgleichsmöglichkeiten schaffen, damit die Eltern, wenn beide berufstätig sind, Zeit für die Kinder haben. Sie haben sie nur dann, wenn sie bestimmte Aufgaben auslagern können.
Deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir ein deutliches Signal setzen, indem wir sagen: 20 Prozent der Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen sind von der Steuerschuld absetzbar, und dies mit der Obergrenze von 20 000 Euro. Das ist ein richtiges, wichtiges und deutliches Signal, und ich bin ich auch dem Finanzminister sehr dankbar, dass er dem Ganzen zugestimmt hat.
Meine Damen und Herren, ich kann nur noch einmal deutlich machen, dass wir in den letzten drei Jahren eine Menge auf den Weg gebracht haben. Ich habe das auch anhand dessen feststellen können, wie oft ich in dieser Legislaturperiode im Vergleich zu den letzten geredet habe. Da ich immer für die Familienpolitik zuständig war, kann man das gut vergleichen. Es ist eine deutliche Steigerung; das können Sie im Internet nachlesen.
Das zeigt einfach, dass wir sehr viele Themen besetzt haben, die Familien betreffen, und dass wir Dinge auf den Weg gebracht haben.
Wir haben auch geschafft - das freut mich noch mehr -, dass unsere Debatten im Plenum des Deutschen Bundestag zur Kernzeit stattfinden. Das war früher nicht üblich. Auch dafür ein Dankeschön. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wir die Familien ernst nehmen.
Frau Ministerin, wir sind auf einem guten Weg. Wir begleiten Sie weiterhin; denn das tun wir für die Familien in Deutschland.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Um die zu Recht hervorgehobene Bedeutung dieses Themas zu unterstreichen, gestattet das Präsidium jetzt noch eine Kurzintervention, und zwar der Kollegin Höll.
Ich mache aber noch einmal darauf aufmerksam, dass wir aus guten Gründen keinen Rechtsanspruch auf Kurzinterventionen haben. Schon gar nicht gibt es eine Regelung, nach der die Abgeordneten, die in der Debatte ohnehin zu Wort gekommen sind, sich anschließend in Form von Kurzinterventionen zusätzliche Redezeit verschaffen.
Frau Kollegin Höll.
Dr. Barbara Höll (DIE LINKE):
Herr Präsident, ich danke Ihnen. - Ich möchte auch nur ganz kurz auf den gegen mich erhobenen Vorwurf bezüglich Berlins reagieren.
Erstens. Frau Kollegin, Sie sollten hier nicht so tun, als ob der rot-rote Senat für die prekäre Haushaltssituation von Berlin verantwortlich wäre. Dafür trägt vor allem die Berliner CDU die Verantwortung. Stehen Sie gefälligst dazu!
Zweitens. Wenn Sie hier solche Vorwürfe erheben, sollten Sie sich vielleicht doch etwas gründlicher informieren. Berlin regelt die Wohnkostenübernahme für Hartz-IV-Empfängerinnen und -Empfänger und damit auch für ihre Kinder in der großzügigsten Art und Weise. Das Berliner Modell ist das beste Modell, das wir derzeit in der Bundesrepublik haben - und das trotz der angespannten Haushaltssituation. Berlin tut in dem sehr engen Rahmen, den es hat, das Bestmögliche.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird die Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 16/10809 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse und zusätzlich an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung vorgeschlagen. Gibt es anderweitige Vorschläge? - Das ist nicht der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen.
Ich rufe nun die Tagesordnungspunkte 16 a und 16 b auf:
a) Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente
- Drucksache 16/10810 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f)
Rechtsausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96
GO
b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Kornelia Möller, Dr. Barbara Höll, Werner Dreibus, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE
Arbeitslosenversicherung stärken - Ansprüche sichern - Öffentlich geförderte Beschäftigte einbeziehen
- Drucksache 16/10511 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f)
Rechtsausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
- Sobald die notwendige Aufmerksamkeit für die gemeldeten Redner hergestellt ist, können wir fortfahren. - Es wäre auch schön, wenn in der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die offenkundig dringlichen Besprechungen wenigstens im Sitzen stattfinden könnten.
Das Wort hat der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Olaf Scholz.
Olaf Scholz, Bundesminister für Arbeit und Soziales:
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir haben schwierige Zeiten, aber in diesen schwierigen Zeiten gibt es auch gute Meldungen - die müssen besprochen und zur Kenntnis genommen werden -: Das erste Mal seit 16 Jahren ist die Zahl der Arbeitslosen wieder unter 3 Millionen gesunken. Das ist das Ergebnis vieler guter Entwicklungen in der Konjunktur. Das ist das Ergebnis von Entscheidungen, die Unternehmerinnen und Unternehmer getroffen haben. Das ist das Ergebnis der Anstrengungen vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber das ist auch das Ergebnis guter Politik.
Mit den Reformen auf dem Arbeitsmarkt, die wir zustande gebracht haben, haben wir einen Beitrag dazu geleistet, dass die Arbeitslosigkeit schneller zurückgeht, als sie ohne diese Reformen zurückgegangen wäre. Wer das bezweifelt, kann sich jetzt noch einmal neu beim Sachverständigenrat erkundigen. Er hat die Reformen, die wir in der letzten Legislaturperiode begonnen haben, so bewertet: Zum ersten Mal seit langem ist es gelungen, dass die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt mit einem Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit einhergeht. Zum ersten Mal ist es gelungen, dass innerhalb eines Konjunkturzyklus auch insgesamt eine strukturelle Verbesserung festgestellt werden kann. Schließlich ist es nicht mehr so, dass die Arbeitslosigkeit erst dann zurückgeht, wenn das Wirtschaftswachstum über 2 Prozent liegt. Das alles haben wir zustande gebracht. Das muss in diesen Tagen auch einmal gesagt werden.
Warum ist uns das gelungen? Es ist uns gelungen, weil wir uns die Sache nicht so einfach gemacht haben und nicht auf die hereingefallen sind, die einfache Lösungen propagieren: Die einen sagen hier, man müsse den Arbeitsmarkt so organisieren, dass er keine Haltelinien hat, also sozialstaatliche und soziale Regelungen abschaffen, um ihn hochmobil zu halten. Die anderen sagen, man dürfe gar nichts ändern. Wir haben dagegen einen Arbeitsmarkt geschaffen, der unter sozialstaatlichen Rahmenbedingungen hoch funktionsfähig und hochmobil ist. Genau das hat zum derzeitigen Rückgang der Arbeitslosigkeit beigetragen.
Natürlich müssen wir jetzt alles dafür tun, damit es dabei bleibt. Es ist deshalb richtig, dass dem Schutzschirm für die Finanzmärkte auch ein Schutzschirm für den Arbeitsmarkt folgt. Darüber diskutieren wir heute ja auch, nachdem zuvor darüber schon in den Fraktionen und anderen Gremien beraten worden ist. Ich halte das für notwendig. Für ganz besonders notwendig halte ich in diesem Zusammenhang aber die Maßnahmen, die wir im Bereich der Arbeitsmarktpolitik zusätzlich auf den Weg gebracht haben.
So haben wir angesichts der derzeitigen Situation gesagt: Wir verlängern die Dauer des Bezugs von Kurzarbeitergeld. Es wird nicht nur, wie im Gesetz vorgesehen, sechs Monate gezahlt, sondern kann bis zu 18 Monate gewährt werden. Das starke Signal, das davon an die Unternehmen ausgeht, lautet: Haltet an euren Beschäftigten fest!
Entlasst sie nicht, wenn es jetzt Schwierigkeiten gibt, sondern behaltet sie bei euch! Ihr werdet sie schneller wieder brauchen, als ihr denkt!
Wir unterstützen in dieser Situation die Unternehmen mit der Verlängerung der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes. Dies verbinden wir mit einem weiteren Angebot, das wir im Übrigen auch mit Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik auf den Weg gebracht haben. Wir sagen: Qualifiziert, statt zu entlassen! Wir wollen also, dass jemand, der in Kurzarbeit ist, die Möglichkeit hat, sich weiterzuqualifizieren. Dafür werden wir die Voraussetzungen schaffen. Wir wollen aber auch, dass generell in den Betrieben häufiger diese Möglichkeit wahrgenommen wird. Deshalb werden wir für eine umfassende Nutzung des Programms WeGebAU, das wir aufgelegt haben, werben. Wir werden den mittelständischen Unternehmen nahelegen, dafür zu sorgen, dass geringqualifizierte Arbeitnehmer ausgebildet werden, dass sie mehr Qualifikation bekommen und nicht entlassen werden. Wir werden auch dafür sorgen, dass ältere Arbeitnehmer nachqualifiziert werden, sodass sie für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind. Auch das gehört zu den Dingen, die wir jetzt tun.
Im Übrigen werden wir auch dafür Sorge tragen, dass die Zahl der Vermittler bei der Bundesagentur für Arbeit noch einmal ausgeweitet wird. 1 000 zusätzliche Vermittler sollen als Job-to-Job-Vermittler dafür sorgen, dass diejenigen, die in der jetzt rauer und schwieriger werdenden wirtschaftlichen Situation arbeitslos werden und einen neuen Arbeitsplatz suchen, umgehend und intensiv betreut werden können. Das ist ein wichtiges Signal an diejenigen, die in der derzeitigen Situation Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Wir werden sie nicht alleinlassen, sondern sie unterstützen.
Nicht nur mit dem Job-to-Job-Zusatzprogramm, sondern ganz generell ist es schon gelungen, die Zahl derjenigen, die Vermittlungsarbeit leisten, zu erhöhen. So haben wir dafür gesorgt, dass die Zahl der Vermittler bei den Arbeitsagenturen noch einmal erhöht wird, sodass bei den jüngeren Arbeitslosen ein Vermittler 75 Arbeitsuchende betreut und bei den älteren Arbeitslosen ein Verhältnis von 1 : 150 erreicht werden kann. Das sind notwendige Standards, damit Arbeitsuchende in einer schwierigen Situation ihres eigenen Lebens gut unterstützt werden können.
Ich finde, dass wir hier etwas Richtiges auf den Weg gebracht haben, und zwar ganz unabhängig von dem geplanten Konjunkturpaket. Noch deutlicher wird dies, wenn man sich überlegt, wie die Situation früher war. Zu Zeiten der Bundesanstalt für Arbeit waren gerade einmal 10 Prozent der dort Beschäftigten für Vermittlung zuständig. Jetzt ist fast die Situation erreicht, leider noch nicht ganz, dass die Hälfte der Beschäftigten mit Vermittlung befasst ist. Ich will das ausdrücklich sagen, weil ich glaube, dass Vermittlung im Mittelpunkt stehen muss. Wir wollen, dass die Menschen Arbeit finden, dass den Bürgerinnen und Bürgern, die ohne Arbeit sind, Möglichkeiten eröffnet werden, einen Arbeitsplatz zu finden. Das geht nur, wenn wir uns mit vielen Personen, die gut qualifiziert sind, um sie kümmern. Sie müssen, wenn sie eine Agentur, eine Arbeitsgemeinschaft oder ein Jobcenter aufsuchen und Unterstützung brauchen, wissen, dass hier alles für sie getan wird. Das geht nur, wenn sich viele Personen darum kümmern.
Die Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente reiht sich da ein. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass wir nicht im großen Maßstab alles nach Detailhubereien organisieren, sondern dass wir den Arbeitsvermittlerinnen und -vermittlern mehr Flexibilität ermöglichen. Es geht darum, passgenau für jeden Arbeitsuchenden das Richtige zu tun. Das kann nicht funktionieren, wenn wir einen Katalog haben, der so lang ist, dass man allein mit dem Wälzen der Unterlagen möglicher Maßnahmen seine Zeit verbringt. Vielmehr muss es zusammengefasste Instrumente geben. Sie müssen passgenau sein sowohl für den Bereich SGB III als auch für den Bereich SGB II, für die Versicherungskunden und für diejenigen, die Arbeitslosengeld II erhalten.
Zudem muss die Möglichkeit gegeben sein, etwas Neues zustande zu bringen, etwas, das bisher noch nicht darin enthalten war, und zwar nicht erst, nachdem der Deutsche Bundestag einen weiteren Einfall für einen weiteren Paragrafen hatte; diese Handlungsmöglichkeit muss generell gegeben sein. Das ist mit diesem Gesetzentwurf gegeben. Die wachsende Flexibilität und die bessere Unterstützung der Arbeitsuchenden bedeuten einen guten und richtigen Zug, den wir gemeinsam als Koalition voranbringen.
Ich will ausdrücklich sagen, dass es eine gemeinsame Sache ist, dafür Sorge zu tragen, dass die Zahl der Instrumente reduziert wird. Wir betrachten dies nicht als etwas, was man irgendwie machen musste. Es geht vielmehr darum, dass man mit weniger, zusammengefassten, mehr Einzelfallgerechtigkeit ermöglichenden Instrumenten besser vorankommt als mit den Instrumenten, die letztlich nur ein bürokratisches Monster sind. Insofern hoffe ich, dass es für dieses Vorhaben über die Koalitionsfraktionen hinaus Unterstützung gibt.
Lassen Sie mich im Hinblick auf die Instrumente insbesondere auf einen Punkt, der mir wichtig ist, eingehen. Wenn wir uns über die Frage Gedanken machen, wie sich der Arbeitsmarkt der Zukunft entwickeln wird, dann müssen wir uns ganz klar vor Augen halten: Der Arbeitsmarkt der Zukunft ist entweder einer mit genügend Fachkräften und geringer Arbeitslosigkeit oder ein Arbeitsmarkt, in dem es eine nicht ausreichend große Anzahl von Fachkräften und eine hohe Arbeitslosigkeit von nicht qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gibt. Genau hier muss man ansetzen. Es kann nicht sein, dass 500 000 von 3 Millionen Arbeitslosen keinen Schulabschluss haben, die fast alle langzeitarbeitslos sind, und wir nichts dagegen unternehmen. Es kann auch nicht angehen, dass wir wissen, dass die Hälfte der Langzeitarbeitslosen über keinen Berufsabschluss verfügt und wir nichts dagegen unternehmen. Wir müssen mit unseren Möglichkeiten etwas dagegen unternehmen. Nicht alles können wir vom Deutschen Bundestag aus bewegen. Nicht alles können die Arbeitsgemeinschaften und die Agenturen machen. Dass wir es jetzt aber geschafft haben, dass jedem Mann und jeder Frau lebenslang das Recht zugesprochen wird, sich auf den Hauptschulabschluss gefördert vorzubereiten und ihn nachzuholen, das ist ein großer Fortschritt für diese 500 000 Arbeitsuchenden. Es ist aber nicht nur ein großer Fortschritt, sondern auch ein Zeichen für unsere Gesellschaft, dass man sein Leben verbessern kann, wenn man sich Mühe gibt. Darum geht es auch bei dem, was wir hier machen. Ich bin froh darüber, dass dies jetzt möglich geworden ist.
Ebenso werden wir Sorge dafür tragen, dass all diejenigen, die über Sprachprobleme verfügen und deshalb Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben, jetzt unterstützt werden und dies ändern können. Ich glaube, auch das ist eine gute Sache, die wir zustande bringen. Dabei geht es darum, Maßnahmen nicht mal hier und mal dort zu ergreifen, sondern flächendeckend. Auch das wird passieren.
Beide Dinge, die ich hier angesprochen habe, betreffen im Übrigen Maßnahmen, die in der Fläche, vor Ort immer mal wieder ausprobiert worden sind. Das ist mit verschiedenen Instrumenten - manchmal auch mit Instrumenten, die nicht vom Gesetz vorgesehen waren - gemacht worden. Diese Erfahrungen vor Ort in den Arbeitsgemeinschaften, die Experimente, die durchgeführt worden sind, haben wir nicht einfach weiter betrachtet, sondern wir haben gesagt: Das soll nicht Experiment bleiben. Das soll etwas Regelhaftes werden, das für alle Arbeitsuchende überall in Deutschland flächendeckend zur Verfügung steht, also nicht nur dort, wo sich besonders Engagierte darum bemüht haben. Auch das ist ein gesetzgeberischer Fortschritt, den wir jetzt zustande bringen.
Wir wollen Flexibilität erhöhen. Bisher gibt es sie eigentlich nicht. Es gibt derzeit sonstige weitere Leistungen, um ein beliebtes Thema anzusprechen. Diese stehen neben den Instrumenten der Regelförderung zur Verfügung. Sie sind aber oft genutzt worden als eine Möglichkeit zur freien Förderung, als ein Spielraum, etwas zu machen, das bisher keine gesetzliche Grundlage hatte.
Darin unterscheiden sie sich von anderen Instrumenten. Mit dem neuen Gesetz wird es zum ersten Mal im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende eine freie Förderung geben. Dieses Instrument wird neu geschaffen. Es ist richtig, dass der Deutsche Bundestag in Kenntnis der Bedenken des Haushaltsausschusses, der alle Regelungen auf eine rechtlich einwandfreie Grundlage stellen will, sagt: Es soll ein Experimentierfeld geben, auf dem weitere Neuerungen, die wir heute noch nicht kennen, getestet werden können. Nachdem sie vor Ort ausprobiert worden sind, können bewährte Maßnahmen später vielleicht verallgemeinert werden.
Meine Damen und Herren, die Arbeitsmarktpolitik ist gut, wenn sie für die Bürgerinnen und Bürger, die Arbeit suchen, gut ist, wenn die Menschen im Mittelpunkt stehen und eine Chance erhalten, ein besseres Leben zu führen. Darum bemühen wir uns mit diesem Gesetz. Ich freue mich auf den Beginn der Gesetzesberatungen.
Schönen Dank.
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Als nächster Redner hat der Kollege Dirk Niebel von der FDP-Fraktion das Wort.
Dirk Niebel (FDP):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Am Elften Elften 2005 - ich kann nichts für das Datum - hat die Große Koalition den Koalitionsvertrag unterschrieben, in dem festgelegt ist, dass Sie die arbeitsmarktpolitischen Instrumente überprüfen und die Beantwortung der Frage, welche Instrumente sinnvoll sind und welche nicht, bis zum Ende des Jahres 2006 abgeschlossen haben wird. Sie hat vereinbart, dass man spätestens im Jahr 2007 die arbeitsmarktpolitischen Instrumente neu geregelt haben will. Jetzt haben wir den November 2008. Das heißt, drei Jahre sind vergangen, seit vereinbart wurde, die arbeitsmarktpolitischen Instrumente daraufhin zu überprüfen, ob sie sinnvoll sind.
Jetzt legt uns der Bundesminister einen Gesetzentwurf vor, von dem er meint, dass er das Versprechen im Koalitionsvertrag umsetzt.
Das ist mitnichten der Fall. Sie haben die Zeit der guten Konjunktur zwar genossen, aber Sie haben sie nicht genutzt. Sie haben die Zeit verschwendet; denn seit Januar 2006 liegt der Evaluierungsbericht über die Hartz-Reformen I bis III vor. Dies ist nicht ein Bericht der bösen Opposition, sondern ein Bericht der Bundesregierung. In ihm ist die Feststellung enthalten, dass ein Großteil der vorhandenen arbeitsmarktpolitischen Instrumente nicht nur nicht hilft bei der Integration Arbeitsuchender, sondern oftmals den Menschen, die damit ?beglückt? werden, überproportional schadet; denn sie werden teilweise zusätzlich stigmatisiert und daran gehindert, einen Arbeitsplatz zu finden.
Der Bundesarbeitsminister hat versprochen, die Anzahl der Instrumente zu halbieren. Dass er das nicht geschafft hat, verwundert nicht angesichts der Tatsache, dass in der Antwort der Bundesregierung vom 25. Juli - das ist die Drucksache 16/10048 - auf unsere Kleine Anfrage bemerkt wird:
Für die Zählung der Instrumente bzw. Leistungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gibt es in Deutschland kein, zwischen den unterschiedlichen Akteuren bei der Bundesagentur für Arbeit, der Bundesregierung und der Wissenschaft, gemeinsam festgelegtes Konzept.
Das bedeutet übersetzt nichts anderes, als dass die Bundesregierung keine Ahnung hat, wie viele arbeitsmarktpolitische Instrumente es überhaupt gibt. Mit dem jetzt vorgelegten Gesetzentwurf schafft sie zwar 27 vorhandene Instrumente ab, die sie offenkundig gefunden hat, aber sie schafft gleichzeitg fünf neue, die teilweise das beinhalten, was mit den anderen abgeschafft worden ist. So kann man keine Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren. Aber das muss das Hauptziel sein.
Die Bundesagentur versinkt in Bürokratie bei dem Versuch, Einzelfallgerechtigkeit zu gewährleisten. 1,5 Millionen Menschen ohne Arbeitsplatz werden in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen geparkt, ohne in der Arbeitslosenstatistik aufzutauchen.
Das ist versteckte Arbeitslosigkeit, die nur politisch begründet werden kann.
Wenn jemand, der sich mit einem sogenannten 1-Euro-Job etwas hinzuverdienen will, nicht als arbeitslos eingestuft wird, dann ist das absolut unredlich. Wozu dienen diese 1-Euro-Jobs überhaupt? Doch nur dazu - wie auch alle anderen staatlich geförderten Arbeitsverhältnisse, die einen separaten Arbeitsmarkt kreieren -, Menschen, die den Bezug zur Arbeitswelt verloren haben, wieder an den Arbeitsprozess heranzuführen oder auch, um die Arbeitsbereitschaft zu überprüfen.
Aber nur für derartige Fälle kann dieses Instrument genutzt werden. In allen anderen Fällen führt es zu Verwerfungen, Verzerrungen und Mitnahmeeffekten.
Vermittlungsgutscheine sind ein probates Mittel, wenn sie marktgerecht ausgestaltet sind. Die Vermittlungsgutscheine, die die Bundesregierung vorschlägt, sind in der Höhe der Bezahlung nach wie vor nur an der Dauer der Arbeitslosigkeit ausgerichtet. Das Alter, die Qualifikation und mögliche Vermittlungshemmnisse werden überhaupt nicht berücksichtigt. Das ist keine marktgerechte Ausgestaltung. Deswegen gibt es für private, aber nach meinem Dafürhalten auch für staatliche Arbeitsvermittler, die sich durch die Einnahmen aus Vermittlungsgutscheinen refinanzieren könnten, keinen Anreiz, sich tatsächlich um diejenigen zu kümmern, die es am nötigsten hätten. Wir haben ja festgestellt, dass die gute konjunkturelle Situation gerade im Bereich der Sockelarbeitslosigkeit, der Langzeitarbeitslosigkeit keine wirklich durchschlagenden Erfolge brachte.
Die freie Förderung, die Sie bei den Optionskommunen einschränken wollen, preisen Sie hier völlig zu Recht als ein probates Mittel für ortsnahe Lösungsmöglichkeiten. Lassen Sie den Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittlern vor Ort viel Freiraum. Geben Sie ihnen Kompetenz. Engen Sie sie nicht ein. Lassen Sie sie entscheiden, welches Instrument in Passau richtig ist, und zwingen Sie sie nicht, das Instrument zu nehmen, das vielleicht in Rostock wirkungsvoll sein kann.
Wir brauchen auch keinen flächendeckenden Rechtsanspruch auf einen Hauptschulabschluss, auch wenn der Bundesminister dies hier wie eine Monstranz vor sich herträgt. In den Ländern fordert die SPD die Abschaffung der Hauptschule. Hier will sie den Rechtsanspruch auf einen Hauptschulabschluss mit den Mitteln der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der Arbeitslosenversicherung einführen,
während man sich auf der Kultusministerkonferenz zeitgleich darüber berät, ob die Qualitätsstandards bei der Hauptschule abgeschafft werden sollen, weil 50 Prozent der Hauptschulabgänger sie nicht erreichen. Glauben Sie denn im Ernst, dass ein 47-jähriger arbeitsloser Angelernter mit einem Hauptschulabschluss die Chance auf einen neuen und vielleicht auch besseren Arbeitsplatz hat? Das ist weltfremd, das ist Symbolpolitik, die Sie unglaubwürdig macht im Vergleich zu dem Verhalten, das Sie auf Landesebene in der Bildungspolitik zeigen.
Sie haben die Paragrafen zur Mobilitätsförderung gestrichen. Das ist folgerichtig, wenn man sich den Kompromiss zur Erbschaftsteuer anschaut. Wenn ein Kind nur dann erbschaftsteuerfrei im Haus der Eltern wohnen kann, wenn es mindestens zehn Jahre in diesem Haus bleibt, dann braucht es keine Mobilitätsförderung mehr.
Was Sie hier einführen wollen, ist im besten Fall eine Aufforderung zu Melderechtsverletzungen, aber mit Sicherheit nichts, was in einer mobiler werdenden Arbeitswelt dazu führt, dass Menschen, die an einem bestimmten Arbeitsplatz benötigt werden, ihn auch annehmen, dass man Arbeitsplätze mit qualifizierten Leuten besetzen kann, die man benötigt.
Sie sind auch hier auf einem falschen Dampfer. Sie haben die guten Jahre der konjunkturellen positiven Entwicklung nicht genutzt. Sie versteifen sich jetzt auf einen kleinen Randbereich - zugegeben, auf einen notwendigen Randbereich in der Arbeitsmarktpolitik - und suggerieren, dass damit alle Probleme gelöst werden. Arbeitsmarktpolitische Instrumente sind immer nur ein Werkzeugkasten zum Reparieren anderer Fehler. Wir brauchen keine Konjunkturprogramme, bei denen jemand durch 100 Euro weniger Kfz-Steuer motiviert werden soll, ein 30 000-Euro-Auto zu kaufen, sondern wir brauchen Strukturprogramme, die bewirken, dass tatsächlich Arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen werden. Das werden Sie mit einem derartigen Instrumentenkasten nicht leisten können.
Hierfür müssten Sie eine echte Steuerstrukturreform durchführen. Wenn der Instrumentenkasten ausgelichtet wird, hat er einen entscheidenden positiven Effekt: Dies führt dazu, dass die Beitragsmittel effizient eingesetzt werden und Beitragssenkungsspielräume geschaffen werden. Das führt wiederum dazu, dass Arbeit billiger und dadurch sicherer wird und dass für Arbeitnehmer Konsum leichter möglich wird. Aber in der Gesamtschau dessen, was notwendig ist, um die Arbeitsmarktsituation auch im kommenden Jahr zu stabilisieren, brauchen Sie Veränderungen der strukturellen Rahmenbedingungen. Das geht nur mit einer Steuerstrukturreform, die den Menschen und den Betrieben mehr netto vom Brutto lässt. Das geht nur mit Flexibilisierungen und mehr Spielräumen im Arbeitsrecht.
Gerade dann, wenn es schwierig ist, Belegschaften zu halten, muss man sich Gedanken darüber machen, das Arbeitsrecht zu flexibilisieren - ein Thema, das in der gesamten Regierungszeit von Schwarz-Rot nicht angesprochen wurde.
Das geht nur, wenn ideologische Scheuklappen wegfallen.
Damit komme ich noch einmal zum Thema Erbschaftsteuer. Die Basis unserer Wirtschaft sind die familiengeführten Betriebe in Deutschland.
Wenn der Aktionär eines DAX-Unternehmens stirbt, wird dem Betrieb kein Cent des Vermögens entzogen. Wenn ein mittelständischer Inhaber stirbt, ist dies allerdings der Fall. Deswegen sind die Vorschläge, die Sie im vierten Superkompromiss dieser Koalition gefunden haben, mit Sicherheit eines: mittelstandsfeindlich. Sie sind familienfeindlich, aber sie sind auch mittelstandsfeindlich;
denn kein Unternehmen kann am Rande einer Rezession seine Lohnsumme für zehn Jahre festschreiben. Wenn ein Unternehmen erbschaftsteuerfrei übergeben werden soll
und die Lohnsumme für zehn Jahre festgeschrieben ist, das Unternehmen dann aber in eine Schieflage gerät, hat man die dramatische Situation, dass man den Umfang des Personals nicht anpassen kann und zusätzlich mit der Erbschaftsteuer belastet wird. Das kostet weit mehr Arbeitsplätze, als Sie mit Ihrem kleinen Instrumentenkästle jemals reparieren können.
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat jetzt der Kollege Stefan Müller von der CDU/CSU-Fraktion.
Stefan Müller (Erlangen) (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Große Koalition hat in den letzten drei Jahren deutlich mehr erreicht, als viele, vor allem Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Oppositionsfraktionen, uns zugetraut haben. Man kann sich immer mal wieder die Frage stellen: Was hätten Sie für Feste in diesem Hause gefeiert, wenn Sie diese Erfolge vorzuweisen gehabt hätten? Ich vermute, dass das, was wir hier machen, bescheiden ist gegenüber dem, was Sie, liebe Frau Pothmer, hier gesagt und getan hätten, wenn Sie in der gleichen Funktion gewesen wären, wenn Rot-Grün weiterregiert hätte.
Die Erfolge auf dem Arbeitsmarkt sind unübersehbar: Wir haben einen Rückgang bei der Arbeitslosigkeit, wir haben einen Aufwuchs bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen, wir haben mehr Ältere im Erwerbsleben und weniger junge Arbeitslose. Natürlich hat die Politik dieser Großen Koalition einen ganz maßgeblichen Anteil an diesen Erfolgen,
nämlich aufgrund der Reformen der vergangenen Jahre, vor allem aufgrund der Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages.
- Wir haben gestern zu später Stunde darüber geredet. Weil da schon alle Kameras ausgeschaltet waren, sollte dieses Thema heute früh noch einmal angesprochen werden.
Herr Niebel,
es ist ja nicht so, dass wir auf den Evaluationsbericht aus dem Jahr 2006 nicht reagiert haben. Es hat entsprechende Schlussfolgerungen gegeben. Dazu werde ich gleich etwas sagen.
Mit dem Gesetzentwurf, den wir heute in erster Lesung beraten, geht es uns darum, die Bundesagentur für Arbeit schlagkräftiger aufzustellen, vor allem - der Herr Minister hat darauf hingewiesen -, weil wir nicht wissen, wie sich die Finanzmarktkrise auf den Arbeitsmarkt in Deutschland auswirken wird. Das heißt, wir wollen darüber reden, wie die Bundesagentur für Arbeit zu einem leistungsfähigen Dienstleister am Arbeitsmarkt entwickelt werden kann.
Herr Niebel, Sie haben eine für Ihre Verhältnisse erstaunlich konstruktive Rede gehalten. Ich will das ausdrücklich anerkennen.
Allerdings haben Sie am Ende Ihrer Rede wieder Ihren liberalen Ladenhüter hervorgeholt: Schafft den Kündigungsschutz ab; dann haben wir automatisch mehr Arbeitsplätze. - Lassen Sie sich doch einmal etwas Neues einfallen. Es wird doch dadurch nicht richtiger, dass Sie es ständig wiederholen.
Zur Erbschaftsteuer. Das ist zwar nicht unser Thema, lassen Sie mich aber trotzdem sagen: Ich glaube, dass die bayerische FDP verantwortungsbewusst genug ist, um mit dem Thema Erbschaftsteuer ordentlich umzugehen, und keine Nachhilfe von Ihnen, Herrn Westerwelle, oder sonst jemandem von der Bundespartei braucht. Ich bin da sehr zuversichtlich. Lassen Sie die bayerischen Kollegen in Ruhe mit uns zusammenarbeiten. Dann kommt auch etwas Anständiges raus.
Wir wollen die Bundesagentur zu einem schlagkräftigen Dienstleister am Arbeitsmarkt entwickeln. Es mag ja sein, dass Sie, liebe Kollegen von der FDP, daran kein Interesse haben. Sie wollen die Bundesagentur lieber abschaffen.
- Auflösen. Den Unterschied müssen Sie mir einmal erklären. - Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bundesagentur irgendwann einmal abgeschafft oder aufgelöst wird, ist so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass die FDP irgendwann einmal in Deutschland mit absoluter Mehrheit regiert.
Das ist sehr unwahrscheinlich. Ich finde, das ist auch gut so.
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf für eine SGB-III-Reform verfolgen wir im Wesentlichen drei Ziele: Erstens. Wir wollen mehr Übersichtlichkeit und eine bessere Handhabbarkeit der Instrumente, um dadurch eine bessere Vermittlung in den Arbeitsmarkt gewährleisten zu können. Wir wollen zweitens mehr Entscheidungsspielräume für die Agenturen und die Mitarbeiter der Agenturen vor Ort. Drittens wollen wir erreichen, dass die Mittel, die der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung stehen, wirtschaftlicher eingesetzt werden können, damit das Geld der Beitragszahler so effizient und effektiv wie möglich eingesetzt werden kann.
Lassen Sie mich zu den drei Punkten einige kurze Bemerkungen machen: Erstens. Bessere Übersichtlichkeit heißt für mich auch mehr Transparenz. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass die Zahl der Instrumente reduziert werden soll. Vor allem aber sollen die vorhandenen Instrumente auf ihre Wirksamkeit geprüft werden. Das heißt, wir wollen wirksame Instrumente fortentwickeln und unwirksame Instrumente abschaffen oder streichen, und wir haben uns vorgenommen, dass gleichartige Instrumente zusammengefasst werden.
Wenn Sie den Gesetzentwurf durchlesen, werden Sie feststellen, dass wir in der Tat unwirksame Instrumente abschaffen, zum Beispiel die Jobrotation, den Eingliederungszuschuss bei Neugründungen, den Arbeitgeberzuschuss zur Ausbildungsvergütung und vieles andere mehr. Diese Maßnahmen werden gestrichen, weil sie nichts genutzt haben, weil sie die arbeitsmarktpolitischen Ziele nicht erfüllt haben, also einfach, weil sie unwirksam waren. Eine ganze Reihe von Maßnahmen - unterstützende Leistungen und vieles andere mehr - werden, zum Beispiel im Vermittlungsbudget, zu einem neuen Instrument zusammengefasst, sodass wir entgegen dem, was hier gesagt worden ist, zu einer Reduzierung der Zahl der Arbeitsmarktinstrumente kommen. Ich sage aber ausdrücklich dazu: Diese Reduzierung ist kein Selbstzweck. Wir reduzieren die Zahl der Instrumente nur, um dem Ziel näher zu kommen, die Vermittlung zu verbessern und den Arbeitsuchenden, also denen, die unsere Hilfe und Unterstützung brauchen, noch wirksamer helfen zu können. Darum geht es.
Wir setzen mit dem, was wir Ihnen heute vorlegen, den bisherigen Kurs der Großen Koalition fort. Herr Niebel, ich habe Ihnen angekündigt, dazu noch etwas zu sagen. Natürlich haben wir auf die Evaluationsberichte reagiert
und auf so manches, was durch die Hartz-Kommission und die Hartz-Reformen auf den Weg gebracht worden ist. Ich will Sie daran erinnern, dass wir zum Beispiel die Personal-Service-Agenturen abgeschafft haben, weil sie nichts gebracht haben. Ich will daran erinnern, dass wir die Ich-AG abgeschafft und in Verbindung mit dem Überbrückungsgeld ein neues Instrument, den Gründungszuschuss, geschaffen haben. Selbst Sie müssten einräumen, dass dieser neue Gründungszuschuss die Zielgruppe erreicht, die er erreichen soll, und das bei weniger Mitteleinsatz. Dadurch können wir denen helfen, die unsere Hilfe ganz dringend brauchen.
Zweitens: mehr Entscheidungsspielräume für die Vermittler vor Ort. Das Vermittlungsbudget wird hier eine zentrale Rolle einnehmen. In diesem Vermittlungsbudget wird eine ganze Reihe von Leistungen zusammengefasst, die bisher in einer Reihe von Einzelvorschriften geregelt wurden. Wichtig ist, dass die Entscheidung, ob Hilfe gewährt wird, tatsächlich dem Vermittler vor Ort überlassen bleibt. Dadurch können stärkeres Ermessen und stärkere Handlungsspielräume der Vermittler vor Ort gewährleistet werden. Die Vermittler kennen ihre Kunden schließlich am besten und können daher am besten entscheiden, ob eine Maßnahme sinnvoll ist oder nicht.
Ich will ausdrücklich sagen: Wir haben bei der Bundesagentur für Arbeit gute Mitarbeiter. Wir vertrauen auf die Entscheidungsfähigkeit und das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter vor Ort. Auch das ist eine wesentliche Neuerung gegenüber dem, was wir in den vergangenen Jahrzehnten erlebt haben. Nur hilft mehr gesetzliche Entscheidungsfreiheit vor Ort gar nichts, wenn diese vom Gesetzgeber gewollte Entscheidungsfreiheit durch irgendwelche Anweisungen der Zentrale aus Nürnberg zunichtegemacht wird. Deswegen sage ich ganz deutlich: Es kann nicht sein, dass wir hier ein Gesetz auf den Weg bringen und die Zentrale in Nürnberg dann den Mitarbeitern vor Ort so viele Dienstvorschriften macht, dass diese Entscheidungsspielräume nicht mehr bestehen.
Ich finde, die Zentrale wäre gut beraten, diese Spielräume zuzulassen.
Im Mittelpunkt sollen nicht mehr die Fragen stehen, welche Leistungen es gibt, welche Leistungen beantragt werden können und aus welchen Töpfen man Geld holen kann, sondern im Mittelpunkt sollen die Fragen stehen, welche Hemmnisse bei dem jeweiligen Arbeitsuchenden beseitigt werden müssen und was getan werden kann, um eine Integration in den Arbeitsmarkt zu erreichen. Das heißt, es wird nur noch dann eine Förderung geben - auch das liegt im Ermessen des Vermittlers -, wenn Aussicht besteht, dass durch diese Maßnahme tatsächlich Erfolge am Arbeitsmarkt verzeichnet werden können.
Ich möchte insgesamt feststellen, dass dieses Vermittlungsbudget eine flexible, bedarfsgerechte und unbürokratische Förderung gewährleisten wird. Die Flexibilität, die wir durch das Vermittlungsbudget erreichen, setzen wir mit dem Experimentiertopf fort, den wir ebenfalls einführen werden und von dem wir uns versprechen, dass innovative Ansätze der aktiven Arbeitsförderung erprobt werden können. Wir haben da in den vergangenen drei Jahren, Herr Minister, gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit der Initiative ?50 plus?, bei der es im Kern darum geht, dass der Bund Geld für bestimmte Modellregionen, für bestimmte Modellkommunen zur Verfügung stellt, die dann selber entscheiden dürfen, für welche Instrumente sie es einsetzen. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es geht darum, in den Regionen passende Instrumente zu finden, ohne dafür einen gesetzlichen Rahmen zu haben, aber auch zu lernen, was in den einzelnen Regionen und in den Agenturen vor Ort an Sinnvollem und Richtigem gemacht werden kann, um Rückschlüsse für die Zukunft der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu ziehen.
Wir werden dafür sorgen, dass die Beratung und die Betreuung durch eine Potenzialanalyse und durch Eingliederungsvereinbarungen verbessert werden. Diese Dinge haben wir teilweise schon im SGB II eingeführt. Dazu ist es notwendig, dass auch die Ausbildung der Mitarbeiter noch weiter verbessert wird.
Lassen Sie mich zum letzten Punkt kommen. Das Ziel, das wir mit diesem Gesetzentwurf erreichen wollen, ist ein wirtschaftlicher Mitteleinsatz. Es ist die Aufgabe der BA, dafür zu sorgen, dass die Mittel der Beitragszahler wirklich verantwortungsvoll eingesetzt werden, dass damit sorgsam umgegangen wird und sie eben nicht in irgendwelchen unwirksamen Arbeitsmarktprogrammen verpuffen. Die bisherige Politik zeigt, dass wir dieser Verantwortung gerecht geworden sind. Nur die Einsparung steht aber nicht im Mittelpunkt dieses Gesetzentwurfes.
Wer glaubt, dass wir 20 Instrumente einsparen, um ein Viertel des Geldes ausgeben zu können, der täuscht sich gewaltig.
Wir brauchen diese freien Finanzmittel, um denen helfen zu können, bei denen der Aufschwung am Arbeitsmarkt noch nicht angekommen ist.
Zusammenfassend will ich sagen, dass mit diesem Gesetzentwurf die Arbeitsmarktinstrumente wirkungsvoll weiterentwickelt, Entscheidungsspielräume erhöht werden und wir die BA in die Lage versetzen, ihren arbeitsmarktpolitischen Aufgaben noch besser nachzukommen. Sie sehen also, liebe Kolleginnen und Kollegen: Die Große Koalition versteht die Arbeitsmarktpolitik als eines ihrer zentralen Handlungsfelder. Ich würde mich freuen, wenn die Opposition die jetzt beginnenden Beratungen in den Ausschüssen in gleichem Maße begleitet.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Als nächste Rednerin hat die Kollegin Kornelia Möller von der Fraktion Die Linke das Wort.
Kornelia Möller (DIE LINKE):
Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In einem Jahr sind Bundestagswahlen. Die Langzeiterwerbslosigkeit ist hierzulande nach wie vor einer der Brennpunkte. Die Koalition von CDU/CSU und SPD hätte die Chance gehabt, wirklich etwas Nachhaltiges zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit auf den Weg zu bringen. Leider hat sie diese Chance vertan. Dieser Gesetzentwurf ist offensichtlich mit der heißen Nadel genäht. Wieder einmal wird klar, dass der Vorrat an Gemeinsamkeiten in der Arbeitsmarktpolitik längst aufgebraucht ist.
Nun hat man sich nach langen Verhandlungen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt. Das heißt, Einsparung von Beitrags- und Haushaltsmitteln zulasten der Langzeiterwerbslosen,
statt der Eröffnung neuer zukunftsfähiger Wege aus der Erwerbslosigkeit durch wirkungsvolle Instrumente. Notwendig wären andere Weichenstellungen. Eine Vielfalt von Impulsen kommt dazu aus Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und auch von Arbeits- und Sozialministern aus verschiedenen Bundesländern. Ich möchte hier einige dieser Vorschläge beispielhaft aufgreifen, die auch unserer Intention entsprechen.
Erstens. Das Land Berlin schlägt vor, die Regelungen zu ABM im SGB II unbedingt beizubehalten, weil sich die entsprechenden Förderinhalte bei Wegfall von ABM im Regelkreis des SGB II nicht, wie in der Gesetzesbegründung ausgeführt, durch Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante ersetzen lassen.
ABM sind strukturwirksam und vergabefähig und haben gerade für die neuen Bundesländer vor allem deshalb nach wie vor große Bedeutung, weil sie die Möglichkeit der Verzahnung von Aufträgen der öffentlichen Hand mit der Beschäftigungsförderung sichern.
Zweitens. Viele kritische Hinweise aus Wohlfahrtsverbänden und Gewerkschaften beziehen sich auf das Vorhaben, § 16 Abs. 2 Satz 1 SGB II, also die sonstigen weiteren Leistungen, zu streichen. Bereits während der Sonderkonferenz der Amtschefs für Arbeit und Soziales am 24. April dieses Jahres hatten alle Bundesländer geschlossen gefordert, die restriktive Auslegung des § 16 Abs. 2 SGB II aufzuheben. Der Handlungsspielraum der lokalen Akteure, der bisher durch diese Generalklausel ermöglicht wurde, muss erhalten bleiben,
da sonst die erforderlichen, am Einzelfall und an den arbeitsmarktbezogenen Gegebenheiten vor Ort ausgerichteten Eingliederungsbemühungen nicht mehr in der nötigen Flexibilität und Einzelfallgenauigkeit durchgeführt werden können.
- Natürlich habe ich recht. Danke, Herr Niebel.
Aus der umfangreichen Liste kritischer Hinweise zu den Auswirkungen, die der vorgelegte Gesetzentwurf auf die Ausbildung junger Leute hätte, möchte ich ganz kurz nur die Forderung nach einheitlicher Ausbildungsvermittlung durch die für die Arbeitsförderung zuständigen Stellen der BA sowie nach Weiterführung der Förderung des Jugendwohnheimbaus nennen.
Sie alle wissen, dass der Bundesrat über 50 Anregungen - ich wiederhole: über 50 Anregungen - vorgelegt hat. Daran wird deutlich, dass hier ein Gesetz am grünen Tisch zusammengeschustert wurde. So sehen gute Gesetze nicht aus. Gute Gesetze sehen anders aus. In jedem Fall gehört zu einem guten Gesetz, dass im Vorfeld die Erfahrungen derjenigen einbezogen werden, die von diesem Gesetz betroffen sind,
und die Erfahrungen derjenigen, die es umsetzen müssen. Die BAG Arbeit hat in ihrem Positionspapier gefordert - ich kann es Ihnen vorlesen -: Ziehen Sie dieses Gesetz zurück! Damit hat sie recht.
Ihnen scheint die Expertenmeinung aber völlig gleichgültig zu sein. So wundert es uns auch nicht, dass die Große Koalition mit diesem Gesetz nichts an den erwiesenermaßen gescheiterten Arbeitsmarktinstrumenten und -experimenten ändert. Die Flops waren zahlreich: 1-Euro-Jobs, Leiharbeit, Minijobs, privatisierte Arbeitsvermittlung und nicht zuletzt die weitere Ausdehnung des Niedriglohnsektors mit ihren verheerenden Folgen für die Entwicklung der Binnennachfrage.
Armut und soziale Gegensätze sind durch Ihre Politik gewachsen. Das ist der eigentliche Skandal.
- Das ist kein Quatsch. Das ist die Realität, Herr Müller. Sie sollten sich ihr stellen.
Langzeitarbeitslose gehen bei Ihrem Gesetz leer aus. Die dringend notwendige neue Qualität geförderter beruflicher Weiterbildung wird damit nicht eingeleitet. Aus unserer Sicht wäre das aber ein Hauptkettenglied zukunftsfähiger Arbeitsmarktpolitik. Stattdessen setzen Sie in Ihrem Gesetz enge zeitliche Grenzen für Weiterbildungs- und Trainingsmaßnahmen, um noch mehr zu sparen. Das nenne ich Ausgrenzung der Langzeiterwerbslosen.
Für wen haben Sie eigentlich Ihre Bildungsoffensive gestartet? Auf jeden Fall nicht für die ALG-II-Beziehenden. Dabei verweist gerade der Nationale Bildungsbericht 2008 auf den engen Zusammenhang zwischen Langzeitmaßnahmen der beruflichen Weiterbildung und guten Eingliederungsquoten besonders für Ältere. Andere Instrumente sollen mit der Begründung geringer Anwendung ersatzlos gestrichen werden, zum Beispiel die beschäftigungsbegleitenden Eingliederungshilfen oder die Weiterbildung durch Vertretung. Im Gegensatz zu hier bereits vorgetragenen Meinungen halte ich die Jobrotation für ein ganz wesentliches Instrument.
Selbstverständlich müssen Unternehmen wieder stärker in die Weiterbildungspflicht genommen werden.
Dass der Anteil der Unternehmen, die ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Weiterbildung angeboten haben, zwischen 1999 und 2005 erheblich gesunken ist, ist ein Skandal.
Die fortgesetzte Benachteiligung der Erwerbslosen, die ALG II beziehen, ist ein weiterer sehr gravierender Mangel Ihres Gesetzentwurfes. Dass Sie die aufschiebende Wirkung bei Widersprüchen und Klagen weiter eingrenzen, ist nicht hinnehmbar. Dass sogenannte Aufstocker tatsächlich ihren Job aufgeben müssen, um einen 1-Euro-Job annehmen zu können, ist ebenfalls nicht hinnehmbar.
Dies bestärkt uns in unserer Forderung.
Wenn ich mir Ihren Gesetzentwurf ansehe, muss ich sagen: Die durch die Hartz-Gesetze verursachte unsinnige Trennung der Arbeitsmarktpolitik in zwei Rechtskreise ist durch die Gestaltung einer einheitlichen Arbeitsmarktpolitik mit gleichen Rechten und gleichen Pflichten für alle Erwerbslosen, wie auch von Verdi gefordert, zu ersetzen.
Dies würde auch dabei helfen, ein Problem zu lösen, das Sie, die Sie auf der Regierungsbank sitzen, aufgrund konträrer Positionen in dieser Wahlperiode wohl nicht mehr bewältigen werden, nämlich die gute Organisation der Betreuung und Förderung langzeiterwerbsloser Menschen vor Ort im Rahmen des geltenden Grundgesetzes.
Ich komme noch kurz auf unseren Antrag zu sprechen. Wir fordern die volle Versicherungspflicht für sämtliche vergütungspflichtige Tätigkeiten innerhalb der Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik. Dies würde allen Erwerbslosen mehr soziale Sicherheit bringen, alle öffentlich geförderten Beschäftigungsverhältnisse gleichstellen und die Arbeitslosenversicherung, die Sie durch die gestern beschlossene Beitragssatzsenkung geschwächt haben, stärken.
Ich kann das Gesagte von gestern nur wiederholen: Beerdigen Sie auch diesen Gesetzentwurf, stimmen Sie auch hier unserem Antrag zu; denn Arbeitsmarktpolitik muss immer Politik für und nicht gegen die Menschen sein!
Ich danke Ihnen.
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Das Wort hat jetzt die Kollegin Brigitte Pothmer von Bündnis 90/Die Grünen.
Brigitte Pothmer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Minister Scholz, ich sage es nicht gerne, aber Ihr Gesetzentwurf taugt einfach nichts.
Das ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist auch die Meinung aller Experten, die sich bis jetzt zu Wort gemeldet haben.
Diese Statements liegen auch Ihnen vor. Ich will hier nur einige wenige zitieren:
?Die Ziele der Reform wurden mit diesem Gesetzentwurf verfehlt? - Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit. ?Die Instrumentenreform weist in die falsche Richtung? - Diakonie Bundesverband. ?Der Gesetzentwurf ist als Instrumentenreform grundsätzlich verfehlt? - BAG Arbeit.
Herr Minister, Sie treiben die Betroffenen und diejenigen, die mit dem Murks, den Sie hier angerichtet haben, umgehen müssen, wirklich zum Äußersten.
Das muss man sich einmal vorstellen: Die Stadt Wiesbaden hat in ihrer Verzweiflung eine Unterschriftenaktion gegen diese Pläne gestartet, weil die Verantwortlichen einfach Angst haben, dass mit diesem Instrumentenkasten die Integrationschancen der Arbeitssuchenden massiv verschlechtert werden.
Der CDU-Sozialminister Laumann aus Nordrhein-Westfalen klassifiziert diesen Instrumentenkasten als ?stalinistisches Korsett?.
Ich sage das hier ganz eindeutig: Mir gefällt diese Wortwahl nicht. Unabhängig von der Frage, ob man diese Wortwahl nun gut und richtig findet, müssen Sie aber zur Kenntnis nehmen, Herr Minister, dass Sie diese Fachleute, diese Experten nicht einfach als Schafsnasen und Deppen abtun können. Sie müssen auf diese Leute hören und ihre Einwände berücksichtigen.
Vor knapp einem Jahr haben Sie uns allen hier bei Ihrem Amtsantritt versprochen, Sie wollten die weltbeste Arbeitsvermittlung schaffen.
Außerdem haben Sie uns Vollbeschäftigung versprochen. Sie haben gesagt, ?Mehr Chancen auf Arbeit? solle der Maßstab sein, den Sie anlegen, wenn Sie den Instrumentenkasten reformieren. Der Instrumentenkasten sollte kleiner und die arbeitssuchenden Bürgerinnen und Bürger sollten zielgerichteter unterstützt werden.
Der Instrumentenkasten ist kleiner geworden. Das ist allerdings das Einzige, was Sie von Ihren Versprechen wirklich eingelöst haben. Zielgerichteter und besser ist hier gar nichts geworden. Ich betone ausdrücklich, dass wir Grünen immer gesagt haben: Ja, man kann diesen Instrumentenkasten reformieren; einige Instrumente könnten durchaus wegfallen. - Wenn es aber weniger Instrumente gibt, dann müssen die dann vorhandenen Instrumente flexibler und individueller einsetzbar sein;
weil die Problemlagen der Menschen ja nicht weniger individuell und vielfältiger geworden sind.
Ich will hier im Übrigen auch noch einmal betonen: Manche Instrumente waren gut und erfolgreich. Die ?weiteren Leistungen? zum Beispiel waren wirklich ein Garant für die individuelle Hilfe. Viele Jugendliche konnten dadurch den Schulabschluss nachmachen und haben den Einstieg in Ausbildung gefunden. Alleinerziehende haben mit kombinierten Maßnahmen davon profitiert und in Arbeit zurückgefunden. Auch vielen Migrantinnen und Migranten ist es über die ?weiteren Leistungen? gelungen, wieder den Weg in die Arbeit zu gehen.
Lieber Herr Müller, hören Sie mir doch einmal zu.
Das sind wirklich keine unwirksamen Instrumente. Ihr Versprechen, nur unwirksame Instrumente fallen zu lassen, ist doch nicht eingelöst worden.
Dieses Instrument ist gestrichen worden, obgleich es eins der erfolgreichsten war.
Kommen Sie mir nicht damit, dass die freie Förderung ein Ersatz dafür sei. Die freie Förderung ist weder quantitativ noch qualitativ ein Ersatz dafür. 2 Prozent des Budgets: Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich weiß, dass Sie das in der Regierungskoalition genauso sehen. Sie wollen die 2 Prozent signifikant aufstocken.
Ich unterstütze Sie gerne dabei. Ich fürchte aber, dass es den Betroffenen nicht hilft. Denn es gibt eine tiefe Misstrauenskultur dieser Regierung auch gegenüber den Regierungsfraktionen im Parlament. Staatssekretär Scheele hat auf der Sitzung der BAG Arbeit am letzten Montag Folgendes angekündigt: Sollte sich das Parlament mit diesem Vorhaben durchsetzen, dann würde es einen - ich zitiere - ?Drahtverhau? von Regelungen geben, der den flexiblen Einsatz dieser Instrumente verhindert.
- Liebe Frau Nahles, begreifen Sie das als das, was es wirklich ist: Es ist eine Kampfansage an das Parlament als Gesetzgeber.
Es ist insbesondere eine Kampfansage an die Fraktionen, die diese Regierung tragen.
Hören Sie auf, sich das gefallen zu lassen und sich von dieser Regierung am Nasenring durch die Manege ziehen zu lassen! Wehren Sie sich endlich dagegen!
Dieser Gesetzentwurf atmet den Geist einer tiefsitzenden Misstrauenskultur
gegenüber dem Parlament als Gesetzgeber, gegenüber den eigenen Regierungsfraktionen, gegenüber den Akteuren vor Ort und gegenüber den Arbeitslosen.
Dieser Gesetzentwurf verschärft die Sanktionsregelungen und verschlechtert die Situation der ALG-I- und ALG-II-Empfänger zusätzlich. Die bisherigen Erfahrungen haben eines deutlich gezeigt: Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist nicht mit dirigistischen Maßnahmen möglich. Sie erfordert Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein, gut qualifiziertes Personal, gute Rahmenbedingungen, Handlungsfreiheit vor Ort und ein Instrumentarium, das sich an den Bedarfen der Menschen ausrichtet, statt dass sich die Menschen nach den Maßnahmen richten müssen.
Aber die Politik, die Sie hier machen, folgt einem anderen Geist. Deswegen kann sie nicht erfolgreich sein.
Die Arbeitslosen in diesem Land verdienen etwas Besseres. Etwas Besseres als diesen Instrumentenkasten finden Sie sie allemal.
Ich danke Ihnen.
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Katja Mast von der SPD-Fraktion.
Katja Mast (SPD):
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente will die Regelungen für die aktive Arbeitsmarktpolitik übersichtlicher gestalten. Das leistet der vorliegende Gesetzentwurf. Schon das ist ein Erfolg.
Doch damit nicht genug. Die Reform stärkt die aktive Arbeitsmarktpolitik, indem präventive Ansätze wie die Vorbereitung auf das Nachholen eines Hauptschulabschlusses verbindlich eingeführt werden. Die Kultur der zweiten Chance wird gestärkt. Denn Bildungspolitik ist aktive Arbeitsmarktpolitik. Das gilt nicht nur auf dem Papier, sondern wird mit diesem Gesetzentwurf erneut umgesetzt.
Bei 500 000 Arbeitslosen ohne Schulabschluss - der Bundesarbeitsminister hat es bereits angesprochen - und bei jährlich 70 000 Schulabgängern ohne Abschluss wäre diese gesetzliche Verankerung schon lange sinnvoll gewesen. Jetzt kommt sie endlich. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es dabei: Wir müssten im Bundestag nicht handeln, wenn die Bundesländer ihrer Verantwortung für die Bildungspolitik an dieser Stelle nachkommen würden.
Aber das ist ein anderes Thema.
Wir von der SPD-Bundestagsfraktion sind auf jeden Fall stolz darauf, dass es uns gelungen ist, das Recht auf die Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss mit diesem Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen. Hinzu kommt, dass der nachträgliche Erwerb der deutschen Sprache - das ist vor dem Schulabschluss die erste Hürde auf dem Weg zur erfolgreichen Integration - ebenfalls zu einem Recht der Arbeitsuchenden wird.
Die Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente stärkt aber auch die Entscheidungs- und Handlungskompetenz vor Ort, und zwar rechtssicher, obwohl schon mehrfach das Gegenteil behauptet wurde. Rechtssicher bedeutet, dass es eben nicht sein kann, dass ein Gesetz, das ausschließlich dafür gedacht war, individuelle Unterstützung in Einzelfällen zu finanzieren, dafür verwendet wird, Projektförderung zu betreiben.
Deshalb schaffen wir mit diesem Gesetz ein Vermittlungs- und Aktivierungsbudget, also die Regelungen des SGB III in §§ 45 und 46, die identisch für die Arbeitslosengeld-II-Empfänger gelten. Hier schaffen wir für die Vermittler und die Akteure vor Ort die Möglichkeit, Projekte zu fördern und auszustatten, wo dies die bisherige Rechtsgrundlage nicht hergab. Natürlich wissen wir, dass die Situation auf dem Arbeitsmarkt nicht immer gleichbleibt und man deshalb vor Ort Luft braucht, um neue Ideen auszuprobieren. Wir alle kennen das aus unseren Wahlkreisen. Mit der neuen freien Förderung verschaffen wir Luft.
Die Bundesregierung ist allerdings der Meinung, dass für die freie Förderung 2 Prozent der Eingliederungsleistungen ausreichen. Leider kann ich hier nicht die Einschätzung des Kanzleramts und des Arbeitsministeriums teilen.
Ich finde, 2 Prozent sind nicht genug. Wir müssen im zweistelligen Bereich landen.
Mit dieser Einschätzung bin ich nicht allein. Zum Glück entscheidet am Ende das Parlament. Auch für diese gute Gesetzesvorlage gibt es noch einen parlamentarischen Prozess. Da geht es um die Höhe der freien Förderung.
Da geht es um alle weiteren Aspekte, wie zum Beispiel darum, ob es noch weiterer detaillierter Regelungen zum Hauptschulabschluss bedarf.
Doch eines ist klar: Wer dieses Gesetz beurteilt, darf nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern muss eins und eins zusammenzählen. Die neue Qualität dieses Gesetzentwurfs ist nicht daran zu messen, ob in der freien Förderung das gesamte Budget des bisherigen § 16 Abs. 2 eingegangen ist; denn mit Sprachkursen und Hauptschulabschluss sind wesentliche Kostenblöcke aus dem alten § 16 Abs. 2 herausgelöst. Über rechtswidrige Verwendung will ich hier gar nicht reden. Hinzu kommt, dass die Vermittler mit dem Vermittlungs- und Aktivierungsbudget enorme Handlungsspielräume bekommen. Diese werden finanziell vonseiten des Gesetzgebers nicht gedeckelt. Zusätzlich kommt die freie Förderung hinzu.
Also lassen Sie mich eins und eins zusammenzählen: Hauptschulabschluss und Spracherwerb in die Regelförderung, Vermittlungs- und Aktivierungsbudget zur dezentralen Entscheidung und dann noch die freie Förderung, das ist ein guter Ersatz für Rechtsunsicherheit und schafft Handlungsspielräume,
Handlungsspielräume für die Vermittlung in Arbeit und damit für die Beseitigung der größten Armutsfalle Deutschlands. Uns geht es darum, Menschen besser in Arbeit zu vermitteln.
Ich bin auf unsere Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales gespannt. Ich glaube, dass wir an der einen oder anderen Stelle noch mehr für die Arbeitsmarktintegration Jugendlicher machen könnten. Ich bin aber auch darauf gespannt, weil ich weiß, dass sich viele Fachverbände mit diesem Gesetzentwurf intensiv auseinandergesetzt und gute Vorschläge unterbreitet haben. Unsere Aufgabe als Gesetzgeber wird es sein, diese Vorschläge abzuwägen und für Mehrheiten im Parlament zu sorgen. Ich weiß mich dabei in guter Gesellschaft mit unserem Koalitionspartner, der zwar beim Hauptschulabschluss zuerst nicht mitmachen wollte, aber am Ende unseren guten Argumenten nicht widerstehen konnte.
Den sozialen Trägern vor Ort, die unser Gesetzesvorhaben kritisch begleiten, will ich klar sagen: Wir wissen, es geht um die Menschen; wir wissen aber auch, dass gerade ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darunter leiden, dass wir am Anfang bei den Reformen am Arbeitsmarkt durch die Ausschreibungspraxis Fehler gemacht haben. Diese haben wir korrigiert, aber das reicht nicht. Uns von der SPD geht es darum, auch in der Trägerlandschaft die Verbindlichkeit von Mindestlöhnen sicherzustellen. Uns geht es darum, dass der Unterbietungswettbewerb bei Ausschreibungen ein Ende hat. Deshalb fordere ich auch jede Abgeordnete und jeden Abgeordneten, auch diejenigen von der FDP, auf, der Festlegung von Mindestlöhnen
und von verbindlichen sozialen Mindeststandards beim Vergaberecht in den kommenden Wochen zuzustimmen.
Dann wird dieses Gesetz auch zu einem guten Gesetz, nicht nur für die betroffenen Arbeitsuchenden, sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Trägern vor Ort.
Dieses Gesetz leistet viel: Nicht Menschen in Schubladen stecken, sondern dem Einzelfall durch Budgets Spielraum geben, nicht Menschen abschreiben, sondern die Kultur der zweiten Chance verankern.
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Als letztem Redner zu diesem Tagesordnungspunkt erteile ich nun dem Kollegen Karl Schiewerling von der CDU/CSU-Fraktion das Wort.
Karl Schiewerling (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Kollegin Pothmer,
Arbeitsplätze werden nicht durch Instrumente geschaffen, sondern durch die Wirtschaft in einer gut laufenden Konjunktur.
Wenn es darum geht, Arbeitsplätze zu schaffen, dann sind nicht die Instrumente dafür zuständig, sondern die Wirtschaft und die Tarifpartner durch verantwortungsvolle Abschlüsse etc.
Worum es hier geht, ist, dass wir den Menschen, die ohne fremde Hilfe keine Perspektive haben, Unterstützung zuteil werden lassen. Wir nennen dies nüchtern Instrumente und reden gerade so, als ginge es um irgendwelche Apparatschiks; es geht aber darum, Menschen Perspektiven zu geben, damit sie mit ihrer eigenen Hände und ihres eigenen Kopfes Arbeit den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien verdienen können.
Diese Hilfen sind im Sozialgesetzbuch III beschrieben und geregelt. Davon sind 30 Prozent aller Arbeitslosen betroffen. Das sind diejenigen, die bis zu einem Jahr erwerbslos sind. Die Hilfen derjenigen, die länger arbeitslos sind, sind im SGB II geregelt. Das sind immerhin 70 Prozent aller derjenigen, die letztendlich betroffen sind. Darunter sind auch viele junge Menschen, die bisher keine Ausbildung angefangen haben bzw. eine Ausbildung nicht abschließen konnten. Darunter sind auch diejenigen, die viele Jahre erwerbslos sind, viele Vermittlungshemmnisse haben und die den Tag nicht strukturieren können. Darunter sind auch diejenigen ohne Schulabschluss und diejenigen, die qualifiziert sind, die aber aufgrund hoher Arbeitslosigkeit in ihrer Region keinen Arbeitsplatz finden. Für alle diese Menschen braucht es zielgenauer Hilfen.
Man sollte nun vermuten, dass für jede beschriebene Situation ein eigenes Instrument und ein detailliertes Hilfeangebot notwendig sind. Das hat es in der Vergangenheit gegeben. Das hat zu viel Bürokratie, aber nicht unbedingt zu mehr Effizienz geführt. Wir brauchen weniger Instrumente; deren Wirkungsgrad muss aber breiter sein. Genau das beabsichtigt dieses Gesetz.
Ich gestehe gerne zu, dass man über die Streichung des einen oder anderen Instruments diskutieren kann. Frau Kollegin Möller, ich glaube, dass die Frage des Jugendwohnens wichtig ist; daher begrüße ich ausdrücklich, dass die Bundesfamilienministerin diese Frage aufgreift und das Jugendwohnen in ihrem Haus evaluieren lässt. Ich bin sicher, dass wir auf Dauer zu vernünftigen und guten Lösungen kommen können.
Bei den Menschen, die im Arbeitslosengeld-II-Bezug sind, bedarf es besonderer Hilfen. Das bedeutet, dass diese Hilfen auch deren persönliches und soziales Umfeld berücksichtigen müssen. Daher ist es gut, wenn viele Fallmanager in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei der BA übernommen werden. Allein in diesem Jahr werden es 3 000 sein, die neue Dauerstellen bekommen. Dadurch kann besser und intensiver betreut und vermittelt werden. Jemand, der Ringe unter den Augen hat, weil er nicht weiß, wie lange er selbst in der Beschäftigung ist, kann schlecht Menschen beraten, die auf Arbeitssuche sind.
Insofern ist das eine gute Entscheidung.
Wichtig ist allerdings auch, dass die Qualifizierung der Fallmanager sichergestellt ist, weil sie ihre Aufgaben sonst letztendlich nicht werden wahrnehmen können. Daher ist es notwendig - auch das sage ich Ihnen in aller Deutlichkeit -, für die Optionskommunen im Rahmen der laufenden Organisationsklärung Rechtssicherheit zu schaffen; denn auch dort brauchen die Fallmanager und die Verantwortlichen Klarheit über ihre beruflichen Perspektiven.
Wir brauchen vor Ort flexibel einsetzbare Hilfs- und Förderangebote für die Menschen, damit sie wieder in Beschäftigung kommen. Daher ist es hilfreich, dass mittlerweile in § 16 f des SGB II nur die freie Förderung aufgenommen wurde. Allerdings - Frau Kollegin Mast hat darauf hingewiesen - müssen wir noch über die Höhe sprechen und die Bedingungen gestalten, damit mehr Gestaltungsspielraum besteht; denn sonst werden die Instrumente nicht wirken. Sie werden nur dann wirken, wenn ihre Handhabung so gestaltet ist, dass vor Ort auch mit der entsprechenden Freiheit entschieden werden kann.
Hier müssen wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dafür zuständig sind, Mut machen, entsprechend frei zu handeln. Wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht sofort, wenn irgendein Fehler passiert, mit Sanktionen belegt werden. Wir müssen allerdings auch dafür sorgen, dass sich diejenigen, die dafür Verantwortung tragen, am Vermittlungserfolg messen lassen; sie müssen am Schluss das verantworten, was sie getan haben.
Es ist gut, dass gerade junge Menschen die Möglichkeit erhalten, einen Schulabschluss nachzuholen; schließlich gibt es zwischen Wissen und Arbeitslosigkeit einen Zusammenhang. Aber es wird auch nötig sein, Schulabschluss und praktische Erfahrung mehr als bisher miteinander zu verknüpfen. Hier entwickelt sich dann Bildung, und hier heißt es dann, dass Menschen etwas prägen, verändern und auch sich selbst prägen lassen.
Bewährte Bildungsträger haben hier gute Erfahrungen. Gerade jungen Menschen fällt es - aus welchen Gründen auch immer - im klassischen Schulsystem schwer, den Schulabschluss nachzuholen. Eine Reihe von ihnen ist gescheitert. Daher brauchen wir - auch wenn wir den Schulabschluss nun in den Instrumentenbereich aufnehmen - Methoden und Wege, durch die Schulabschluss und praktische Erfahrung so miteinander verbunden werden, dass die jungen Menschen Erfolg sehen. Sie brauchen nicht mehr weiter ?durchgekurst? zu werden, sondern können erkennen, dass sie mit ihrer Hände Arbeit etwas schaffen können und so ihren Erfolg bekommen. Dadurch spüren sie, dass sie gebraucht werden. Wenn sie diese Erfahrung einmal gemacht haben, dann sind sie auch bereit, Abschlüsse zu machen.
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Herr Kollege Schiewerling, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kurth von Bündnis 90/Die Grünen?
Karl Schiewerling (CDU/CSU):
Ja.
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Bitte schön.
Markus Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sie haben eben über die Freiheiten, die vor Ort möglich sein sollen, gesprochen. Halten Sie es denn dann angesichts der Äußerungen des Staatssekretärs Scheele für sinnvoll, die Verordnungsermächtigung für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in dem Gesetz zu streichen? Sollte man die Verordnungsermächtigung nicht mindestens, wie es offensichtlich Herr Laumann aus NRW vorschlägt, von der Zustimmung der Länder abhängig machen?
Karl Schiewerling (CDU/CSU):
Ich halte es für notwendig, sich zwischen der ersten Lesung dieses Gesetzes und der zweiten und dritten Lesung dieses Gesetzes das eine oder andere noch einmal genau anzusehen.
Wir brauchen für die Bezieher von Arbeitslosengeld II verlässliche, langfristig angelegte Hilfen und stabile Hilfestrukturen. Gerade deshalb müssen wir noch einmal über die Dauer von bestimmten Maßnahmen sprechen. Alles in allem brauchen wir mehr örtliche Entscheidungsfreiheit, weil die Lebenssituation der Menschen unterschiedlich ist. Das betrifft nicht nur die einzelnen Menschen, sondern auch die unterschiedlichen Regionen. Arbeitslosigkeit in Stralsund sieht anders aus als Arbeitslosigkeit am Starnberger See. Entsprechend muss gehandelt werden. Der Kollege Müller hat hier in seiner Rede auf das hingewiesen, was da zu tun ist.
Wir müssen die Hilfen, die für Menschen geschaffen wurden, die nur kurzfristig arbeitslos sind, hinsichtlich ihrer Wirkung für die Menschen überprüfen, die schon länger arbeitslos sind. Zudem brauchen wir für den SGB-II-Bereich ein eigenes Instrumentarium, in dem dies passgenau entsprechend formuliert wird. Vor allen Dingen sollten wir uns hüten, die Entscheidungen über den Einsatz dieser Hilfsangebote oder Instrumente nur unter dem Gesichtspunkt finanzieller Zuständigkeiten zu sehen. Subsidiarität bedeutet, der jeweiligen Ebene, die für die Lösung einer Aufgabe zuständig ist, diese auch zu überlassen und sie, wenn sie dies aus eigener Kraft nicht schaffen kann, dazu in die Lage zu versetzen.
Wenn wir bei der Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente zu einer Lösung kommen, dann wird es sicherlich auch möglich sein, in dem eigentlichen, zentralen Bereich des SGB II, dem Bereich der Aktivierung, hinsichtlich der Organisationsstruktur zu einer Lösung zu kommen, die zurzeit zwischen Bund, Ländern, Kommunen und anderen noch strittig ist. Ich sehe hierin einen wesentlichen Punkt.
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Herr Kollege Schiewerling, erlauben Sie auch eine Zwischenfrage der Kollegin Möller?
Karl Schiewerling (CDU/CSU):
Ja.
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Bitte schön, Frau Möller.
Kornelia Möller (DIE LINKE):
Vielen Dank, Herr Präsident, vielen Dank, Herr Schiewerling. - Sie sagten gerade, dass die Vergabe von Maßnahmen nicht von finanziellen Gegebenheiten abhängig sein solle. Nun gab es gestern Abend um 21.36 Uhr eine Nachricht in Spiegel Online, die besagt, dass die Bundesagentur für Arbeit im nächsten Jahr mit einem Minus von mindestens 5,8 Milliarden Euro zu rechnen habe. Glauben Sie nicht auch, dass sich dieses Minus in irgendeiner Form auf die Vergabe der Maßnahmen auswirken könnte?
Karl Schiewerling (CDU/CSU):
Erstens. Meine Aussage zu den Finanzen bezog sich auf die Gesamtmittel, die im Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt werden, und nicht auf einzelne Maßnahmen.
Zweitens. Die Bundesagentur für Arbeit hat dank exzellenter Konjunktur und Aufwuchs von neuen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen sowie durch kluges steuerpolitisches Handeln der Bundesregierung so viele Rücklagen gebildet, dass es an diesen Fragen nicht scheitern wird.
Dies haben sowohl die Bundesagentur als auch der Bundesminister in aller Klarheit deutlich gemacht. Deswegen glaube ich es nicht.
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss kommen. Reform der Instrumente heißt nichts anderes, als die Hilfsangebote für die Menschen, die ohne fremde Hilfe keine Perspektive auf eine Beschäftigung haben, so zu gestalten, dass diese eine solche Perspektive entwickeln können. Wir wollen, dass kein Mensch verloren geht. Dazu müssen die Hilfen gebündelt und optimiert werden. Dieses Gesetz bietet dazu Voraussetzungen und Rahmen.
Herzlichen Dank.
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:
Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 16/10810 und 16/10511 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden? - Das ist offenkundig der Fall. Dann sind die Überweisungen so beschlossen.
[Der folgende Berichtsteil - und damit der gesamte Stenografische Bericht der 187. Sitzung - wird morgen,
Freitag, den 14. November 2008,
an dieser Stelle veröffentlicht.]