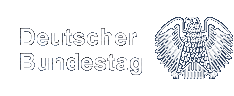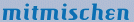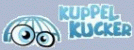206. Sitzung
Berlin, Freitag, den 13. Februar 2009
Beginn: 09.00 Uhr
* * * * * * * * V O R A B - V E R Ö F F E N T L I C H U N G * * * * * * * *
* * * * * DER NACH § 117 GOBT AUTORISIERTEN FASSUNG * * * * *
* * * * * * * * VOR DER ENDGÜLTIGEN DRUCKLEGUNG * * * * * * * *
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Die Sitzung ist eröffnet. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich Ihnen mitteilen, dass interfraktionell vereinbart worden ist, den Tagesordnungspunkt 26 b - hier handelt es sich um die zweite und dritte Beratung des Entwurfs des Nachtragshaushaltsgesetzes 2009 - wegen der noch ausstehenden Stellungnahme des Bundesrates als eigenen Punkt ohne Aussprache aufzurufen, und zwar unmittelbar im Anschluss an die jetzt als Erstes vorgesehene Beratung des Konjunkturpaketes II. Ich denke, dazu wird es Einvernehmen geben. - Das ist offensichtlich der Fall. Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe die Tagesordnungspunkte 26 a und 26 c bis 26 j sowie den Zusatzpunkt 6 auf:
|
26. |
a) |
Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU und der SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland - Drucksache 16/11740 - Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) - Drucksachen 16/11801, 16/11825 - Berichterstattung: Abg. Steffen Kampeter Abg. Carsten Schneider (Erfurt) Abg. Jürgen Koppelin Abg. Dr. Gesine Lötzsch Abg. Alexander Bonde |
Verabschiedung |
|
c) |
- Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU und der SPD eingebrachten Entwurfs eines ? Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 106, 106 b, 107, 108) - Drucksache 16/11741 - Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses (7. Ausschuss) - Drucksachen 16/11900, 16/11931 - Berichterstattung: Abg. Patricia Lips Abg. Ingrid Arndt-Brauer - Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) gemäß § 96 der Geschäftsordnung - Drucksache 16/11901 - Berichterstattung: Abg. Jochen-Konrad Fromme Abg. Carsten Schneider (Erfurt) Abg. Otto Fricke Abg. Dr. Gesine Lötzsch Abg. Alexander Bonde |
Verabschiedung |
|
|
d) |
- Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU und der SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Neuregelung der Kraftfahrzeugsteuer und Änderung anderer Gesetze - Drucksache 16/11742 - Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses (7. Ausschuss) - Drucksachen 16/11900, 16/11931 - Berichterstattung: Abg. Patricia Lips Abg. Ingrid Arndt-Brauer - Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) gemäß § 96 der Geschäftsordnung - Drucksache 16/11902 - Berichterstattung: Abg. Jochen-Konrad Fromme Abg. Carsten Schneider (Erfurt) Abg. Otto Fricke Abg. Dr. Gesine Lötzsch Abg. Alexander Bonde |
Verabschiedung |
|
|
e) |
Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Finanzausschusses (7. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Winfried Hermann, Fritz Kuhn, Peter Hettlich, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Klimaschutz im Verkehr - Kfz-Steuer schnellstmöglich auf CO2-Bezug umstellen - Drucksachen 16/8538, 16/11900, 16/11931 - Berichterstattung: Abg. Patricia Lips Abg. Ingrid Arndt-Brauer |
Beschlussfassung |
|
|
f) |
Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Finanzausschusses (7. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Gesine Lötzsch, Dr. Barbara Höll, Dr. Dietmar Bartsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE Mit mehr Gerechtigkeit die Krise überwinden - Drucksachen 16/11746, 16/11895, 16/11932 - Berichterstattung: Abg. Olav Gutting Abg. Gabriele Frechen |
Beschlussfassung |
|
|
g) |
Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Finanzausschusses (7. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Barbara Höll, Dr. Gesine Lötzsch, Roland Claus, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE Großbanken vergesellschaften - Drucksachen 16/11747, 16/11896, 16/11933 - Berichterstattung: Abg. Olav Gutting Abg. Gabriele Frechen |
Beschlussfassung |
|
|
h) |
Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Jürgen Koppelin, Ulrike Flach, Otto Fricke, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP Schulden des Bundes durch das Konjunkturpaket II vollständig im Bundeshaushalt etatisieren - Kein Sondervermögen Investitions- und Tilgungsfonds - Drucksachen 16/11743, 16/11922 - Berichterstattung: Abg. Steffen Kampeter Abg. Carsten Schneider (Erfurt) Abg. Jürgen Koppelin Abg. Dr. Gesine Lötzsch Abg. Alexander Bonde |
Beschlussfassung |
|
|
i) |
Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie (9. Ausschuss) - zu dem Antrag der Abgeordneten Ulla Lötzer, Dr. Barbara Höll, Werner Dreibus, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE Konjunkturprogramm gegen die drohende Wirtschaftskrise - zu dem Antrag der Abgeordneten Christine Scheel, Bärbel Höhn, Kerstin Andreae, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Nachhaltig investieren in Klima, Bildung, soziale Gerechtigkeit - Drucksachen 16/10619, 16/11023, 16/11646 - Berichterstattung: Abg. Dr. Michael Fuchs |
Beschlussfassung |
|
|
j) |
Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Arbeit und Soziales (11. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Brigitte Pothmer, Markus Kurth, Britta Haßelmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Gerechtigkeit und Chancen statt Ausgrenzung und Armut - Drucksachen 16/11755, 16/11899 - Berichterstattung: Abg. Werner Dreibus |
Beschlussfassung |
|
|
ZP 6 |
Beratung des Antrags der Abgeordneten Werner Dreibus, Dr. Barbara Höll, Dr. Gesine Lötzsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE Dividenden streichen - Gewinne in Arbeitsplätze investieren - Drucksache 16/11877 - |
Überweisungsvorschlag: Finanzausschuss (f) A. f. Wirtschaft und Technologie Haushaltsausschuss |
Zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland liegen vier Änderungsanträge der Fraktion Die Linke vor. Über einen Änderungsantrag werden wir später namentlich abstimmen.
Außerdem liegt zu dem genannten Gesetzentwurf je ein Entschließungsantrag der Fraktionen der FDP, der Linken und des Bündnisses 90/Die Grünen vor.
Über den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD zur Änderung des Grundgesetzes werden wir später - zur dritten Beratung, versteht sich - ebenfalls in namentlicher Abstimmung befinden. Ich mache darauf aufmerksam, dass zur Annahme dieses Gesetzentwurfes die Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages erforderlich ist.
Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für diese Aussprache zwei Stunden vorgesehen. - Auch das ist offensichtlich einvernehmlich. Dann können wir so verfahren.
Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort zunächst dem Bundesminister der Finanzen, Peer Steinbrück.
Peer Steinbrück, Bundesminister der Finanzen:
Sehr geehrter Herr Präsident! Dann haben mir meine Mitarbeiter den ersten Satz aufgeschrieben: Meine Damen und Herren! Ich habe leider kein ausformuliertes Manuskript; aber ich werde mich trotzdem bemühen, entgegen den Erwartungen des Kollegen Michael Glos Subjekt, Prädikat und Objekt in freier Rede aneinanderzufügen.
Man kann nicht beides haben: Man kann nicht auf der einen Seite einen starken Konjunkturimpuls haben und auf der anderen Seite eine Absenkung der Neuverschuldung. Das ist eine Debatte gewesen, die uns in den letzten Wochen und Monaten, wie ich finde, sehr stark beschäftigt hat. Ich kann mich erinnern, wie die Bundesregierung bis weit in den Dezember hinein von Verbänden, von Gewerkschaften und darüber hinaus auch von Sachverständigen und Wirtschaftswissenschaftlern aufgefordert worden ist, einen sehr starken Konjunkturimpuls zu setzen. In dem Augenblick, wo die Bundesregierung nach dem Konjunkturpaket I ein in der deutschen Geschichte ungewöhnlich groß dimensioniertes Konjunkturpaket II der Öffentlichkeit vorgestellt hat, ist aber nur noch von der Rekordverschuldung die Rede. Beides geht nicht zusammen, will sagen: Ein solcher Konjunkturimpuls ist nach Lage der Dinge nicht ohne eine Erhöhung der Neuverschuldung zu haben.
Es gehen auch nicht drei Sachen zusammen, nämlich erstens die Neuverschuldung bzw. generell die Schulden herunterzuführen, zweitens die öffentlichen Investitionen zu verstärken und drittens ein Steuersenkungsprogramm der deutschen Öffentlichkeit in den Dimensionen vorzustellen, wie wir es in den letzten Wochen und Monaten gehört haben.
Es macht auch keinen Sinn, in den Debatten - dies konnte ich auch in den Ausschusssitzungen insbesondere in Beiträgen von Oppositionspolitikern verfolgen - das Rezessionsproblem gegen das Schuldenproblem zu schieben. In dem Augenblick, in dem wir gemeinsam die Überzeugung gewonnen haben, dass die Politik in Deutschland in dieser konkreten Situation keinen Attentismus zeigen darf, sondern handeln muss, kann man sich über die Notwendigkeit, die Maßnahmen über Kredite zu finanzieren, nicht beklagen. Dann geht es allein um die Frage, wie wir mit diesen Schulden zukünftig umgehen wollen. Deshalb freue ich mich darüber, dass es in der gestrigen Sitzung der Föderalismuskommission II gelungen ist, eine Schuldenbremse zu verankern, die nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch den Märkten, was wichtig ist, und unseren internationalen Partnern signalisiert - insbesondere mit Blick auf die Glaubwürdigkeit des Stabilitäts- und Wachstumspaktes -, dass wir es mit dem Vorsatz ernst meinen, in den Zeiten, die nicht von einer tiefen Rezession gekennzeichnet sind, die Schuldenaufnahme zurückzuführen, um das Ziel zu erreichen, das wir uns eigentlich für 2011 vorgenommen haben. Ich bedanke mich ausdrücklich bei den beiden Vorsitzenden, Herrn Oettinger und Herrn Struck, dass es gestern gelungen ist, dieses wichtige Thema einer Lösung zuzuführen.
Die Bürger erwarten, dass der Staat handelt. Deshalb ist es richtig, in dieser historisch relativ einmaligen, tiefen Rezession eine antizyklische Wirtschafts- und Finanzpolitik zu betreiben. Dies tut die Bundesregierung. Alles zusammen - Konjunkturpaket I, Konjunkturpaket II und das, was etwas technokratisch als automatische Stabilisatoren bezeichnet wird - führt zu einem Beitrag in einer Größenordnung von mehr als 4 Prozent des Bruttosozialproduktes in den Jahren 2009 und 2010. Damit leistet die Bundesregierung den Löwenanteil dessen, was beim Europäischen Rat im Dezember als gemeinsame Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur verabredet worden ist. Sie wissen, dass dort eine Dimension von 200 Milliarden Euro festgelegt worden ist. Die Bundesregierung wird weit über ihren Anteil am europäischen Bruttosozialprodukt hinaus dazu beitragen. Gelegentlich habe ich den Eindruck, dass die Vertreter der Länder, die bis weit in den November und sogar in den Dezember hinein die Regierung der Bundesrepublik Deutschland aufgefordert haben, zu handeln, noch ihre lieben Schwierigkeiten haben werden, ihre eigenen Beiträge entsprechend der Absichten, die dort verkündet worden sind, zu belegen.
Wir haben es mit einer Kategorie zu tun, die im Augenblick keine Hochkonjunktur hat - sie wirkt prägend auf die Finanzmärkte und unterliegt dem Eindruck dieser wirtschaftlich schlechten Phase -: Vertrauen. Denjenigen, die bereits jetzt, vor Verabschiedung dieses Konjunkturpakets, darüber spekulieren, was noch alles erreicht werden müsste, was noch alles obendrauf gelegt werden müsste, rufe ich zu, dass sie zum Abschwung der Kategorie Vertrauen beitragen, weil sie Unsicherheit verbreiten.
Deshalb bitte ich darum, zu vermitteln, wie wichtig es ist, diese Konjunkturmaßnahmen wirken zu lassen. Wir sollten erst dann zu einer kritischen Bestandsaufnahme kommen, wenn es die ersten Anzeichen dafür gibt, wie diese Konjunkturmaßnahmen tatsächlich wirken.
Das Konjunkturpaket II ist richtig ausgerichtet. Ich widerspreche all denjenigen, die den Eindruck haben, das sei eine Art Bauchladen. Fünf maßgebliche Kompassweisungen prägen dieses Paket: Das ist zum Ersten die Notwendigkeit, Investitionen zu fördern. Vor dem Hintergrund einer richtigen Logik müssen wir etwas tun, was zur Modernisierung des Landes beiträgt und über diesen Konjunkturzyklus hinaus positive Wirkung entfaltet. Zweitens wird die Nachfrage durch eine Reihe von Maßnahmen gefördert, bis hin zu einer steuerlichen Komponente. Darüber hinaus wird die Leitindustrie in Deutschland, die Automobilindustrie, die zusammen mit der Zulieferindustrie nach wie vor jeden siebten bis achten Arbeitsplatz prägt, gefördert. Viertens wird es eine Arbeitsmarktpolitik geben, die darauf gerichtet ist, dass die Menschen nicht entlassen, sondern weiterqualifiziert werden. Die Schuldenbremse habe ich schon erwähnt, das ist die fünfte richtige Kompassweisung.
Die Abwrackprämie hat sich nach einem fulminanten Start als eine richtige Maßnahme herausgestellt.
Ich kann mich an viele kritische Einlassungen erinnern. All die Kritiker sind widerlegt worden.
Das Echo darauf, dass kommunale Investitionen mit mehr als 13 Milliarden Euro gefördert werden, ist - insbesondere aus dem kommunalen Raum - so positiv, dass wir das nicht kaputtreden sollten.
Es wird darauf ankommen, dass wir die Kriterien dieses Investitionsprogramms wirklich durchsetzen: Erstens sollen 70 Prozent dieser Maßnahmen unmittelbar zu kommunalen Investitionen führen. Zweitens geht es um das Kriterium der Zusätzlichkeit.
Ich bin dankbar dafür, dass im Haushaltsausschuss auf diesen Akzent Wert gelegt worden ist. Es gibt entsprechende Formulierungen und Vorschläge, wie das gewährleistet werden soll. Darauf will ich aus Zeitgründen nicht im Einzelnen eingehen. Es wird drittens darum gehen, dass insbesondere finanzschwache Kommunen partizipieren können; sie haben den größten Nachholbedarf. Es wird viertens darum gehen, dass der überwiegende Anteil wie verabredet in Bildungseinrichtungen investiert wird. Das sind die vier maßgeblichen Orientierungen, die für dieses Investitionsprogramm gelten.
Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei denjenigen Ländern bedanken, die bereits die ersten Entscheidungen darüber getroffen haben, dass dieses Geld in den Kommunen zur Wirkung kommt.
Das sind übrigens eine ganze Reihe von Ländern, die schon entsprechende Kabinettsentscheidungen herbeigeführt haben. Insbesondere möchte ich mich bei denjenigen Ländern bedanken, die bereits jetzt zum Ausdruck gebracht haben, dass sie im Zweifelsfall für ihre finanzschwachen Kommunen den Eigenanteil übernehmen oder Gewährleistung dafür übernehmen, dass er aufgebracht werden kann.
Ich will im zweiten Teil meiner Ausführungen einige allgemeine Bemerkungen zu den uns sehr stark beschäftigenden Problemen machen. Wir merken zunehmend, dass auf den internationalen Bühnen protektionistische Tendenzen nicht mehr ausgeschlossen werden. Die Stichworte sind Ihnen allen bekannt, insbesondere mit Blick auf das Konjunkturpaket in den USA, wo von einer Buy-American-Klausel die Rede gewesen ist. Wir haben es in Großbritannien mit einer Bewegung zu tun - ?Put British workers first!? -, die sich auch damit beschäftigt. Ich glaube, dass insbesondere die Bundesrepublik Deutschland ein massives Interesse daran hat, sich bei den anstehenden internationalen Treffen dafür einzusetzen, dass die Welt nicht denselben Fehler macht, den sie 1930 mit einem Überholungswettbewerb an protektionistischen Maßnahmen gemacht hat.
Ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland, das über 40 Prozent seiner Wirtschaftsleistung in Außenwirtschaftsbeziehungen generiert, ist wie kein anderes Land darauf angewiesen, dass diesen protektionistischen Tendenzen oder Reflexen Einhalt geboten wird. Die damalige Wirtschaftskrise von 1929/1930, an die gelegentlich in historischen Betrachtungen erinnert wird, war gar nicht so sehr vom Crash an der New Yorker Börse im Oktober 1929 geprägt, sondern sehr viel mehr davon, dass es 1930 unter dem damaligen amerikanischen Präsidenten Hoover zu einem Gesetz kam, durch das die Importzölle von sage und schreibe 20 000 Produkten in schwindelerregende Höhen gesetzt wurden. Dies hatte den Effekt, dass alle anderen Länder im Rahmen eines Überbietungswettbewerbs mit der Einführung von entsprechenden Zöllen nachgezogen haben. Als Ergebnis war der Welthandel 1933 im Vergleich zu 1928 um zwei Drittel eingefroren bzw. zurückgeführt. Das war der eigentliche Treibsatz, der Verstärker in der Folge des Börsencrashs vom Oktober 1929. Wir werden alles tun müssen, damit sich so etwas in der jetzigen Phase, in der wir uns bewegen, nicht einmal ansatzweise wiederholt.
Ich habe bereits heute und morgen beim G-7-Finanzministertreffen in Rom, bei dem übrigens auch der nächste Finanzgipfel am 2. April dieses Jahres und die zwischenzeitlich anstehenden vorbereitenden Sitzungen für den Finanzgipfel geplant werden, die Möglichkeit, dieses Thema zu erörtern. Ich werde sehr genau zuhören, insbesondere bei dem, was mein neuer amerikanischer Kollege vielleicht über die Beratungen zum amerikanischen Konjunkturprogramm, die inzwischen im Repräsentantenhaus und im Senat vollzogen wurden, berichten kann.
Nächste Bemerkung. Die Situation der Banken nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus bereitet nach wie vor erhebliche Sorgen. Wir werden Ihnen in den nächsten Tagen und Wochen eine Novelle des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes vorstellen, die bestimmte Lerneffekte berücksichtigen wird, die wir durch dieses Gesetz und die über dieses Gesetz eingerichteten Maßnahmen und Institutionen erworben haben. Es geht insbesondere um das Thema, wie Banken nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa mit den faulen Wertpapieren umgehen, die belastend auf ihren Bilanzen liegen. Umgangssprachlich formuliert: Es geht darum, wie wir dazu beitragen können, dass diese Banken nicht in einen weiteren prozyklischen Strudel geraten, weil sie immer größere Abschreibungen mit einem immer größeren Verzehr ihres Eigenkapitals und damit einer immer größeren Bedrohung vornehmen müssen.
Kurzfristig werden wir aber nicht das Problem der Bilanzbereinigung in dem Sinne lösen können, wie es in den letzten Wochen von vielen debattiert wurde. Sie kennen meine nicht nur große Skepsis, sondern definitive Ablehnung, wenn in Deutschland darüber spekuliert wird, dass ein zentralisiertes systemübergreifendes Institut à la Bad Bank eingerichtet werden soll, das diese faulen Assets aufnehmen soll.
Das bedeutet nicht, dass wir nicht auf anderem Wege eine Lösung finden müssen. Aber diese Lösung wird nicht so aussehen, wie es in den letzten Wochen von vielen angedacht und angeheizt wurde, von einigen auch aus einem unmittelbaren Interesse. Dieses unmittelbare Interesse ist davon geprägt, dass die Kapitalisierung einer solchen Bank mit öffentlichen Geldern vollzogen werden müsste. Ich werde es Ihnen und mir nicht zumuten, Ihnen von diesem Pult aus etwas abzuverlangen, ein solches Institut mit öffentlichem Geld zu kapitalisieren, das spielend eine Dimension von 150 bis 200 Milliarden Euro erreichen könnte.
Ich möchte Ihnen signalisieren - Sie werden mir nachsehen, dass ich an dieser Stelle nicht sehr konkret werde -: Das ist eine der größten Herausforderungen, mit denen wir es im Augenblick zu tun haben. Wir werden dafür Sorge tragen müssen, dass die Kapitalinjektionen mit öffentlichen Geldern und Garantien im Rahmen der bisherigen Leistungen des SoFFin auf der Basis des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes nicht verloren gehen, weil der Bund möglicherweise nicht die Kontrolle darüber hat, wie mit diesen Garantien und Kapitalinjektionen umgegangen wird.
Ich für meinen Teil kann nicht verantworten, dass solche Maßnahmen fortgesetzt werden - dabei handelt es sich nämlich um ein großes schwarzes Loch riesigen Ausmaßes -, ohne dass tatsächlich das Ziel der Restrukturierung und Stabilisierung der davon begünstigten Banken als Licht am Ende des Tunnels erkennbar ist.
Ich will einen letzten Gesichtspunkt aufgreifen - ich erinnere mich, dass Herr Kauder ihn bereits in der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfes angesprochen hat -: die Bankenaufsicht in Deutschland. Zu diesem Thema will ich ein paar Worte verlieren. Ich bitte darum, keine Vorschläge zu machen oder öffentlich zu debattieren, die im ersten Augenblick vielleicht einen intellektuell bestechenden Eindruck hinterlassen mögen, die aber nicht funktionieren würden. Viele Vorschläge, die gemacht werden - die mich auch erreichen -, würden darauf hinauslaufen, die Bankenaufsicht in Deutschland über BaFin und Bundesbank zusammenzuführen. Das favorisieren offenbar viele.
Das ist eine ausgesprochen schwierige Operation. Warum? Weil die BaFin eine Eingriffsverwaltung ist. Sie erlässt Hoheitsakte, die anschließend übrigens auch Gegenstand von Verwaltungsgerichtsverfahren sein können. Die Verschmelzung der BaFin, einer klassischen Eingriffsverwaltung, die der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesfinanzministeriums untersteht, mit einer Einrichtung, die von Verfassungs wegen ein Höchstmaß an Unabhängigkeit hat, die definitiv keine Eingriffsverwaltung sein und definitiv nicht der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesfinanzministeriums unterworfen werden möchte, wird nicht funktionieren.
Wenn das einigen von Ihnen unglaubwürdig erscheint, weil ich es sage und weil ich Ihrer Meinung nach vielleicht als zu parteiisch gelte, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie vor Ihren nächsten öffentlichen Einlassungen ein Gespräch mit dem Bundesbankvorstand führen würden, damit er Ihnen unmittelbar seinen Eindruck schildert, wie eine solche Verschmelzung zu bewerten ist. Das ändert nichts daran, dass die Bemühungen um eine stärkere und effizientere Bankenaufsicht in Deutschland fortgesetzt werden. Sie können sicher sein, dass ich, auch unter Berücksichtigung der Ergebnisse eines Gutachtens, das ich in diesen Tagen bekomme, zuerst der Bundesregierung und dann Ihnen, dem Deutschen Bundestag, entsprechende Vorschläge dazu machen werde.
Von entscheidender Bedeutung ist die Wegstrecke bis zum von mir schon erwähnten Weltfinanzgipfel am 2. April dieses Jahres in London, an dem die Bundeskanzlerin und ich teilnehmen werden. Die Tatsache, dass im Augenblick nur wenig von den Aktionen, die seinerzeit, im November letzten Jahres, in Washington verabredet worden sind, die Rede ist, ist nicht dahin gehend zu interpretieren, dass nicht gearbeitet wird.
Ich will Ihnen nur ganz kurz im Telegrammstil mitteilen, dass vier Arbeitsgruppen eingesetzt wurden, eine unter dem Vorsitz der Bundesrepublik Deutschland, die sich sehr aktiv mit den Themen, die in London zu erörtern sind, beschäftigen, unter anderem mit der Umsetzung der Maßnahmen, die bereits verabredet worden sind. Die Bundesregierung wird sehr gezielt weitere Impulse setzen, um in den für eine bessere Regulierung der Finanzmärkte entscheidenden Fragen voranzukommen. Als Obersatz gilt nach wie vor die Vereinbarung von Washington, die da lautet: Kein Finanzmarktteilnehmer, kein Finanzmarkt und kein Finanzmarktprodukt der Welt soll zukünftig keiner Regulierung unterworfen sein.
Meine Damen und Herren, die Bürger erwarten, dass wir angesichts dieser Krise verantwortungsbewusst gegensteuern. Dies erwarten sie nicht nur von der Bundesregierung, sondern auch vom Deutschen Bundestag, und ich füge hinzu: auch vom Bundesrat.
Deshalb ist meine Bitte an Sie, dieser Verantwortung in der gegenwärtigen Situation, angesichts der tiefen Krise, die wir derzeit erleben, gerecht zu werden und dem Konjunkturpaket II in der zweiten und dritten Lesung sowie im zweiten Durchgang im Bundesrat zuzustimmen.
Der britische Premier Churchill hat einmal gesagt:
Es ist sinnlos, zu sagen: Wir tun unser Bestes. Es muss dir gelingen, das zu tun, was erforderlich ist.
Dieses Konjunkturpaket, meine Damen und Herren, ist erforderlich.
Vielen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält nun der Kollege Dr. Guido Westerwelle für die FDP-Fraktion.
Dr. Guido Westerwelle (FDP):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will mich vorab an Sie, Herr Minister zu Guttenberg, wenden. Sie sind jetzt, darf man sagen, wenige Stunden im Amt. Da dies die erste Debatte sein wird, in der Sie als Bundeswirtschaftsminister das Wort ergreifen, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ich Ihnen auch im Namen der liberalen Opposition viel Erfolg wünsche. Wir sind sicher, dass Sie das Zeug dazu haben, ein guter Minister zu werden,
und im Interesse unseres Landes wünschen wir Ihnen das ausdrücklich.
- Schade, dass das Raunen bei den Sozialdemokraten im Fernsehen nicht übertragen wird. Dieses Raunen ist mir völlig unverständlich. Ist es klimatisch schon so weit, dass etwas, was für Demokraten eine Selbstverständlichkeit sein sollte,
nämlich dass man einem neuen Minister Glück wünscht, hier Gegenstand parteipolitischen Rumorens wird? Man muss sich schon wundern!
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein weiteres Wort muss gesagt werden - auch wenn Sie es wiederum kommentieren mögen -: Ich meine, dass wir mit Michael Glos einen Bundeswirtschaftsminister hatten, dem wir trotz mancher Meinungsunterschiede zu Dank verpflichtet sind. Die Lässigkeit, mit der jetzt abschätzig über den Kollegen Glos gesprochen wird, die versteckten Bemerkungen, aber auch die offenen Einführungen in Reden hier - ich finde, so sollte man das nicht machen!
Eine zweite Bemerkung. Herr Finanzminister, Sie haben das Thema Bankenaufsicht angesprochen. Ich hatte ursprünglich nicht vor, dazu etwas zu sagen; aber da Sie dieses Thema angesprochen haben, will ich darauf kurz eingehen. Sie haben sich gegen das gestellt, was Herr Kollege Kauder in der letzten Debatte zum Konjunkturpaket erklärt hat. Mich verwundert das; denn wir hatten die Bundeskanzlerin in ihrer Regierungserklärung so verstanden, dass genau das, nämlich eine Neuordnung der Bankenaufsicht, stattfinden muss. Wir unterstützen die Union, wenn sie die Renovierung der Bankenaufsicht jetzt angehen will. Aber da gehören keine faulen Ausreden in dieses Haus, da gehört Handlung in dieses Haus. Wenn man sieht, dass die Bankenaufsicht in den letzten Jahren nicht ausreichend gewirkt hat, weil sie zerfleddert war, muss man dies ändern.
Ich möchte jetzt auf das, was Herr Finanzminister Steinbrück zum Konjunkturpaket wohltuend sachlich vorgetragen hat, eingehen. Aus Sicht der liberalen Opposition ist dieses Konjunkturpaket enttäuschend. Es wird wenig wirken; aber die Schulden werden unfassbar lange bleiben. Das eigentliche Problem ist doch das Strukturproblem. Wenn man in einer solchen Situation - die Lage ist besonders ernst - in unserem Lande etwas zum Besseren wenden möchte, darf man keinen Bauchladen, kein Sammelsurium von Maßnahmen beschließen und da und dort mit der Gießkanne Steuergelder verteilen, dann muss man einen großen Wurf wagen.
Wenn es stimmt, dass 50 Prozent der Wirtschaft Psychologie sind, dann wird man eine Wende in diesem Lande zugunsten von Anstrengungen, Leistung und Investitionen mit diesem Sammelsurium von Maßnahmen nicht erreichen. In einer großen Krise ist ein großer Wurf gefragt.
Das ist der große Unterschied zwischen den Konzepten, die in diesem Hause vertreten werden, zwischen dem Konzept der Regierung und dem Konzept der liberalen Opposition. Herr Bundeswirtschaftsminister, ich hoffe, dass das, was Sie bis vor fünf Tagen, als Sie noch Generalsekretär der CSU waren, zum Thema Steuersenkungen gesagt haben, auch jetzt, da Sie Bundeswirtschaftsminister sind, Ihr Denken prägen wird. Es wäre gut für unser Land.
Wir führen am heutigen Tage im Deutschen Bundestag eine Debatte über eine zweifelsohne außergewöhnliche Lage in Deutschland und über ein vom Umfang her, von der Schuldenaufnahme her, bisher noch nie gesehenes Konjunkturpaket.
Niemand bestreitet, dass Sie Ihr Bestes versuchen, aber es gelingt Ihnen leider nicht. Das ist der Unterschied auch zu dem, was beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika am gestrigen Tage von Präsident Obama mitgeteilt worden ist. Von dem Konjunkturpaket des amerikanischen Präsidenten, so haben wir gestern mitgeteilt bekommen, gehen fast 300 Milliarden Dollar in Steuersenkungen, während Sie die Steuersenkungen so schmalbrüstig anlegen, dass davon wirklich kein konjunktureller Impuls, weder für die Nachfrage noch für Investitionen, ausgehen kann.
Das ist das, was wir anders machen wollen und auch anders machen würden. Wir sind der Überzeugung: Wenn in einer solchen Lage ein großes Konjunkturpaket beschlossen werden soll, wenn in einer solchen Lage der Staat schon Schulden macht, dann sollte er damit wenigstens die Bürgerinnen und Bürger entlasten.
Das beste Konjunkturprogramm ist es, die Leistungsbereitschaft anzuregen.
Wenn die Menschen Lust auf Leistung haben, weil der Staat ihnen mehr übrig lässt von dem,
was sie sich erarbeitet haben, dann springt die Konjunktur an - und nicht mit irgendwelchen Renovierungsprogrammen.
Nun hören wir meine, Damen und Herren, dass Sie das ja täten. Da muss man klar sagen: Wir haben einen unterschiedlichen Denkansatz. Sie sind der Überzeugung: Es ist klüger, von Branche zu Branche, von Unternehmen zu Unternehmen Steuerschecks auszustellen. - Wir sagen: Es ist vernünftiger, nicht einzelne Unternehmen, die in Schwierigkeiten sind, mit Steuerschecks zu unterstützen. Ausnahmen wird es immer geben. Vernünftiger, als Branchen zu subventionieren, vernünftiger, als Unternehmen nach Unternehmen an den Steuertropf zu hängen, wäre es, die ganze Volkswirtschaft zu entlasten, alle, die arbeiten, zu entlasten. Mehr Mut bei den Steuersenkungen - das braucht diese Republik, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Dann haben wir gehört - und das finden wir bemerkenswert -, dass das, was die FDP vorschlage, schon deshalb verhindert werden müsse. Sie haben ja keinen einzigen Antrag - das ist Ihr gutes Recht - der FDP-Fraktion, weder in den Ausschüssen noch hier im Hohen Hause, in den letzten Wochen akzeptiert. Das muss man nur zur Kenntnis nehmen; das ist Ihr Recht. Übrigens hat Präsident Obama großen Wert darauf gelegt, dass er mit allen politischen Kräften ins Gespräch kommt. Er hat versucht, auch überparteilich ein Paket zu schnüren. Wir halten fest: Diesen Versuch haben Sie zu keiner Stunde ernsthaft gestartet.
Aber, meine Damen und Herren, das ist Ihr Recht. Sie haben die Mehrheit, und wir werden ja sehen, wohin das führt.
Aber dann wollen wir einmal über die Steuersenkungen reden, die wirklich nötig wären. Würde man nur die Erhöhung der Freibeträge, die Sie jetzt häppchenweise bis zum Jahr 2010 für die Familien pro Kopf auf mehr als 8 000 Euro erhöhen wollen, vorziehen, dann müsste der Staat 800 Millionen Euro mehr ausgeben. Diese Entlastung der Familien würde 800 Millionen Euro kosten. Zum Vergleich das, was in diesem Paket steht: In dem Paket geben Sie 100 Millionen Euro aus für die Erhöhung der Mittel für Entwicklungshilfe, und Sie geben 650 Millionen Euro aus für die Renovierung der Ministerien. Da sagen wir Ihnen: Das ist die falsche Prioritätensetzung. Die Entlastung der Familien wäre jetzt in dieser Stunde richtig, um die Lage in Deutschland zu wenden.
Was hat das denn mit einer Politik für Reiche zu tun? Das ist doch reine Polemik, was da vorgetragen wird. Die Freibeträge für Familien zu erhöhen, ist keine Politik für Reiche, sondern es sollte eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner jenseits der Parteigrenzen in diesem Hause sein.
Man wundert sich darüber, dass Sie das nicht tun.
- Die Angaben der Bundesregierung dazu lauten: 0,8 Milliarden, also 800 Millionen Euro.
Das zweite Thema betrifft die Zinsschranke. Da könnten Sie ja noch argumentieren und sagen: Wer die Zinsschranke wieder abschaffen will, die mit der Unternehmensteuerreform beschlossen wurde, der will etwas für Unternehmen tun. Ja - das sagen wir ausdrücklich -, das ist richtig,
weil wir nämlich in einer Zeit leben, in der vor allen Dingen der Mittelstand darunter leidet, dass er keine Kredite mehr bekommt. Gerade weil der Mittelstand hinsichtlich seiner Eigenkapitaldecke nicht so gut ausgestattet ist, ist es jetzt notwendig, wieder zu ändern, was eingeführt wurde. Es ist ein Fehler, dass man den Mittelstand auch noch für Zinsen Steuern zahlen lässt. Das muss geändert werden.
Wenn ich Ihr Programm richtig verstanden habe, dann wollen Sie das übrigens auch.
Etwas, was die SPD und die CDU/CSU auf ihren Parteitagen beschlossen und in Interviews verkündet haben, ist zum Beispiel die Senkung des Eingangssteuersatzes. Das ist doch nun wirklich etwas, was wir hier gemeinsam beschließen könnten.
Sie beschließen die Senkung des Eingangssteuersatzes von 15 auf 14 Prozent. Gleichzeitig sagen Sie, dass Sie den Eingangssteuersatz auf 12 Prozent senken müssten.
Damit wollen Sie in den Wahlkampf gehen; das hat der Finanzminister in einem Interview mit der Bild am Sonntag angekündigt. Ich halte fest: Die SPD will den Eingangssteuersatz auf 12 Prozent senken, die CDU/CSU will den Eingangssteuersatz auf 12 Prozent senken, wir wollen das auch. Warum beschließen wir das dann nicht jetzt, da die Lage so problematisch ist?
Was hat es mit irgendeiner Begünstigung von Reichen zu tun, wenn man den Eingangssteuersatz senkt? Wir bieten Ihnen an, dass wir das noch in dieser Stunde beschließen können. Tun wir etwas für die Empfänger kleinerer und mittlerer Einkommen! Das ist das Konjunkturprogramm, das Deutschland braucht.
Stattdessen sehen wir, wie die Gelder in den Länderhaushalten schon ausgegeben werden. Das sage ich übrigens überparteilich, damit wir uns hier nicht missverstehen. Wir alle kennen unsere jeweiligen Pappenheimer, die ohne jeden Zweifel aus allen Parteien kommen. Dieses Thema kennen wir alle. Hierüber brauchen wir uns hier im Deutschen Bundestag nicht zu beklagen. Es ist ja auch bemerkenswert, dass diejenigen, die so viel Geld bekommen, heute so umfangreich auf der Bundesratsbank vertreten sind. Das ist aber ein anderes Thema an dieser Stelle.
- Ja, ich nehme das ausdrücklich zurück. Heute ist Bundesrat. Deswegen ist es nett, dass wenigstens Sie, Herr Sellering, fehlen. Ich nehme das zurück.
In die Länderhaushalte werden schon Mittel für die Renovierung der Finanzämter eingestellt. Das heißt, über das Konjunkturpaket werden auch die Finanzämter renoviert. Aber für Steuersenkungen ist kein Geld da. Ist Ihnen eigentlich klar, welche Ironie es in dieser Stunde ist, dass die Bürger erleben müssen, dass bei uns zu wenig passiert, während die Finanzämter renoviert werden? Was für ein Konjunkturprogramm in dieser Republik!
Es ist richtig und auch vernünftig, dass Sie beispielsweise in die Bildung investieren. Das unterstützen wir nachdrücklich, damit wir uns hier nicht missverstehen. Das haben wir auch in den Ausschüssen unterstützt. Es ist gut, dass das geschieht. Die Kritik der Grünen und aus den anderen Reihen dieses Hauses ist übrigens ebenso berechtigt. Es ist eben nicht richtig, dass man alleine die Gebäude saniert, während man nichts für Investitionen in die Köpfe bereitstellt und es keine Qualitätsverbesserung des Unterrichts gibt. Das wissen wir, und ich denke, darin sind wir uns auch einig. Das wird sich im Vollzug ändern müssen.
In die Straßen investieren Sie auch; das ist richtig. Auch hier lohnt sich ein Blick ins Detail, um zu sehen, wie es bei den Straßen tatsächlich aussieht: Tiefbau nein, Hochbau ja. Mit anderen Worten: Die Straßen mit den Löchern dürfen nicht mit diesen Mitteln saniert werden, aber Lärmschutzwände dürfen darum herumgebaut werden. Da fragt man sich wirklich: Wie überzeugend ist die Konsistenz eines solchen Programms?
Zur Abwrackprämie. Herr Finanzminister, Sie sagen, die Abwrackprämie werde der große Renner. Wir wären Ihnen sehr verbunden, Herr Finanzminister, wenn Sie jetzt irgendwann einmal veröffentlichen würden - diese Zahlen haben Sie doch längst -, wie viele von diesen angeblich super gekauften Autos eigentlich wirklich in Deutschland produziert werden. Das ist doch das eigentliche Thema.
Ich will es Ihnen ganz offen sagen: Ich halte es für völlig falsch, dass Sie mit der Abwrackprämie dazu beitragen, den Absatz kleiner asiatischer Autos zu erhöhen, währen Sie mit der Kfz-Steuererhöhung gleichzeitig die in Deutschland produzierende Automobilindustrie noch einmal abwürgen.
Das halten wir für falsch, und das sagen wir an dieser Stelle auch.
- Ich bitte die Kameramänner, nicht nur mich, sondern bei dieser Unruhe auch die Herrschaften im Saal zu zeigen, weil das eine so bedeutende Stunde der Republik ist. Die Bürgerinnen und Bürger werden sich darüber dann auch eine Meinung bilden können.
Ich glaube, meine sehr geehrten Damen und Herren, noch ist es unser Recht, dass wir unsere Punkte vortragen, auch wenn Sie noch die Mehrheit haben.
Sprechen wir noch einmal über die Krankenkassen, auch wenn Ihnen das nicht gefallen mag, aber es ist trotzdem notwendig. Sie verkaufen eine Senkung der Krankenkassenbeiträge als Konjunkturprogramm. Das ist in unseren Augen eine wirkliche Veräppelung der Bürgerinnen und Bürger.
Was passiert hier? Erst haben Sie eine Gesundheitsreform beschlossen, die dazu geführt hat, dass zum 1. Januar dieses Jahres die höchsten Krankenkassenbeiträge gezahlt werden, die jemals bezahlt werden mussten. Ein paar Wochen später senken Sie nun mit Steuergeldern die Krankenkassenbeiträge. Das hat nichts mit einem Konjunkturprogramm zu tun. Es wäre besser gewesen, die ganze Gesundheitsreform wieder einzustampfen. Das wäre ein Konjunkturprogramm. Zu solchen Strukturreformen fehlt Ihnen aber der Mut.
Meine Damen und Herren, zum Schluss möchte ich noch eine Bemerkung zu den privaten Investitionen machen. Sie haben einen ausschließlich staatlichen Blick auf diese Dinge. Das halten wir für falsch. Sie sprechen davon, welche Ausgaben der Staat tätigen müsse. Was Sie aber schaffen sollten, ist eine Lösung der bürokratischen Bremsen beispielsweise für Investitionen. Heute Morgen beschließen Sie das Konjunkturprogramm, heute Mittag beschließen Sie die Verschärfung des Außenwirtschaftsgesetzes. Wir sollten Investitionen nach Deutschland einladen, aber nicht nach Hause schicken.
Allein bei den Flughäfen warten etwa 20 Milliarden Euro privater Mittel darauf, investiert zu werden. Bringen Sie endlich Ihre Ideologie in die Geschichte hinein, damit das beschlossen werden kann! In der Energiewirtschaft warten 20 bis 40 Milliarden Euro privater Gelder darauf, beschlossen zu werden. Steigen Sie aus aus einer ideologischen Energiepolitik! Werden Sie wieder vernünftig! Das wäre ein Konjunkturprogramm für unser Land.
Alles in allem muss man leider sagen: Die Schulden werden bleiben, aber für die Konjunktur und für die Bürgerinnen und Bürger wird dabei sehr wenig herausspringen. Sie haben in Ihrer ersten Rede zu diesem Thema gesagt, Frau Bundeskanzlerin, Sie würden das mit der Schuldentilgung dann so überzeugend machen wie beim Erblastentilgungsfonds. Das hat sich nun wirklich als eine Posse herausgestellt; Herr Vizekanzler, das betrifft Sie übrigens auch. Sie haben gesagt, Sie würden das genauso machen, wie Sie die Schulden beim Erblastentilgungsfonds zurückgezahlt haben. Heute stellen wir fest, dass weniger als die Hälfte zurückgezahlt und mehr als die Hälfte umgeschuldet wurde. Umschuldung ist aber keine seriöse Finanzpolitik.
Wenn man etwas für die Konjunktur tut, was heute in der Tat getan werden muss, dann entlastet die Bürgerinnen und Bürger, sorgt dafür, dass die kleinen und mittleren Einkommen entlastet werden! Das wäre wirklich eine Wende für unser Land zum Guten.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, auch wenn es Ihnen nicht gefallen hat, meine Damen und Herren von den Regierungsparteien.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort hat nun der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Freiherr zu Guttenberg.
Dr. Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg, Bundesminister für Wirtschaft und Technologie:
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Westerwelle, ich danke Ihnen zunächst sehr für die Glückwünsche. Die Rede hätte uns gefallen, wenn sie denn schlüssig gewesen wäre.
Sie war es leider nicht.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe das Amt des Bundeswirtschaftsministers in einer Wirtschaftskrise übernommen, wie sie das vereinte Deutschland noch nie erlebt hat, und zwar angesichts der Geschwindigkeit, in der sie uns ereilt hat, angesichts der Gleichzeitigkeit, aber auch angesichts der Breite, wie sie global eingetreten ist, und auch angesichts der Folgen für unsere Konjunktur.
Wir befinden uns in einer Wirtschaftskrise, in einer sehr harten Wirtschaftskrise, aber nicht in einer Systemkrise, wie dies in diesen Tagen gern behauptet wird.
- Gerade von Ihnen. - Unser gewachsenes und unser Zukunftssystem - nicht für Sie, aber für uns - ist und bleibt die soziale Marktwirtschaft.
Mit der sozialen Marktwirtschaft
- und nicht mit Zwischenrufen dieser Qualität -
ist unser Land nach dem Zweiten Weltkrieg aus Schutt und Asche zu einer der weltweit führenden Wirtschaftsnationen aufgestiegen. Es ist bedrückend zu sehen, wie viele - auch von jenen, die sich ihr verhaftet fühlen - heute mit leichter Hand inflationär das Wort ?soziale Marktwirtschaft? im Munde führen, es aber leider kaum noch erklären können und - was so wichtig ist in dieser Zeit - sie auch nicht mehr verteidigen können.
Diese ordnungspolitischen Leitplanken der sozialen Marktwirtschaft dürfen in der Situation, in der wir uns gerade befinden, nicht panisch abgerissen werden.
Sie dürfen eingeengt werden. Sie müssen möglicherweise in Teilen eingeengt, vielleicht auch in Teilen erweitert werden. Es ist sicherlich auch richtig, dass wir in dieser äußerst schwierigen Lage nicht allein und isoliert auf die Selbstheilungskräfte des Marktes vertrauen können.
Aber der Grundsatz bleibt richtig, dass der Staat lediglich den Ordnungsrahmen setzt, den Wettbewerb garantiert und nur dann eingreift, wenn Marktversagen vorliegt. Deswegen sind angesichts der Krise richtige Maßnahmen getroffen worden: die Finanzmarktstabilisierung im Oktober letzten Jahres, das Konjunkturpaket I im November letzten Jahres und das zweite Konjunkturpaket, das wir heute hier debattieren.
Bei allem Kritteln, das wir heute auch schon gehört haben: Noch nie wurde so schnell, so konsequent und so entschlossen auf eine Krise reagiert.
Ludwig Erhard ist dieser Tage viel bemüht worden. Auch er hätte in einer solchen Situation wahrscheinlich zu knapsen gehabt. Das steht außer Frage. Aber die Leitlinie bleibt richtig, was das Verhältnis zwischen Staat und Markt anbelangt. Auch er hätte sich wahrscheinlich keinen Nachtwächterstaat gewünscht.
Mein ausdrücklicher Dank gilt in dieser Phase - da die beschlossenen Maßnahmen meines Erachtens Wirkung zeigen werden - meinem Amtsvorgänger Michael Glos.
Ich glaube, er hat sich ebenso entschlossen, beherzt und mit viel Tatkraft auch für dieses Paket, aber vor allem für dieses Land eingesetzt. Auch mir ist unbegreiflich, mit welchem Stil, mit welcher Kollegialität manche mit einem umgehen, der sich wirklich um dieses Land verdient gemacht hat.
- Frau Künast, Sie sollten das nicht einfach nur in diesem Sinne aufgreifen.
In einer Krise werden gezwungenermaßen Grenzen überschritten. In meinem Grundverständnis waren Konjunkturprogramme bislang auch Grenzen. Die Staatsverschuldung steigt. Auch wird eine Insolvenz als reinigender Mechanismus bei Banken bereits außer Kraft gesetzt. Staatsbeteiligungen bei Banken haben eingesetzt. Selbst Enteignung wird gelegentlich mit allzu rasselnd lauter Stimme ernsthaft diskutiert.
Allerdings ist all das trotz allem keine Kurzschlusshandlung oder der bereits eingetrübte wirtschaftspolitische Kompass, sondern wir tun es für die Menschen in unserem Lande, die erwarten dürfen, dass ein Gemeinwesen seine grundlegenden Aufgaben erfüllt, gerade dann, wenn die Selbstheilungskräfte des Marktes nicht greifen.
Wer müsste sich dann den Fragen stellen, wenn plötzlich kein Geld mehr aus dem Geldautomaten käme? Wer müsste sich dann den Fragen stellen, wenn die Gaslieferungen ausblieben? Wer müsste sich den Fragen stellen, wenn plötzlich die Mülleimer aufgrund kommunaler Zahlungsunfähigkeit nicht mehr geleert würden? Ja, es wurden Grenzen überschritten. Aber wir müssen sie überschreiten, weil sich einige am Marktsystem auch versündigt haben. - Es ist interessant, zu sehen, welches Lächeln von der Linken an dieser Stelle kommt.
Versündigt haben sich staatliche Institutionen in anderen Ländern, die den Geldhahn viel zu weit aufgedreht haben, um eben einmal ein Wachstumsstrohfeuer zu entfachen, aber ebenso einige zutiefst unverantwortliche Manager in Finanzinstituten, die nur um des schicken, gierigen Profits willen das Vertrauen der Menschen missbraucht und erschüttert haben.
Hierbei sind die Verantwortungsübernahme und das Handeln in meinen Augen noch nicht wirklich in Kongruenz gebracht.
Grenzen müssen aber auch wieder zurückgezogen werden. Wir haben sie überschritten, müssen sie aber in Teilen wieder zurückführen, weil zu viel Staatsnachfrage private Initiative und private Investitionen behindert, weil jeder Eingriff in den Wettbewerb Folgeeingriffe erzwingt; einige sehen wir derzeit.
Deswegen muss der Rahmen der sozialen Marktwirtschaft bleiben. Wer dies in einer Extremlage, in einer Notsituation, in der wir uns befinden, selbstgefällig, grundsätzlich und dauerhaft infrage stellt, der riskiert in meinen Augen die Fundamente und die Zukunft unseres Landes.
Was ist weiterhin zu tun? Wir haben konsequent Märkte und Leistungsanreize zu stärken. Wir haben ebenso konsequent den Arbeitsmarkt nicht durch weitere Regulierungen zu strangulieren.
Wir haben den Wettbewerb auf den Energiemärkten weiter zu fördern.
Verehrter Kollege Westerwelle, das von Ihnen angesprochene Thema ist nicht vom Tisch. Jetzt spricht nicht der Generalsekretär der CSU, sondern ein überzeugter Bundeswirtschaftsminister. Möglichkeiten für Steuersenkungen, auch für eine Steuerstrukturreform, gehören in meinen Augen in die Planung für die nächste Legislaturperiode, und zwar über das hinausgehend, was im Konjunkturpaket II dargestellt wurde; das ist richtig.
Wir werden uns mühen und bemühen müssen. Wir werden uns in diesen Tagen auch bemühen müssen, dass wir über die Ausnahme einer ?Ultissima Ratio? hinaus nicht zu leichtfertig mit dem Begriff Enteignung umgehen.
Ein Wort zum 100-Milliarden-Euro-Programm, das in der Verantwortung meines Hauses liegt, zum Wirtschaftsfonds Deutschland. Hier muss der Fokus klar sein. Ein eindeutiger Schwerpunkt liegt bei diesem Programm auf langfristig erhaltenswerten Firmen, die unverschuldet durch die Krise gefährdet sind. Ja, es geht um den Erhalt von Arbeitsplätzen - das ist für uns ein entscheidender Maßstab -, aber es geht nicht um den Erhalt um jeden Preis, vor allem nicht um den Preis der Gefährdung von Arbeitsplätzen an anderen Orten und in anderen Firmen.
Das wäre der falsche Ansatz.
Es geht auch darum, wenn wir ein solches Programm auflegen, mit dem Geld der Steuerzahler verantwortlich umzugehen.
Diese Verantwortung müssen wir wahrnehmen.
Über den nationalen Rahmen hinaus gilt es die jeweiligen Programme und Aktionen auf europäischer und internationaler Ebene abzustimmen. Gestatten Sie mir folgende Anmerkung: Der Begriff Freihandel ist weder eine Phrase noch ein Schimpfwort, sondern eine Notwendigkeit. Dafür dürfen wir eintreten.
Das Gleiche gilt für den fairen Wettbewerb mit Blick auf das, was bereits zum Protektionismus gesagt wurde. Unsere Maßnahmen kosten fraglos sehr viel Geld. Deswegen dürfen wir die nachfolgenden Generationen nicht aus den Augen verlieren. Deswegen ist es richtig, dass eine Schuldenbremse im Grundgesetz verankert wird.
Wir wollen insgesamt stärker aus dieser Krise hervorgehen, als wir hineingeraten sind.
Diese Chance haben wir, und diese Chance sollten wir nutzen. Wir sollten dieses Paket auch nutzen, um den Menschen in unserem Lande wieder Mut zu machen. Das bedeutet aber, dass wir Mut weitergeben und nicht jedes Detail über Wochen und Monate hinweg diskutieren. Dieses Land braucht diesen Mut und ein Stück Zuversicht. Dieses Land braucht die vermittelte Nachricht, dass wir uns nicht über Wochen und Monate hinweg um die Einzelheiten streiten, sondern dass wir gemeinsam bereit sind, den Menschen die Zuversicht, die dieses Land in Ausnahmesituationen immer wieder ausgezeichnet hat, zu geben. Die Menschen in diesem Land haben in Ausnahmesituationen immer wieder Außergewöhnliches geleistet. Das sollten wir durch eigenes Handeln unterstützen.
Deswegen sollten wir zuversichtlich an diese Aufgabe herangehen, das Haupt nicht neigen, sondern hoch erhobenen Hauptes mit gesundem Selbstbewusstsein ohne Hochmut, aber erfahren in der Bewältigung von Krisen, mit dem entsprechenden Eigenmut, mit Zuversicht und mit klaren Linien, die die Bundesregierung aufgezeigt hat, in dieses Jahr blicken. Ich glaube, das können wir. Wir müssen nicht in Sack und Asche gehen, sondern wir haben ein Konzept, das über das Jahr hinaus trägt.
Herzlichen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Oskar Lafontaine ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke.
Oskar Lafontaine (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Präsident der Deutschen Bundesbank hat auf einer internationalen Konferenz festgestellt: Die Weltwirtschaft befindet sich im freien Fall. Ich benutze heute lieber das Bild des Flächenbrandes. Von diesem Flächenbrand sind die Weltfinanzmärkte ebenso wie die gesamte Weltwirtschaft betroffen. Wenn ein Flächenbrand festgestellt wird, dann muss man löschen. Die Löschfahrzeuge stehen bereit. Wir werfen aber der Bundesregierung vor, dass sie diese Löschfahrzeuge nicht einsetzt. Dies will ich jetzt im Einzelnen erläutern.
Der Bundesfinanzminister hat davon gesprochen, es gäbe kein Drehbuch. Es gibt aber sehr wohl Erfahrungen und Maßnahmen, die andernorts gewirkt haben und auf die wir jetzt zurückgreifen könnten. Die Bundeskanzlerin beklagt sich, sie stehe vor einer Nebelwand. Ich glaube nicht, dass diese Analyse ausreichend ist, um mit der gegenwärtigen Krise fertig zu werden.
Nun will ich konkret erläutern, welche Löschfahrzeuge sie nicht einsetzt und damit in großem Umfang dazu beiträgt, dass weitere Milliarden sinnlos verschleudert werden.
Sie versuchen jetzt seit Monaten, den Interbankenhandel, den Fluss des Geldes zwischen den Banken, in Gang zu setzen. Obwohl Sie das seit Monaten versuchen, gelingt Ihnen das nicht. Viele mittelständische Betriebe und sogar viele Großbetriebe, die hervorragende Finanzstrukturen haben, beklagen sich darüber, dass die Kreditbeschaffung immer schwieriger wird. Wenn Sie es nicht endlich schaffen, dass der Interbankenhandel wieder in Gang kommt und die Kredite fließen, dann wird die Wirtschaft immer weiter einbrechen. Deshalb dürfen Sie nicht weiter zögern.
Ich rufe noch einmal das schwedische Modell - das ist eine Erfahrung aus der Vergangenheit - in Erinnerung. Dieses Modell hat Erfolg gehabt. Sie können dabei die Frage offen lassen, was Sie machen, wenn das System wieder funktioniert. Aber jetzt ist das schwedische Modell die beste Lösung, um der Krise überhaupt Herr zu werden.
Erstens. Sie erreichen mit diesem Modell, dass der Geldfluss wieder in Gang kommt. Zurzeit belauern sich die privaten Geschäftsbanken und geben keine Kredite mehr, weder untereinander noch an Dritte, weil sie unsicher sind und die Risiken nicht kennen. Nur das schwedische Modell beseitigt diesen Zustand. Deshalb plädiere ich nachdrücklich für die Einführung dieses Modells. Das heißt, Übernahme des Kreditsektors in öffentliche Verantwortung.
Zweitens. Nur das schwedische Modell stellt sicher, dass keine Geschäfte außerhalb der Bücher getätigt werden. Zurzeit werden immer noch in großem Umfang Geschäfte außerhalb der Bücher getätigt.
Drittens. Nur das schwedische Modell stellt sicher, dass keine Geschäfte mit Steueroasen getätigt werden. Es wäre dringend notwendig, dass ein großer Industriestaat - die Bundesrepublik Deutschland ist das - darauf hinwirkt, dass seine Kreditinstitute keine Geschäfte mehr mit Steueroasen machen.
Viertens. Nur die öffentliche Verantwortung stellt sicher, dass kein Handeln mehr mit Schrottpapieren betrieben wird. Zurzeit werden in großem Umfang Verbriefungen bei den Banken in Anspruch genommen, es werden in großem Umfang Kreditversicherungen getätigt usw. Wenn wir jetzt nicht endlich eingreifen, dann handeln wir völlig verantwortungslos und fahrlässig und sind verantwortlich für die Verschleuderung weiterer Steuermilliarden.
Fünftens. Die Übernahme in öffentliche Verantwortung ist die billigste Lösung. Man kann das allein bei der HRE sehen. Nur der Staat ist zurzeit in der Lage, zu billigen Konditionen zu refinanzieren. Wenn man die privaten Anteilseigner diese Refinanzierung sicherstellen lässt, dann wird es nur teuer, und die Mittel, die wir bereitstellen müssen, werden nur größer. Erkennen Sie doch, dass dieser einfache Zusammenhang von niemandem geleugnet werden kann!
Sechstens. Nur die Übernahme in öffentliche Verantwortung löst die Probleme, die mit der Bad Bank angesprochen worden sind. Es wäre ein Treppenwitz der Weltgeschichte, wenn wir eine öffentliche Bad Bank einrichteten und dann den Privaten weiterhin die Geschäfte und die zu erwartenden Gewinne überließen. Es kann so nicht weitergehen, dass auf der einen Seite alle Verluste und seien es Hunderte von Milliarden sozialisiert werden, während auf der anderen Seite eine Privatisierung der Gewinne stattfindet.
Siebtens. Nur so stellen wir sicher, dass die Zinssenkungen der Zentralbank auch weitergegeben werden können. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dazu hört man von Ihnen nichts. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller hat immer darauf hingewiesen, dass die Geldpolitik ziehen, aber nicht stoßen kann. Ziehen heißt: Durch Erhöhung der Zinssätze kann man eine sehr starke Konjunktur bremsen. Stoßen heißt: Man kann eine schwache Konjunktur durch Senken der Zinssätze anregen. Das Stoßen ist in dem Moment nicht möglich, in dem die Banken die Zinssenkung der Zentralbank nicht weitergeben. Ein öffentlicher Sektor wäre aber dazu in der Lage. Er würde daher die notwendigen konjunkturellen Impulse möglich machen. Das ist der Grund, warum wir dafür plädieren.
Nun werden Sie sagen, das sei das typische Oppositionsgerede, zu sagen, die Bundesregierung tut nichts. Es ist in höchstem Maße fahrlässig, was Sie zu verantworten haben. Ich zitiere hier die Welt:
Der Wettlauf um die besten Konzepte vorm globalen Finanzgipfel Anfang April in London gewinnt an Tempo. Dabei ist zwischen Vorschlägen zu unterscheiden, die substanziell sind. Und jenen, die nur zum Ziel haben, den Eindruck zu erwecken, als tue man etwas.
Leider ist aus Berlin bislang vor allem Letzteres zu vernehmen. Sowohl der Weltwirtschaftsrat, den Bundeskanzlerin Angela Merkel in Davos erneut vorschlug, als auch der Vorstoß, einen globalen Risikoatlas zu schaffen, klingen zwar gut. Aber sie sind kaum dafür geeignet, die Welt schon bald entscheidend krisenfester zu machen.
Das ist der entscheidende Vorwurf. Während Sie jetzt löschen müssten, machen Sie Konferenzen der Feuerwehrmänner, verlangen irgendeinen Atlas und unterlassen die wichtigsten Schritte, um das Finanzsystem wieder in Ordnung zu bringen.
Es soll doch einmal jemand hier hintreten und sagen, was Sie auf nationaler Ebene zur Reregulierung unternommen haben. Ich sage noch einmal: Nach wie vor gibt es Geschäfte außerhalb der Bilanzen, nach wie vor gibt es Geschäfte mit Steueroasen, nach wie vor gibt es die Zulassung des Handels mit Schrottpapieren. Es ist doch fahrlässig und verantwortungslos, dass der Staat da überhaupt nichts tut und weiterhin das Verschleudern von Milliarden ermöglicht.
Wir haben Ihnen einen Katalog vorgelegt, der sich an die Vorschläge des ehemaligen Bundeskanzlers Schmidt anlehnt, der sich international auf diesem Gebiet als Experte ausgezeichnet hat. Sie hätten ihn nur beschließen müssen. Sie sind noch nicht einmal in der Lage, dazu ein einziges Argument vorzutragen. Kein einziges Argument habe ich dazu gehört. Null. Nun haben wir Ihnen heute einen Beschlussvorschlag vorgelegt, der wiedergibt, was international renommierte Makroökonomen vorgeschlagen haben, was jetzt zu tun ist. An der Spitze ist der renommierteste Wachstumsforscher der Welt, Bob Solow. Bob Solow hat mit zehn Makroökonomen aus Europa ein Manifest vorgelegt, wie jetzt konjunkturell gegenzusteuern sei. Wir haben dieses Manifest zur Beschlussfassung vorgelegt. Wir wissen, dass Sie alles, was die Linke vorschlägt, aus ideologischen Vorbehalten heraus ablehnen werden. Aber übernehmen Sie doch wenigstens, was die Finanzmarktregulierung und die Konjunktursteuerung angeht, die Konzepte international renommierter Makroökonomen.
Bob Solow und weitere Makroökonomen fordern, zur Konjunktursteuerung mindestens 2 Prozent des Bruttosozialprodukts pro Jahr aufzuwenden, um die rasante Talfahrt der Wirtschaft aufzuhalten. Schmidt hat Ihnen vorgeschlagen, 3 bis 4 Prozent dafür aufzuwenden. Sie meinen nach wie vor, Sie könnten es bei etwas mehr als 1 Prozent bewenden lassen. Allein die Kenntnis der Grundrechenarten müsste Sie angesichts des freien Falls der Wirtschaft zu der Einsicht bringen, dass Sie mit etwas mehr als 1 Prozent nicht auskommen werden, wenn Sie selbst einen Rückgang der Wirtschaft um 2,25 Prozent prognostizieren. Sie handeln völlig fahrlässig und sind verantwortlich dafür, dass immer mehr Menschen in Deutschland arbeitslos werden.
Die Makroökonomen mahnen weitere Zinssenkungen an; diese Zinssenkungen werden demnächst wohl fällig.
Sie sagen ferner - das ist ganz entscheidend -: Sämtliche Klagen über nationale Maßnahmen, die durchgeführt werden, um dem Nachbarn Schaden zuzufügen oder um ihm gegenüber Vorteile zu erreichen, sind dann obsolet, wenn es endlich gelingt, die europäische Finanzpolitik zu koordinieren. Man kann das nur unterstreichen. Ein einheitlicher Währungsraum hat ohne eine stark koordinierte Fiskalpolitik keinen Sinn. Dieser Ratschlag der Makroökonomen ist dringend zu beherzigen. Sie müssen europäisch koordinieren. Europäisch koordinieren heißt in diesem Fall: Jedes Land muss mindestens 2 Prozent des Bruttosozialproduktes aufwenden, um konjunkturell gegenzusteuern. Wenn das geschieht, ist jede Diskussion darüber, dass mehr italienische, deutsche oder französische Autos gekauft werden, hinfällig.
In diesem Manifest schlagen die Makroökonomen auch eine verbesserte institutionalisierte Rolle der Finanzminister auf europäischer Ebene vor; sie regen die Einrichtung eines Sekretariats an. Wie immer Sie das nennen wollen - ich habe das hier schon öfter angeführt; Jacques Delors hat immer von einer Wirtschaftsregierung gesprochen; der französische Präsident Sarkozy hat ähnliche Vorschläge gemacht -, dahinter steht nur das eine: Wenn man eine gemeinsame Währung hat, braucht man eine koordinierte Finanz- und Wirtschaftspolitik; sonst gibt es Verwerfungen und Schäden für alle Volkswirtschaften.
Die Makroökonomen schlagen selbstverständlich auch vor, zu konsolidieren. Das ist kein Streitpunkt. Die Frage ist nur, wie konsolidiert wird. Hier wird vorgeschlagen, keine starren Regeln zu beschließen, die sowieso nicht mehr beherzigt und bei jeder konjunkturellen Talfahrt gebrochen werden, sondern längerfristig laufende Ausgaben durch laufende Einnahmen zu decken. Dieser Vorschlag ist viel sinnvoller als das Befolgen starrer Regeln, etwa der Maastricht-Kriterien, mit denen wir in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Der wichtigste Punkt auch dieser Makroökonomen ist, endlich den Finanzmarkt zu regulieren. Sie schlagen hierfür einfache und klare Regeln vor. Die von uns immer wieder vorgetragenen Regeln - keine Geschäfte mit Steueroasen, keinen Schrotthandel und keine Geschäfte außerhalb der Bilanz - sind so klar und so eindeutig, dass jeder ihrer Richtigkeit sofort und unverzüglich zustimmen kann.
Im Übrigen sagen diese Professoren selbstverständlich - um Herrn Kollegen Westerwelle anzusprechen -, dass Steuersenkungen derzeit das am wenigsten geeignete Mittel sind.
Das alles ist doch wissenschaftlich untersucht. Sie werden in der angelsächsischen Nationalökonomie kaum jemanden finden, der sagt: Steuersenkungen sind das beste Mittel, um konjunkturell gegenzusteuern.
- Soweit ich weiß, ist er kein renommierter amerikanischer Nationalökonom. Aber ich kann mich irren.
Wenn Sie das einmal nachlesen, stellen Sie fest: Dort wird gesagt, dass bei öffentlichen Investitionen pro Dollar zwei bis drei Dollar Folgeinvestitionen hervorgerufen werden, während bei Steuersenkungen allenfalls 70 Cent von einem Dollar ausgegeben werden. Das sind Grundrechenarten, gegen die Sie hier immer wieder verstoßen, Herr Kollege Westerwelle.
Es ist nun einmal so: Die Hälfte der Haushalte zahlt keine Lohn- und Einkommensteuern. Wollen Sie die Hälfte der Haushalte ausklammern, wenn Sie konjunkturell gegensteuern? Wollen Sie beim konjunkturellen Gegensteuern tatsächlich diejenigen ausklammern, die jeden Euro ausgeben würden? Wollen Sie nur diejenigen bedienen, die ihre Euros teilweise auf die Sparkonten bringen? Was hier vertreten wird, ist doch irrsinnig.
Das hat doch nur, wenn man so will, klientelpolitische Gründe; ansonsten ist das völliger Nonsens, der hier vorgetragen wird.
Das gilt im Übrigen auch für Freibeträge. Eine Anhebung der Freibeträge, die Sie hier so vehement verteidigt haben, wird nur denen zugute kommen, die Steuern zahlen. Aber die vielen, die keine Steuern zahlen, müssen anders unterstützt werden; und diese haben Unterstützung auch am nötigsten. Deshalb ist der Weg, den Sie vorschlagen, falsch.
Insofern ist es auch kein Zufall, dass unsere Vorschläge - das hat, wie ich glaube, die Frankfurter Rundschau heute veröffentlicht - von der Mehrheit der Bevölkerung gebilligt werden. Sie kämen nämlich der Mehrheit der Bevölkerung eher zugute als das, was bisher beschlossen wurde. Unsere Vorschläge sind: Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze, Verbesserungen bei den Renten und eine Lohnentwicklung, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Lage versetzt, das auszugeben, was sie notwendigerweise für ihre Familien ausgeben müssen. Deshalb sagen wir noch einmal: Das Konjunkturpaket muss auch sozial ausgewogen sein.
Sozial ausgewogen müssen insbesondere Hartz-IV-Sätze, Renten und Löhne sein.
Zum Schluss noch eine Bemerkung zu etwas, das mich wirklich mit Sorge erfüllt. Ich habe ja nichts dagegen, wenn eine Partei einen Höhenflug erlebt. Das sei ihr gegönnt. Unter Sportlern muss man auch anderen Erfolg gönnen.
- Sie wissen doch, dass es ein Auf und Ab gibt. - Ich möchte allerdings noch zwei Dinge dazu sagen.
Dass die FDP - das habe ich gestern gelesen - in der jetzigen Situation die gesetzliche Krankenversicherung vollständig privatisieren will, schlägt doch dem Fass nun wirklich den Boden aus. Das ist unglaublich!
Deswegen sage ich Ihnen: Wir werden alles tun, um eine schwarz-gelbe Mehrheit zu verhindern. Wir werden das auch erreichen. Dafür stehen wir, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Das Gleiche trifft natürlich auch auf Ihre Ankündigung zu, die Rentnerinnen und Rentner zur Kasse zu bitten, um die Milliarden, die da verschleudert worden sind, in Zukunft bezahlen zu können. Was ist das denn für ein asozialer Ansatz? Leider haben auch ein Abgeordneter der CDU und ein Abgeordneter der SPD vor einigen Wochen solche Äußerungen getätigt. Das ist doch völlig unglaublich! Es müssen endlich einmal diejenigen zur Kasse gebeten werden, die das Ganze verbrochen haben, und nicht die Bevölkerung.
Jetzt sage ich Ihnen noch etwas zu den Schulden.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege Lafontaine, Sie müssen sich jetzt ein bisschen beeilen.
Oskar Lafontaine (DIE LINKE):
Ich beobachte die Uhr, Herr Präsident. - Schauen Sie sich einmal die Vermögensbesteuerung anderer großer Industriestaaten an. Die Zinsbelastung Deutschlands liegt etwa bei 60 Milliarden Euro. Würden wir beispielsweise die englische Vermögensbesteuerung einführen, erhielten wir alleine 100 Milliarden Euro aus der Vermögensbesteuerung. Daran sehen Sie, warum Sie nicht erfolgreich arbeiten können. Wenn Sie die Ungleichgewichte bei Vermögen und bei Einkommen nicht beseitigen, wenn Sie es nicht schaffen, diejenigen, die die Profiteure der Entwicklungen der letzten Jahre waren, zur Finanzierung der Staatsfinanzen heranzuziehen, dann verschärfen Sie die Krise weiter. Das muss um jeden Preis vermieden werden.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nächster Redner ist der Kollege Fritz Kuhn, Bündnis 90/Die Grünen.
Fritz Kuhn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr von und zu Guttenberg, auch wir wünschen Ihnen für Ihr Amt alles Gute und viel Erfolg, allerdings nicht wegen der besonders ruhmreichen Bedingungen, unter denen Sie ins Amt geraten sind, sondern weil wir uns in einer Wirtschaftskrise befinden und es eigentlich normal und vernünftig ist, dass ein Wirtschaftsminister in einer solchen Zeit auch erfolgreich ist.
Dazu gehört aber, dass die politische Führung, insbesondere in Person der Kanzlerin, nicht nur zuschaut, was passiert, abwartet und zaudert, sondern die politische Führung tatsächlich übernimmt und konsistent Politik gestaltet. Das war bei Ihrer Amtswerdung, Herr Wirtschaftsminister, nicht der Fall, wie wir alle an dem Chaos letztes Wochenende sehen konnten.
Ich will gleich auf das Bild eingehen, Herr Guttenberg, das Sie gezeichnet haben. Sie sagten, die Regierung habe die Krise vom Finanzmarktschirm bis zum heute vorliegenden Konjunkturpaket II beispielhaft im Griff gehabt. Bei genauer Betrachtung der Wirklichkeit kann ich diese Einschätzung nicht teilen.
Fangen wir am Anfang an. Wir sehen heute - darüber hat Herr Steinbrück nichts gesagt -, dass der Finanzmarktschirm von Anfang an falsch konstruiert war. Deswegen haben wir ihn übrigens abgelehnt. Sie haben damals, im Oktober2008, Angst vor einer effektiven Teilverstaatlichung gehabt. Sie haben nämlich aus ideologischen Gründen diesen Weg gefürchtet. Die Schwierigkeiten und Fehler, die daraus resultierten, sehen Sie jetzt ganz deutlich: Der Finanzmarktschirm funktioniert nämlich nicht. Er hat den Anspruch, die Wirtschaft mit Krediten zu versorgen und zu erreichen, dass sich die Banken gegenseitig Liquidität zur Verfügung stellen, bisher nicht erfüllt. In der Hypo Real Estate, einer Bank, die gerade noch 270 Millionen Euro wert ist, stecken inzwischen 102 Milliarden Euro. Da muss man doch wirklich fragen: Hat es funktioniert, ja oder nein? Ich sage Ihnen: Es hat nicht funktioniert.
Deswegen ist es notwendig, dass Sie den Finanzmarktschirm jetzt endlich korrigieren, nämlich durch ein Gesetz, das das Ganze präziser fasst.
An die Union gerichtet sage ich: Nun ist Schluss mit Ideologie! Sie haben zwei Möglichkeiten: Entweder kauft der Staat den Herrn Flowers aus der HRE heraus - dann muss er allein für ihn 500 oder 600 Millionen Euro veranschlagen; für die anderen Anteilseigner vielleicht noch einmal die gleiche Summe; es wird also sehr teuer -, oder Sie trauen sich endlich, das effektiv zu machen, damit die Bank wieder wirksam Kredite ausgeben kann und mehr Glaubwürdigkeit gewinnt; in diesem Fall dürfen Sie eine Enteignung aber nicht scheuen.
Herr Röttgen, es ist nicht die Stunde der ideologischen Konstruktionen in der Frage, was alles nicht sein darf,
sondern jetzt muss effektiv gehandelt werden. Was wir bei den Banken gegenwärtig machen, ist vergleichbar mit einer Aktenvernichtungsmaschine: Oben wird das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hineingesteckt, unten kommt es zerhäckselt wieder heraus - ohne jeden vernünftigen Effekt. Dafür ist diese Regierung verantwortlich. Sie können jetzt nicht nach dem Motto verfahren: So what? Es ist halt alles schwierig. Damit haben wir nichts zu tun.
Ihre beiden Konjunkturprogramme wirken nicht so, wie Sie es erwartet haben. Zum einen haben Sie zu wenig tatsächlich direkt und schnell wirkende Konjunkturmaßnahmen eingebaut. Ich will das einmal an einem Beispiel aufzeigen: 6 Milliarden Euro Steuersenkung rückwirkend zum 1. Januar 2009; Senkung des Beitragssatzes zur Krankenversicherung zum 1. Juli. Sie glauben doch nicht, dass jemand jetzt ins Einkaufen gerät und den Binnenmarkt stärkt, wenn er erfährt: Es gibt eine Steuersenkung und ein halbes Jahr später soll noch eine Beitragssatzsenkung kommen und nach einem halben Jahr eine weitere Steuersenkung. Da sind Sie unterkritisch. Damit werden Sie die Konjunktur nicht beleben.
Zum anderen sind die Investitionen zu gering. 13 Milliarden Euro Investitionen in den Gemeinden bei einem Paket von 50 Milliarden Euro sind zu wenig. Das Ganze wird auch nicht gesteuert, zum Beispiel im Sinne von Bildung und Ökologie.
Wir lehnen das Konjunkturpaket II ab. 50 Milliarden Euro auf Schulden - alle müssen doch wissen: das sind Schulden der Zukunft -, ohne eine klare Richtung für Klima, Bildung und soziale Gerechtigkeit, das kann nicht den Effekt haben, dass man gestärkt aus der Krise herauskommt.
Herr von und zu Guttenberg, Sie haben hier gesagt: Wir werden stärker aus der Krise herauskommen, wenn wir es richtig machen. - Dieser Gedanke ist attraktiv. Aber dann muss man in der Krise jetzt so investieren, dass man danach auch wirklich gestärkt aus ihr herauskommen kann. Wenn Sie auf die Weltwirtschaft schauen, dann ist klar: Der neue Boom, der nach der Krise kommen wird, ist mit dem Begriff ?grün? richtig beschrieben; denn ?grün? heißt Investitionen in ökologische Modernisierung; ?grün? heißt Investitionen in Bildung, und zwar in Beton und in Köpfe; ?grün? heißt mehr Investitionen in soziale Gerechtigkeit. Wenn Sie diese drei Punkte nicht zielgenau umsetzen, dann gehen wir nicht gestärkt, sondern geschwächt aus dieser Krise heraus.
Die anderen, zum Beispiel in den USA, haben das inzwischen begriffen.
Mich wundert, dass Sie, Herr von und zu Guttenberg und Herr Westerwelle, jetzt schon wieder das Lied der Steuersenkungen singen. Ich sage Ihnen einmal ganz klar, Herr Westerwelle: Ich glaube nicht, dass durch Steuersenkungen, wie sie die Regierung jetzt will - Sie wollen das ja noch erweitern -, ein schneller Konjunktureffekt erreichen werden kann, und zwar aus folgendem Grund: In Deutschland zahlt die Hälfte der Haushalte gar keine Einkommensteuer mehr. Deswegen müssen wir, wenn wir konjunkturell etwas erreichen wollen, die Transferleistungen für die, die sehr wenig haben, erhöhen, also zum Beispiel das Arbeitslosengeld II. Wer Konjunkturpolitik mit Gerechtigkeitspolitik verbinden will, der muss an dieser Stelle ansetzen, der muss etwas für die kleinen Leute tun und nicht für die, die sowieso mehr haben.
Ich bin erstaunt über die FDP und ihre Konzeption. Die Union scheint in dieser Frage ja von Westerwelle getrieben zu sein. Sie sagen, Sie haben etwas gegen Verschuldung, und wollen mit gigantischen Steuersenkungskonzepten in den Wahlkampf ziehen. Aber Sie werden sie nicht finanzieren können. Solche Steuersenkungen hätten keinen anderen Effekt, als dass neue Schulden aufgehäuft würden und damit für die Zukunft Kürzungen der Sozialleistungen vorprogrammiert wären. Anders können Sie das nicht finanzieren.
Wir werden im nächsten Jahr eine Auseinandersetzung genau über die Frage haben, ob es richtig war, jetzt billig Steuersenkungen zu versprechen, dadurch die Verschuldung anzuheben und Kürzungen der Sozialleistungen zulasten der kleinen Leute vorzubereiten.
Manches, was Sie, Herr Westerwelle, hier bringen, ist Taschenspielerei. Sie reden von einer sofort machbaren weiteren Senkung des Eingangssteuersatzes auf 12 Prozent. Aber wer sich das etwas genauer anschaut, merkt, dass Sie das gar nicht beschließen. Die FDP hat am 31. Mai 2008 auf ihrem Parteitag ein Steuerkonzept mit Gesamtkosten in Höhe von 70 Milliarden Euro beschlossen.
Darin hat sie einen Eingangssteuersatz von insgesamt 19 Prozent vorgesehen. Das stellt man fest, wenn man die Vorhaben der Herrschaften einmal genauer studiert.
Ich will es Ihnen erläutern, Herr Westerwelle: Sie haben 10 Prozent Eingangssteuersatz beim Bund; zusammen mit dem von Ihnen vorgesehenen Länderzuschlag von bis zu 5 Prozent und dem Kommunalzuschlag von bis zu 4 Prozent beim Eingangssteuersatz kommen Sie nach Adam Riese auf 19 Prozent. Ich finde es schon ein starkes Stück, Herr Westerwelle, dass Sie hier die Backen aufblasen und von 12 Prozent Eingangssteuersatz reden, nachdem Sie im Mai selber bis zu 19 Prozent beschlossen haben. Da hört die Redlichkeit bei Ihnen auf.
- Es tut natürlich weh, wenn man seine eigenen Parteitagsbeschlüsse vor Augen geführt bekommt. Wenn das jetzt ein alter Beschluss wäre, zum Beispiel von 1964, dann könnte ich Ihr Geschrei verstehen, Herr Niebel. Aber wenn Sie schreien, ist klar, dass ich ins Schwarze getroffen habe. Das ist eine alte Erfahrung. Wir werden das auch weiterhin so praktizieren.
Das Konjunkturprogramm II, das auf dem Tisch liegt, ist ökologisch gesehen ein Blindflieger. Kolleginnen und Kollegen von der SPD, das wisst ihr auch. Deswegen verstehe ich nicht, dass ihr euch jetzt so schwer tut, wenigstens im Rahmen der Kfz-Steuer-Reform eine etwas stärkere ökologische Ausgestaltung vorzunehmen. Die Ansicht, dass die Abwrackprämie ein so gigantischer Erfolg wäre, wie Herr Steinbrück vorhin dargestellt hat, kann ich übrigens nicht teilen. Tatsächlich geschieht nichts anderes, als dass Autokäufe, die für die nächsten drei, vier Jahre geplant waren, auf dieses Jahr vorgezogen werden.
Ich frage Sie, Herr Steinbrück: Was wollen Sie eigentlich machen, wenn die Krise im nächsten Jahr anhält? Was ist dann mit der Leitindustrie der Autobauer? Wir sagen klar: Nur wer jetzt den Strukturwandel fördert und andere und bessere Fahrzeuge unterstützt, trägt dazu bei, dass wir aus der Krise besser herauskommen, als wir in sie hineingegangen sind.
Ich möchte zum Abschluss noch etwas an den neuen Wirtschaftsminister gerichtet sagen. Sie lesen hier in Ihrer ersten Rede - vielleicht verständlich - der Ordnungspolitik der sozialen Marktwirtschaft die Messe. Aber Sie müssen sich eine Frage stellen: Wie können wir die Marktwirtschaft in unserem Land so durch neue Rahmenbedingungen erneuern, dass sie wieder sozial wird? Man kann sich doch nicht mehr einfach auf die soziale Marktwirtschaft berufen, sondern muss feststellen, dass die soziale Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft diffundiert. Ich hätte von Ihnen erwartet - wir werden das von Ihnen vor allem in den nächsten Monaten erwarten -, dass Sie klar und deutlich beschreiben, welche Rahmenbedingungen, welche ordnungspolitischen Neusetzungen Sie für die Marktwirtschaft vorschlagen, damit sie wieder sozial und vor allem ökologisch werden kann. Ich sage Ihnen voraus: Es wird in Deutschland, in Europa und auf der Welt keine erfolgreiche Marktwirtschaft mehr geben, die nicht das Thema Ökologie und soziale Gerechtigkeit als Fundament hat und daraus ableitet, welche Rahmenbedingungen zu setzen sind. Allein das Predigen der alten sozialen Marktwirtschaft wird die Probleme der Zukunft nach unserer Überzeugung nicht lösen können.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält nun der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Herr Ministerpräsident Sellering.
Erwin Sellering, Ministerpräsident (Mecklenburg-Vorpommern):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! In einer Krise wie dieser kommt es darauf an, rasch, überlegt und entschlossen zu handeln - und vor allem gemeinsam. Diese Gemeinsamkeit zwischen Bund und Ländern ist in den letzten Wochen und Monaten sehr gut gelungen. Wir haben gemeinsam das Finanzmarktstabilisierungsgesetz und das erste Konjunkturpaket auf den Weg gebracht. Wir werden jetzt auch das zweite Konjunkturpaket gemeinsam auf den Weg bringen.
In dieser Krise hat sich gezeigt, dass der Föderalismus auch bei großem Zeitdruck handlungsfähig ist. Obwohl heute der Bundesrat tagt, bin ich hier, um zu zeigen, dass uns weiter an dieser guten Zusammenarbeit liegt,
damit wir gemeinsam diese Krise meistern können.
Die richtige Antwort ist: kein Aktionismus, sondern Maßnahmen, die das Wachstum fördern und Werte schaffen. Deshalb ist es richtig, der Wirtschaft mit Sonderprogrammen und Kredithilfen unter die Arme zu greifen. Es ist richtig, die Bürger zu entlasten und dabei vor allem den Familien zu helfen. Es ist richtig, öffentliche Investitionen vor Ort zu ermöglichen; denn das stärkt die Konjunktur und schafft gleichzeitig Werte, die bleiben. Deshalb sage ich ganz klar: Dieses Konjunkturpaket II ist insgesamt eine gute Sache.
Gut ist erstens, dass dieses Konjunkturpaket jetzt für ganz Deutschland gilt. Da gab es ja mal andere Töne. Ich freue mich, dass das, was wir jetzt beschlossen haben, Ost und West gleichermaßen zugutekommt und nicht gesagt wird: Jetzt ist der Westen an der Reihe. - Gerade in einer Krise dürfen wir uns nicht auseinanderdividieren.
Diese Krise betrifft ganz Deutschland, und deshalb muss sie in Deutschland gleichermaßen bekämpft werden.
Gut ist zweitens, dass dies ein Rettungspaket für den Erhalt von Arbeitsplätzen geworden ist. Denn wir müssen immer wieder deutlich machen, dass es uns nicht darum geht, Banken oder Unternehmen als Selbstzweck zu helfen, sondern immer mit Blick auf die Arbeitsplätze. Wir müssen aufpassen - dies dürfen wir nicht unterschätzen -, dass diese Vertrauenskrise bzw. dieser Vertrauensverlust, der die Finanzmärkte und die Wirtschaft erschüttert hat, nicht das gesamte Wirtschaftssystem betrifft oder am Ende vielleicht sogar das Vertrauen fehlt, dass unsere demokratischen Institutionen in der Lage sind, mit dieser Krise fertig zu werden. Wir dürfen nicht verkennen: Für viele Menschen draußen ist es sehr schwer nachvollziehbar, welch riesige unvorstellbare Milliardenbeträge nicht nur hier, sondern überall auf der Welt von Staaten mit manchmal erschreckender Leichtigkeit bewegt werden. Die Bürgerinnen und Bürger vor Ort fragen sich: Was bedeutet das für uns, für den Einzelnen? Was bedeutet das für den Fortgang der Sozialpolitik und der Umweltpolitik? Wir müssen sehr aufpassen, dass es nicht zu einer Vertrauenskrise kommt.
Unternehmen zu stützen, um Arbeitsplätze zu sichern, kann ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern selbstverständlich nicht allein. Wir können keine eigenen Konjunkturprogramme auflegen; das würde uns überfordern. Deshalb ist unser Bestreben - dies ist wichtig für uns -, dass wir von der Krise betroffene Unternehmen unter den Schutzschirm des Bundes bringen können. Dazu sind wir auf gute Gespräche und eine gute Zusammenarbeit mit dem Bund angewiesen. Diese Zusammenarbeit haben wir bisher erfahren. Ich hoffe, dass dies so weitergeht.
Meine Damen und Herren, viele der Unternehmen, die die Krise meistern können, werden häufig für längere Zeiträume nicht genug Beschäftigung haben. Dann geht es darum, dass wir diesen Unternehmen helfen müssen, ihre Fachkräfte zu halten. Ich will ganz deutlich sagen: Das Programm, das Olaf Scholz aufgelegt hat, und die Strategie, die er verfolgt, sind genau richtig. Die Geltungsdauer der Kurzarbeit verlängern, um Arbeitslosigkeit zu verhindern, qualifizieren, statt zu entlassen - genau das brauchen wir.
Wir haben schon jetzt einen Fachkräftemangel im Land. Auch in einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern ist völlig klar, dass wir die Fachkräfte für die Zeit, wenn es wieder weitergeht, halten müssen, und zwar nicht nur in den Betrieben. Wir müssen vor allem auch verhindern, dass sie das Land verlassen. Dafür bietet dieses Programm sehr gute Voraussetzungen. Das sind die richtigen Weichenstellungen in dieser Krise.
Ich kann Ihnen berichten, dass Mecklenburg-Vorpommern dieses Paket in der letzten Woche in einer Sitzung des Bündnisses für Arbeit vorgestellt hat. Das war nicht nur eine Informationsveranstaltung, sondern es kam auch zu einer Rückkopplung: Ist das, was wir tun, richtig? Müssen wir das noch ergänzen? - Dieses Paket ist dort auf sehr viel Zustimmung gestoßen. Im Bündnis für Arbeit sind die Sozialpartner und verschiedene Unternehmer vertreten, die selbstverständlich unterschiedlichen Parteien angehören. Ich habe Ihnen eine Botschaft mitgebracht - das war das Ergebnis -: Da es jetzt darauf ankommt, der Wirtschaft Vertrauen zu signalisieren, müssen wir gemeinschaftlich sagen - so der allgemeine Tenor im Bündnis für Arbeit -, dass dies ein gutes Paket ist, dass dies eine Maßnahme ist, mit der wir diese Krise meistern können; denn sonst werden wir es nicht schaffen, Vertrauen herzustellen. Ich finde es bemerkenswert, dass das über die Parteigrenzen hinweg gelungen ist. Das würde ich mir auch für dieses Haus etwas häufiger wünschen.
Aus Sicht der Länder ist besonders wichtig - das ist mein dritter Punkt -, dass dieses Konjunkturpaket ein Investitionspaket geworden ist, das Investitionen vor Ort ermöglicht. Wir können Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser davon profitieren lassen. Es ist gut, dass es bleibende Investitionen gibt. Das ist sinnvoll, weil wir damit Werte schaffen.
Mecklenburg-Vorpommern bekommt aus dem Investitionsprogramm für Länder und Kommunen vom Bund 237 Millionen Euro. Wir haben am letzten Dienstag im Kabinett eine schnelle Umsetzung dieses Programms beschlossen. Wir sind eines der wenigen Länder, die keinen Nachtragshaushalt brauchen.
Deshalb ist es uns möglich, das demnächst im Finanzausschuss zu beschließen, sodass wir das dann sehr schnell umsetzen können.
Ich will hervorheben, dass es für uns besonders wichtig ist, dass 65 Prozent der Mittel der Bildungsinfrastruktur zugute kommen sollen. Wir haben viele Vorgespräche mit dem Bund geführt, in denen wir darauf hingewirkt haben. Wir sind froh, dass das dabei herausgekommen ist.
Es ist möglich, bessere Kitas, bessere Schulen und bessere Hochschulen zu schaffen. Das eröffnet unseren Kindern mehr Chancengleichheit von Anfang an. Das Wichtigste für die Zukunft dieses Landes ist es, dass wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass niemand zurückgelassen wird, dass jeder mitgenommen wird, dass jede Begabung gefördert wird. Unsere Kinder sind die Ingenieure, Forscher und Unternehmer von morgen. Wir müssen ihnen das nötige Rüstzeug geben.
Meine Damen und Herren, der zweite Korb, die weiteren 35 Prozent, ermöglichen Investitionen in Krankenhäuser, Städtebau, ländliche Infrastruktur - zum Beispiel eine bessere Breitbandversorgung - und andere Infrastrukturprojekte. Für Mecklenburg-Vorpommern bedeutet das beispielsweise Investitionen in die Hafeninfrastruktur.
Ganz wichtig ist - das ist hier eben schon angeklungen -, dass die Kommunen vor Ort in die Lage versetzt werden, das, was ihnen vom Bund zur Verfügung gestellt wird, anzunehmen, also den nötigen Eigenanteil aufzubringen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es viele Kommunen und Gemeinden, in denen eine Haushaltsnotlage herrscht. Wir haben uns entschlossen, die Regelung in dieser Krise nicht generell zu lockern. Unsere Lösung ist folgende: Aus einem Fonds, den das Land einrichtet, werden gezielt Zuschüsse geleistet, damit der Eigenanteil aufgebracht werden kann. Ich glaube, das ist wichtig und der richtige Weg.
Bezüglich des Konjunkturpakets II, aus dem wir den Kommunen pauschal Gelder zur Verfügung stellen, haben wir mit den Kommunen in Gesprächen vereinbart, dass sie im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung ebenso verfahren. Sie sollen für den Landkreis genau definieren, welche Gemeinde einen bestimmten Anteil, sagen wir einmal: 15 Prozent, leisten kann und welche sich nur 5 Prozent leisten kann. Das muss im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung bestimmt werden.
In diesem Investitionspaket steckt für uns alle eine große Chance, diese Krise zu meistern und die Bundesländer langfristig zu stärken. Diese Chance wollen wir nutzen. Allerdings ist auch klar, dass das alles nur durch eine der größten Nettoneuverschuldungen überhaupt finanziert werden konnte. Deshalb ist es absolut richtig, dass wir eine Schuldenbremse eingeführt und den Schuldenabbau fest vereinbart haben. Dafür haben wir in der gestrigen Sitzung der Föderalismuskommission die Weichen gestellt. Es ist sehr zu begrüßen, dass das geklappt hat. Ich muss allerdings auch deutlich sagen: Wenn wir eine derart rigide Schuldenpolitik vereinbaren und im Grundgesetz festschreiben, dann müssen sich auch diejenigen, die immer über Steuersenkungen reden, klar darüber sein, dass Steuersenkungen auf Jahre ausgeschlossen sind.
Ich will noch zwei kritische Bemerkungen zum Schuldenabbau machen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir bei der Frage der Geber- und Nehmerländer nicht nur auf den Schuldenstand sehen, sondern auch die strukturelle Wirtschafts- und Finanzkraft etwas mehr berücksichtigen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Konsolidierungshilfen so gestaltet werden, dass sie einen Anreiz zur Konsolidierung für alle Länder bieten. Das ist nicht ganz so gelungen, wenn das für neun Jahre, also für lange Zeit festgeschrieben wird.
Insgesamt ist es eine gute Lösung, die wir unbedingt brauchen. Das vorliegende Paket ist überzeugend. Ich möchte Sie bitten: Lassen Sie uns in Bund und Ländern gemeinsam daran arbeiten, dass es ein Erfolg wird und das Land weiter voranbringt.
Vielen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache darauf aufmerksam, dass in der Zwischenzeit auch die Stellungnahme des Bundesrates zum Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan vorliegt. Sie dürfte inzwischen im Plenum verteilt sein. Ich bitte Sie, das in der Zwischenzeit zur Kenntnis zu nehmen.
Das Wort erhält nun die Bundesministerin Frau Dr. Annette Schavan.
Dr. Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung:
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Soziale Marktwirtschaft und Wohlstand für alle bedeuten heute, dass wir alles tun müssen, um allen Bürgerinnen und Bürgern Teilhabe zu ermöglichen. Weil Wohlstand für alle heute Teilnahmechancen für alle bedeutet, ist unser Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland mit unserer Überzeugung verbunden, dass es Investitionen in Bildung und Forschung sind, die Chancen für die Zukunft eröffnen. Sie tragen - Herr Kuhn hat eben die Frage gestellt: Was bedeutet Stärkung von sozialer Marktwirtschaft heute? - zu Weiterentwicklung und Erneuerung bei. Wohlstand für alle bedeutet heute Bildung für alle.
Dieser Gesetzentwurf - Herr Sellering hat sich vor allem auf das Investitionsprogramm konzentriert, auch ich will das tun - macht deutlich, dass wir gerade jetzt dazu beitragen wollen, dass Deutschland nach der Überwindung dieser wirtschaftlich schwierigen Lage moderner, innovativer und zukunftsfähiger sein wird. Deshalb ist das Herzstück des Investitionsprogramms eine beispiellose Investition in Bildung und Forschung. Dafür stellen Bund und Länder in den Jahren 2009 und 2010 über 11 Milliarden Euro zur Verfügung. Das ist das größte Investitionsprogramm für Bildung, das es je in Deutschland gegeben hat.
Durch die Finanzmittel stützen wir das heimische Handwerk und den Handel, sichern Arbeitsplätze und erhöhen die Steuereinnahmen. Unser Grundsatz lautet: Wenn schon neue Schulden aufgenommen werden, dann sollen die Gelder vorrangig für solche Aufgaben ausgegeben werden, die der kommenden Generation unmittelbar zugute kommen. Damit sind die Sanierung und die Modernisierung von Gebäuden sowie die neue technische Ausstattung von Kindertagesstätten, Schulen, Weiterbildungseinrichtungen, Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen verbunden. Sie sind jetzt möglich. Dies ist nicht nur eine Investition in Beton, sondern auch eine Investition in die Modernisierung der Infrastruktur für Bildung und Forschung. Das ist das Herzstück.
Jetzt sind die Modernisierung von Chemielaboren und Physikräumen in den Schulen, die dringend notwendige Investition in IT-Ausstattung in unseren Bildungseinrichtungen, die Erneuerung von Fachräumen in beruflichen Schulzentren, die Verbesserung von Räumlichkeiten in den Volkshochschulen und anderen Weiterbildungseinrichtungen kommunaler und gemeinnütziger Trägerschaft möglich. Ausdrücklich nenne ich auch die Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen freier Träger in Deutschland, die von diesem Programm profitieren werden.
Und - wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, auch im Ausschuss -: Der erhebliche Sanierungsbedarf in den Forschungsmuseen kann ebenso angegangen werden wie dringend notwendige Campussanierungen der Helmholtz-Zentren bis hin zum Konzept ?Green Campus?. Den Fraunhofer-Instituten wird es möglich sein, Erweiterungsbauten durchzuführen und neue Kooperationen mit der Wirtschaft einzugehen, etwa im Bereich der Bauphysik oder der therapeutischen Medizintechnik. Das sichert technologische Vorsprünge. Das sichert Arbeitsplätze.
Meine Damen und Herren, von den Bundesinvestitionen in Höhe von 4 Milliarden Euro stehen bis zu 500 Millionen Euro für die energetische Sanierung zur Verfügung. Damit leisten wir einen positiven, maßgeblichen Beitrag zum Klimaschutz.
Schließlich - auch das möchte ich betonen - hat die deutsche Automobilindustrie jetzt die einmalige Chance, den Einstieg in die Elektromobilität zu schaffen; das ist ein wichtiger Baustein des Investitionsprogramms, über den der Haushaltsausschuss noch weitere Informationen bekommen wird. Wir wollen die anwendungsorientierte Forschung im Bereich der Mobilität fördern, um die Marktfähigkeit alternativer Antriebstechnologien zu beschleunigen. Das ist ein klassisches Beispiel für das, worüber wir in den letzten Wochen mehrfach gesprochen haben. Neben allen Debatten über Steuersenkungen ist auch die Debatte über die Frage wichtig: Welche Schritte sind jetzt die richtigen, um zentralen Branchen, die in Schwierigkeiten geraten sind, Zukunftschancen zu eröffnen? Das ist Innovationsförderung - auch die Mitglieder des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages sind an diesem Thema interessiert, weshalb sie sich hier näher informieren lassen.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dafür Sorge zu tragen bzw. die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität wird. Deshalb ist es wichtig, diese Möglichkeiten zu schaffen.
Ich nenne auch den Ansatz der Forschungsförderung im Bereich des Mittelstandes. Hierzu gab es konkurrierende Ideen. Es gab den Vorschlag meines Hauses - ich persönlich halte ihn für sehr wichtig -, jetzt in steuerliche Anreize für Forschung und Entwicklung einzusteigen.
Wir haben allerdings vereinbart, zunächst einen anderen Weg zu gehen. Die Ergebnisse müssen genau überprüft werden. Generell gilt aber: In einer wirtschaftlich schwierigen Lage müssen in den Bereichen Anreize geschaffen werden, in denen wir Innovationen fördern, in denen Chancen für die Zukunft eröffnet werden und in denen Raum für die Umsetzung neuer Ideen bei Forschung und Entwicklung geschaffen wird.
Meine Damen und Herren, das Investitionsprogramm für Bildung und Forschung - ich wiederhole: es hat ein Volumen von mehr als 11 Milliarden Euro - löst gemeinsam mit dem Hochschulpaket, der Exzellenzinitiative, dem Pakt für Forschung und Innovation, dem Ganztagsschulprogramm, der Qualifizierungsinitiative und der Hightech-Strategie - dies sind die Elemente unseres Zukunftsprogramms in dieser Legislaturperiode - eine große Dynamik am Bildungs- und Forschungsstandort Deutschland aus. Diese Dynamik am Bildungs- und Forschungsstandort Deutschland ist die Voraussetzung dafür, dass trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation Brücken in die Zukunft gebaut werden können.
Mit dem Investitionspakt von Bund und Ländern muss und wird ein Qualitätspakt einhergehen, wie wir ihn beim Bildungsgipfel in Dresden vereinbart haben. Denn es ist richtig: Die Bildungsinfrastruktur ist das eine, die Weiterentwicklung unseres Bildungssystems ist das andere. Es handelt sich um zwei Seiten derselben Medaille. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für neue Ideen, für bessere Bildung, für mehr Durchlässigkeit im Bildungssystem und für die Internationalisierung unseres Wissenschafts- und Forschungssystems. Deshalb danke ich den Regierungsfraktionen ausdrücklich dafür, dass aus der Idee ?100 000 Euro für jede Schule? ein so überzeugendes und vielfältiges Investitionsprogramm für Bildung und Forschung geworden ist. Ich bin davon überzeugt, dass Deutschland mit diesem Investitionsprogramm stärker und attraktiver wird.
Vielen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Alexander Bonde ist der nächste Redner für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.
Alexander Bonde (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Einlassungen der Bundesministerin für Bildung und Forschung brauchen eine Kommentierung.
Natürlich wissen wir alle, dass es Sinn macht, Schulen energetisch zu sanieren. Wer aber den großen Bildungsaufbruch verkünden will, muss auch erklären, wie vom energiesanierten Klassenzimmer Energie in den Unterricht kommen soll. Angesichts der Realität in unseren Schulen - Unterricht, der nicht stattfindet - macht es kaum einen Unterschied, ob das Klassenzimmer saniert ist oder nicht.
Sie haben heute wie gestern in der Föderalismuskommission - es hieß ja schon zum zweiten Mal, das sei nun die letzte Sitzung der Föderalismuskommission - die Chance verspielt, etwas für die Qualität des Unterrichts zu tun. Wieder beschränken Sie sich auf den Handwerker, der an der Schule baut, stecken aber nichts in die Köpfe, die in der Schule das bewirken müssen, was Sie hier angekündigt haben.
Auch beim Thema Bildungssoli passiert wenig.
Ich will die knappe Zeit, die mir zur Verfügung steht, nutzen, um ein Thema anzusprechen, das der Bundesfinanzminister ausgespart hat: Wir verabschieden heute auch den Nachtragshaushalt für 2009. Erst wenige Wochen ist der Haushalt in Kraft, und schon muss nachgebessert werden. Angesichts des Lobes des Finanzministers für die Abwrackprämie stellt sich mir die Frage: Was macht eigentlich der Finanzminister mit den 2 500 Euro, die er sich, so abgewrackt wie dieser Haushalt ist, verdient hätte?
- Wenn Sie hier buhen, Kollege Kampeter, dann lassen Sie uns die Posten einmal durchgehen:
Die Steuerschätzung, auf der der Nachtragshaushalt beruht, ist eine interne aus dem Haus des Ministers. Den Steuerschätzerkreis zu fragen, hat er sich nicht getraut. Es wird von Einnahmen ausgegangen, die mindestens 3 Milliarden Euro höher liegen als das, was wir erwarten dürfen. Daran sieht man, warum er lieber auf Leute zugreift, die er direkt beeinflussen kann.
Für die Finanzierung des Arbeitslosengeldes II stellen Sie nicht mehr ein, als man gebraucht hat, um 2008, was ja ein gutes Jahr war, einigermaßen über die Runden zu kommen. Den dramatischen Einbruch der Konjunktur bilden Sie nicht ab. Auch hier blenden Sie Mehrkosten, die voraussichtlich mehr als 2 Milliarden Euro betragen werden, einfach aus.
Dass Sie Kosten und neue Schulden vor der Bevölkerung verstecken, hat in diesem Haushalt System. Große Teile laufen in Schattenhaushalten. 16,7 Milliarden Euro von dem, was Sie uns hier als Konjunkturpaket verkünden, gehen direkt in ein Sondervermögen, schlagen sich also im Bundeshaushalt nicht nieder. Die Zahlen, die Sie gegenüber den Medien und in der Öffentlichkeit angeben - eine Neuverschuldung von 36 Milliarden Euro -, all das ist eine Fortsetzung von Tarnen, Tricksen und Täuschen. Nicht einmal in der Krise sind Sie bereit, Transparenz zu zeigen und die Zahlen auf den Tisch zu legen.
Auch bei dem zweiten Sondervermögen, bei dem für die Bankenrettung, verstecken Sie die relevante Neuverschuldung vor den Augen der Öffentlichkeit. Auch da Tarnen, Tricksen, Täuschen, keine Ehrlichkeit in der Krise, keine Transparenz im Haushalt.
Wenn man all das addiert, was Sie entweder bewusst nicht in den Haushalt einstellen oder in Form von Sondervermögen vor den Augen der Öffentlichkeit verstecken, kommt man für dieses Jahr auf eine Neuverschuldung von 70 Milliarden Euro. Jetzt weilt Seine Verschuldetheit der Finanzminister nicht mehr auf der Regierungsbank. Schade; denn mit seinem Haushalt bricht er jeden Verschuldungsrekord, den es in der deutschen Nachkriegsgeschichte gegeben hat. Das Schlimme daran: Es ist ja nicht so, dass das alles nur auf die Finanzkrise und die Wirtschaftskrise zurückzuführen wäre. Mit schuld sind nämlich lang angelegte Verschuldungsstrukturen, die diese Koalition zu verantworten hat.
Heute stellt sich wieder einmal heraus: Sie stecken das Geld, das Ihnen durch die Verschuldung zur Verfügung steht, nicht in eine kohärente Idee. Man kann nicht erkennen, dass diese Regierung eine Vorstellung hat, wie sie mit dieser Krise umgehen will. Es ist nicht erkennbar, dass sie in der Krise an Strukturen herangeht und so investiert, dass dieses Land nach der Krise fit ist. Eine Leitidee ist in diesem Sammelsurium von Maßnahmen, die Sie hier vorgestellt haben, wirklich nicht erkennbar. Sie trauen sich nicht, die Frage der Ökologisierung unserer Wirtschaft anzugehen. Sie glauben, dass das Hinterherwerfen von Geld in der Krise eine Delle auffüllen kann und man drübermarschiert. Aber ich sage Ihnen: Wenn sich unsere Wirtschaft nicht ökologisiert, wenn wir die Chance des Strukturwandels nicht ergreifen, dann geht es nach der Krise eben nicht einfach so weiter wie vorher. Das Schlimme an dieser Koalition ist: Sie merkt gar nicht, dass sich Zeiten ändern und dass sich Politik ändern muss. Mit Ihrem Konjunkturprogramm von gestern bereiten Sie nichts für morgen vor.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort hat nun der Kollege Carsten Schneider für die SPD-Fraktion.
Carsten Schneider (Erfurt) (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Kollege Bonde, dass wir nicht bereit seien, uns auf veränderte Zeiten einzustellen, ist ein Vorwurf, den Sie weder der Bundesregierung noch der Großen Koalition machen können.
Die FDP hält uns vor, der Finanzminister hätte im September, Oktober, November Konjunkturprogramme ausgeschlossen. Richtig, das stimmt auch. Nur haben sich die Zeiten dramatisch geändert. Schauen Sie allein heute in die Nachrichten, die vom Wirtschaftseinbruch
und den EZB-Prognosen berichten. Die Krise ist weltweit spürbar. Die Einbrüche sind canyonartig tief.
Solch einen Einbruch von Nachfrage und Wachstumskräften habe ich mir persönlich nicht vorstellen können. Von daher ist die Alternative, nichts zu tun, meines Erachtens keine Alternative, die dieses Land weiterbringt.
Ein kurzer Blick nicht nur auf den Nachtragshaushalt 2009, sondern auch auf den Etat 2008, dessen Jahresabschluss wir am Mittwoch hatten. So gute Zahlen werden wir so bald nicht wieder sehen. 2008 hatten wir ein gesamtstaatliches Defizit von Null, Überschüsse in Kommunen und bei den Sozialversicherungen, bei den Ländern war es ausgeglichen, und im Bund gab es ein kleines Minus. Das müssen wir im Vergleich zu anderen Ländern, die damals schon ein viel deutlicheres Defizit hatten, sehen.
Ich will Ihnen ein paar Zahlen nennen, die zeigen, welche Belastungen für die nächste Legislatur durch diese Krise entstehen werden. Herr Westerwelle, Sie haben ja heute sehr ordentlich chambriert mit dem Kollegen Guttenberg; ich weiß nicht, ob das vorgezogene Koalitionsverhandlungen waren. Aber die Vorstellung, man könne eine Steuerreform mit einer Nettoentlastung auf Pump machen, ist vorbei.
Das können Sie vergessen. Diese Möglichkeit besteht nicht.
Von daher sollten wir uns auch sehr genau ansehen, was in anderen Ländern gemacht wird. Die USA legen ein Konjunkturprogramm in einem Umfang von 789 Milliarden Dollar auf. Frankreich kündigt 26 Milliarden Euro an, China 1,5 Billionen Euro, Japan 380 Milliarden Euro. Die Defizite im Ausland: USA 8,5, Großbritannien 8,8, Spanien 6,2, Irland 11 Prozent.
Wir gehen mit einem Volumen von 50 Milliarden Euro an den Start. Das heißt in etwa, zusammen mit dem ersten Programm: 1,75 Prozent Wachstumskraftstärkung auf zwei Seiten, kurzfristig Nachfrageerhöhung, Kinderbonus in Höhe von 100 Euro, Senkung der Krankenkassenbeiträge
und zum Teil auch eine Entlastung im Steuertarif bei den unteren Einkommensgruppen. Das wird kurzfristig wirken. Dazu kommt die Abwrackprämie. Herr Westerwelle, ich war doch einigermaßen irritiert, dass Sie - ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck war - dafür plädiert haben: Deutsche, kauft deutsche Autos! - Das ist schon eine Art von Protektionismus.
- Das ist Protektionismus, Herr Westerwelle. Das ist die Buy-American-Klausel auf Deutsch.
Würden wir als exportorientierte Nation, als Exportweltmeister, vorangehen und eine rein deutsche Wirtschaftspolitik machen im dem Sinne, dass nur noch deutsche Produkte gekauft werden sollen,
wären wir doch die größten Verlierer einer solchen Tendenz. Ich bin froh, dass der Bundesfinanzminister hier wirtschaftspolitischen Sachverstand hat walten lassen.
Es ist ja wie mit den Wirtschaftsmeldungen und Prognosen. In den Umfragen lagen Sie gestern noch bei 18 Prozent, heute liegen Sie bei 12 Prozent. Das geht ja hin und her. Man sollte das alles nicht so ernst nehmen. Es wäre besser, wenn Sie an dieser Stelle eine klare Linie verfolgen würden.
- Herr Westerwelle, Sie fragen, wo wir stehen. Wir stehen auf dem Boden der Tatsachen. Wir sind vor Ihnen und werden das natürlich auch bleiben.
Über dieses Programm haben einige Kollegen gesagt - zum Beispiel Herr Kuhn -, dass das noch gar nicht wirkt. Das wird heute erst beschlossen. Es kann ja noch gar nicht wirken. Durch die sozialdemokratische Handschrift, die dieses Programm trägt, wird es eine entsprechende Wirkung haben.
Mit unserer Handschrift machen wir insbesondere klar, dass wir erstens daran glauben, die Wirtschaftskraft des Bürgers, mit der er zum Wachstum beiträgt, stärken zu müssen, indem ihm mehr Netto in der Tasche belassen wird. Zweitens müssen wir, weil wir an dieses Land glauben, vor allen Dingen die Infrastruktur dieses Landes stärken. Dies ist auch für ein zukünftiges Wachstum in diesem Land eine Grundvoraussetzung.
Deswegen werden allein vom Bund 10 Milliarden Euro für die kommunale Infrastruktur bereitgestellt. In der zweiten Jahreshälfte die öffentlichen Investitionen vorzuziehen und voranzubringen, ist im Übrigen auch das, was uns nicht nur der Präsident der Bundesbank, sondern auch alle anderen halbwegs glaubwürdigen Sachverständigen empfohlen haben. Das geht natürlich nur noch im kommunalen Bereich, weil hier der höchste Bedarf besteht.
Wir als Bund haben im Rahmen des Konjunkturprogramms I fast 3 Milliarden Euro für öffentliche Bauten und die Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung gestellt und damit schon die wichtigsten Schritte getan. Dazu kommen jetzt zusätzliche Maßnahmen im Umfang von 4 Milliarden Euro Bundesinvestitionen. Mehr können wir als Bund leider nicht unmittelbar investieren, weil wir nicht mehr haben. Deswegen ist das ein klares Bekenntnis der Solidarität des Deutschen Bundestages mit den kommunalen Vertretern vor Ort. Das wird sich auch auszahlen.
Herr Bonde, natürlich können wir nicht die Lehrer an den Schulen bezahlen, aber eine Sanierung bzw. ein Neubau von Schulen und Kindergärten - wir investieren dort 65 Prozent dieser 10 Milliarden Euro - ist ein klares Zeichen dafür, dass wir dies als Priorität ansehen und als das Zukunftsthema Nummer eins auf die Agenda setzen.
Ich erwarte natürlich, dass diese Maßnahmen in dem Bereich, in dem die Länderverantwortung originär ist, nämlich im Bildungsbereich, inhaltlich und personell mit einer entsprechenden Ausstattung nachvollzogen werden.
Herr zu Guttenberg hat heute sehr stark auf ordnungspolitische Grundsätze hingewiesen und seine Leitlinien markiert. Das war in den letzten Wochen vom Wirtschaftsministerium nicht immer so zu hören. Im Hinblick auf die Bürgschaften und Kredite im Umfang von 100 Milliarden Euro habe ich insbesondere wahrgenommen, dass jedem, der anfragt, geholfen wird, indem er Bürgschaften und Kredite erhält.
Wir müssen sehr genau abwägen. Die Bürgschaften bedeuten, dass der Bund für mögliche Ausfälle einstehen muss. 100 Milliarden Euro sind kein Pappenstiel. Von daher haben wir uns als Haushaltsausschuss des Parlaments vorbehalten, vor jeder Gewährung eines Kredits oder einer Bürgschaft mit einem Volumen von über 300 Millionen Euro gehört zu werden, sodass wir darüber informiert werden; denn erstens darf es nicht passieren, dass es hier zu einer deutlichen Marktverzerrung kommt, und zweitens ist in einem solchen Fall und in dieser ausgesprochen einmaligen Situation, in der viele Grundsätze natürlich schön und gut sind, aber an das tägliche Handeln angepasst werden müssen, eine größtmögliche Transparenz nötig.
Ich will nicht zurück in den Sozialismus, aus dem ich einmal gekommen bin, indem wir jedes Unternehmen übernehmen und verstaatlichen, weil wir denken, dass wir das besser machen können. Herr Lafontaine, das können wir nicht. Ich glaube, das ist eindeutig gezeigt und bewiesen worden.
Wenn wir dort ins Obligo gehen und vor allen Dingen für Arbeitsplätze eintreten - um die geht es uns ja vor allen Dingen; es geht uns nicht, um das Beispiel Schaeffler aufzugreifen, um die Milliarden der Frau Schaeffler, sondern um die Arbeitsplätze der Arbeitnehmer vor Ort und um die Wirtschaftskraft, die dort entsteht -, dann muss das sehr wohl abgewogen werden. Das darf nicht zu einem Wettlauf führen, sodass Markteingriffe vorgenommen werden, die letztendlich dazu führen, dass wir als Steuerzahler Risiken übernehmen, die nicht tragbar sind. Das ist auch nicht unsere Aufgabe.
Ich möchte noch kurz einige Sätze zu dem Investitionsprogramm verlieren. Insbesondere im kommunalen Bereich gibt es die Sorge, dass die Investitionen des Bundes in den Kommunen auch wirklich zusätzliche Investitionen sind und nicht die Ausgaben der Kommunen durch Bundesausgaben ersetzt werden. Wir müssen sehr genau auf den Referenzzeitraum schauen. Ich erwarte eine Lösung in Abstimmung mit dem Bundesfinanzministerium und der kommunalen Seite, damit diese nicht überfordert wird. Es muss aber auch klar gemacht werden, dass wir eine volkswirtschaftliche Wirkung erzielen wollen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, dass wir mit den Änderungen, die wir im parlamentarischen Verfahren noch vorgenommen haben - dieses Programm ist zwar wohlbedacht, aber doch sehr schnell entschieden worden; außerdem sind einige Sperren eingeführt worden, um diese Programme genauer zu untersetzen -, nicht nur auf dem richtigen Weg sind, sondern dass wir auch bei aller Unwägbarkeit, die es aktuell natürlich aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der besonderen Verhältnisse gibt, mit unseren Maßnahmen zur Stärkung der Binnennachfrage, zur Stärkung insbesondere der unteren Einkommen und zur Erhöhung der öffentlichen Investitionen letztlich eine Stärkung des Staates als Garant für wirtschaftliches Wachstum und soziale Gerechtigkeit erreichen.
Mich verwundert es, dass die Opposition dem nicht folgen wird. Ich hoffe, dass wir eine Zustimmung der Länder, die maßgeblich von dem Programm profitieren, im Bundesrat erreichen. Alles andere würde mich nicht nur schwer enttäuschen, sondern auch in meiner politischen Erfahrung eines Besseren belehren.
Ich glaube, dass die gestern vereinbarte Schuldenbremse für die öffentlichen Finanzen ein Grundpfeiler für das staatliche Handeln in schlechten Zeiten ist. Das geht nur, wenn man in guten Zeiten anspart. Das ist in der Vergangenheit aber immer vergessen worden. Herr Kollege Bonde, deshalb haben wir einen Tilgungsfonds eingerichtet, sodass diese Maßnahmen des Konjunkturprogramms nicht einfach zulasten der Bundesschuld gehen, sondern dass diese klar abrechenbar sind und dass die politische Verantwortlichkeit klar ist. Außerdem ist eine Regelung vorgesehen, wonach dieses Geld in guten Zeiten zurückgezahlt wird, genauso wie es beim Erblastentilgungsfond in Höhe von fast 80 Milliarden Euro der Fall gewesen ist, Herr Kollege Fricke.
Wir reden heute über 16 Milliarden Euro. Ich bin mir sicher, dass wir - wenn nicht in der nächsten Legislaturperiode, dann aber in einem überschaubaren Zeitraum - diese Schulden tilgen können.
Vielen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält nun der Kollege Peter Götz für die CDU/CSU-Fraktion.
Peter Götz (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Deutschland befindet sich wie viele andere Länder in einer weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise. Wir sind in einer Dimension betroffen, wie sie die Bundesrepublik noch nicht erlebt hat. Unser Land steckt tief in der Rezession. Um den Einbruch der Wirtschaft abzufedern, wurden richtige Maßnahmen getroffen, die zum Teil bereits wirken.
Herr Kuhn, wenn in dieser Krise Deutschland aus der Sicht ausländischer Investoren zum attraktivsten Standort gemacht wird und im Standortranking ganz vorn steht, so kann die bisherige Politik dieser Bundesregierung so falsch nicht gewesen sein.
Wir werden die weltweite Rezession mit unseren nationalen Entscheidungen nicht verhindern. Der Staat kann und muss aber die Rezession dämpfen, damit die Selbstheilungskräfte der Wirtschaft greifen. Über einzelne Rezepte kann man kräftig streiten.
Es ist auf jeden Fall richtig und konsequent, mit einem Bündel von Maßnahmen gegenzusteuern. Dazu gehören in einer solch schwierigen Situation auch zusätzliche Bauinvestitionen der öffentlichen Hand. Die Frage, die wir uns stellen müssen und mussten, lautet: Wie schaffen wir es, schnell sinnvolle Investitionen auf den Weg zu bringen?
In den Schubladen der Rathäuser liegen viele fertige Pläne. Sie warten darauf, umgesetzt zu werden. Deshalb setzen wir genau an dieser Stelle an.
Allein im kommunalen Bereich gibt es einen Investitionsstau in einer Größenordnung von 700 Milliarden Euro für die nächsten zwölf Jahre, der abgearbeitet werden muss. Mit 10 Milliarden Euro des Bundes zuzüglich 3,3 Milliarden Euro der Länder - also insgesamt 13,3 Milliarden Euro - wird für das Jahr 2009 und das Jahr 2010 ein Schwerpunkt für Zukunftsinvestitionen der Kommunen und der Länder gebildet, der sich in einer solchen Dimension wirklich sehen lassen kann. Mindestens 70 Prozent des Gesamtvolumens sind zur Finanzierung kommunaler Investitionen einzusetzen. Bis zu 30 Prozent können die Länder für ihre eigenen Vorhaben verwenden.
Dieses Investitionsprogramm hat das Ziel, vor allem Innovationen, Bildung und Infrastruktur zu fördern, damit wir gestärkt aus der Krise, in der wir uns befinden, herauskommen. Um es klar und deutlich zu sagen: Es ist kein Rettungspaket für Länderfinanzen oder für klamme kommunale Haushalte.
Es ist auch nicht das Ziel, dass konjunkturell bedingte neue Haushaltslöcher durch Bundesmittel gestopft werden sollen.
Es ist den Ländern übrigens auch gestattet, ihren Kommunen mehr als 70 Prozent der Mittel zuzuweisen. So wollen Nordrhein-Westfalen 84 Prozent,
Sachsen 80 Prozent und das Saarland 75 Prozent der Mittel an die Kommunen weiterleiten. Die Kommunen sind am besten in der Lage, bedarfsgerecht zu entscheiden, welche Schulen oder Kindertagesstätten zusätzlich zu den ohnehin geplanten Investitionen schnell in Angriff genommen werden können.
Wichtig ist uns dabei, dass auch finanzschwache Kommunen mitmachen können. Denn gerade dort ist der Investitionsstau besonders groß. Oft ist die Arbeitsmarktsituation in finanzschwachen Kommunen besonders schwierig. Entscheidend ist, dass Bund, Länder und Kommunen gemeinsam der Wirtschaft einen kräftigen Impuls geben.
Daneben bietet das Investitionspaket auch die Chance, den Menschen mit kommunalen Investitionen Hoffnung zu geben. Die Menschen in den Städten und Gemeinden werden merken, dass in ihrem Umfeld trotz der großen Krise eine neue Aufbruchstimmung und bessere Lebensbedingungen entstehen. Wenn Einrichtungen der Kinderbetreuung in Ordnung gebracht, Schulen und Krankenhäuser energetisch saniert werden und in kommunale Infrastruktur wie Kliniken investiert wird, dann sichert dies Arbeitsplätze im heimischen Handwerk, ist gut für Umwelt und Klima, verbessert die Wirtschaftlichkeit kommunaler Einrichtungen, schafft bleibende Werte und stärkt nachhaltig den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Auch der dringend notwendige Ausbau der Informations- und Breitbandtechnologie macht unser Land zukunftsfähig. Gerade auf dem Gebiet des schnellen Internets besteht vor allem im ländlichen Raum dringender Handlungsbedarf. Deshalb ist es zu begrüßen, dass die Bundesregierung mit ihrer Informationsstrategie auf dem Gebiet des schnellen Internets voraussichtlich nächste Woche ein Ergebnis vorlegen wird.
Eine gute Infrastruktur ist die Grundlage für eine gute wirtschaftliche Entwicklung.
Noch nie hat der Bund so viel Geld in so kurzer Zeit den Kommunen als Investitionshilfe angeboten. Viele Länder haben bereits mit den Kommunen vereinbart, nach welchen Schlüsseln die Mittel verteilt werden. Es liegt nun in der Hand der Länder, dieses einmalige große kommunale Investitionspaket bedarfsgerecht, schnell und vor allem unbürokratisch umzusetzen.
Um die gewünschte Wirkung für die Konjunktur und damit für die Bürger, die Wirtschaft und die Kommunen zu erzielen, gilt: Wer schnell hilft, hilft doppelt. Wir wollen, dass die Schulen und Kindergärten zügig renoviert und energetisch auf Vordermann gebracht werden.
Deshalb haben wir die Vergabebedingungen gelockert. Auf zwei Jahre befristet hat der Bund die Schwellenwerte für beschränkte Ausschreibungen auf 1 Million Euro und für freihändige Vergaben auf 100 000 Euro angehoben. Wir empfehlen dringend, diese Lockerungen auf die kommunale Ebene auszudehnen, damit auf den Bauämtern lange Staus bei der Vergabe vermieden werden.
Heute verabschieden wir ein Mammutpaket. Wenn wir uns nicht in kleinstaatlicher Kirchturmpolitik verhaspeln, dann kann es zu einer einmaligen Erfolgsgeschichte für unser Land, die Städte, Gemeinden und Kreise, vor allem aber auch für die Bürgerinnen und Bürger werden.
Wir brauchen dazu den Schulterschluss aller politischen Ebenen. Dann werden wir stärker aus der Krise herauskommen, als wir hineingegangen sind. Das ist anstrengend, aber es lohnt sich.
Herzlichen Dank.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Als Nächster spricht der Kollege Steffen Kampeter für die CDU/CSU-Fraktion.
Steffen Kampeter (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will an diesem Punkt der Debatte den Wortbeitrag des Bundesfinanzministers zur Bankenaufsicht aufgreifen. Wir in der Union sind der Auffassung: Wir brauchen eine Veränderung in der Bankenaufsicht.
In den vergangenen zehn Jahren ist nicht alles in der Bankenaufsicht optimal gelaufen.
Vieles, über das wir heute reden, hätte bei einer vernünftigeren und vor allen Dingen bei einer geschlossen, einheitlich agierenden Bankenaufsicht sicherlich nicht so passieren können. Deswegen sind wir von der Union gemeinsam mit weiten Teilen dieses Hauses für eine organisatorische Zusammenfassung der Bankenaufsicht unter dem Dach der Deutschen Bundesbank.
Der Bundesfinanzminister hat betont, er denke immer noch darüber nach, wie er das machen werde. Ich finde, es ist langsam Zeit. Wir müssen die Sache so hinbekommen, dass wir die Banken beaufsichtigen und effektiv kontrollieren. Den Parteienstreit über die Effektivierung der Bankenaufsicht sollten wir schnell und rasch zu einem Ende führen.
Ich will aber auch versöhnlich gegenüber dem Bundesfinanzminister sein. Ich kann garantieren, dass wir ihn sehr viel anständiger behandeln werden, wenn er aus dem Amt scheidet, als er heute über Michael Glos gesprochen hat.
Das war nicht nur kleinkariert, sondern auch unangemessen. Das sollte für den Umgang von Kabinettsmitgliedern nicht stilbildend sein, weder von aktuellen noch von zukünftigen.
Eine weitere Anmerkung. Wir verkünden heute ein Stück weit die Erfolge bzw. die gewünschten Erfolge unseres Konjunkturprogramms. Aber die zusätzlichen Schulden, die wir in einer Größenordnung von etwa 50 Milliarden Euro heute festschreiben, haben auch ihren Preis. Deswegen will ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Schuldenbremse, auf die sich Bund und Länder gestern geeinigt haben, ganz besonders wichtig und ein integraler Bestandteil dieses schuldenfinanzierten Konjunkturprogramms ist.
Man darf nicht nur über die Wohltaten reden, die man verkündet, sondern man muss auch deutlich machen, dass wir eine Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen haben und dass diese Verantwortung nun einen grundgesetzlichen Charakter bekommt. Das ist wichtig und eine notwendige Ergänzung zu dem expansiven Impuls. Ich möchte all denjenigen, die in der Föderalismusreformkommission mitgearbeitet haben - stellvertretend nenne ich namentlich unsere Sprecherin, die Kollegin Tillmann -, herzlich danken. Man braucht für das Bohren dicker Bretter viel Zeit. Hier handelt es sich um einen klugen Erfolg. Dem zolle ich sehr viel Respekt.
Der Bundeswirtschaftsminister hat in seiner klaren und ordnungspolitisch strukturierten Rede unter anderem zur Steuerpolitik Stellung genommen. Wir von der Union wissen um die Sorgen und Nöte derjenigen, die in diesem Land Einkommensteuer zahlen, die morgens aufstehen, den ganzen Tag arbeiten und abends vielleicht nicht früh ins Bett kommen. Sie werden insbesondere im mittleren Einkommensbereich belastet. Es ist unser Anliegen - im Verbund mit strikter Haushaltskonsolidierung und der Umsetzung der Schuldenbremse -, in der nächsten Legislaturperiode alle Entlastungsmöglichkeiten und vor allen Dingen die Vereinfachungsoptionen im deutschen Steuerrecht zu mobilisieren, die die Leistungsträger im mittleren Bereich unserer Gesellschaft nach vorne bringen und sie motivieren, wieder etwas zu leisten. Das ist das Anliegen der Union.
Ich will deutlich machen: Wir hätten in der Steuerpolitik mehr machen können, wenn die SPD nicht so auf der Bremse gestanden hätte.
Es wundert mich schon, dass der Bundesfinanzminister, nachdem er Steuersenkungen abgelehnt hat, in dieser Woche als stellvertretender Parteivorsitzender der SPD ebensolche gefordert hat. Wir wären bereit gewesen, beispielsweise in Sachen Pendlerpauschale mehr zu machen. Das ist auf den erbitterten Widerstand des Bundesfinanzministers gestoßen. Ich finde, man sollte hier so handeln, wie man auch in der Öffentlichkeit redet. Das macht Glaubwürdigkeit in der Politik aus.
Im Zusammenhang mit dem Sachverhalt, dass wir hier eine schwierige Zeit haben, will ich auf einige Punkte eingehen, die wir im Haushaltsausschuss am Konjunkturprogramm präzisiert haben. Ein Punkt betrifft das enorme zusätzliche Bürgschaftsvolumen. Wir haben analog zu dem Bereich, den wir bei der SoFFin haben, jetzt auch einen Lenkungsausschuss für Bürgschaften von der Bundesregierung eingefordert.
Wir wollen damit zweierlei erreichen: erstens eine rasche Umsetzung der notwendigen Bürgschaftsentscheidungen in der Exekutive. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Da, wo Not am Mann oder an der Frau in der Firma ist, soll geholfen werden. Zweitens: eine klare parlamentarische Kontrolle in diesem Bereich. Es muss deutlich werden: In der sozialen Marktwirtschaft kann der Staat dort helfen, wo es notwendig ist. Aber er ist kein Reparaturbetrieb für unternehmerisches Versagen. Deswegen gibt es Begrenzungen dessen, was der Staat mit Bürgschaften in dieser sozialen Marktwirtschaft leisten kann.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Herr Kampeter, Herr Koppelin möchte Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen.
Steffen Kampeter (CDU/CSU):
Nein. - Ich komme zu einem weiteren Punkt. Wir haben das Zusätzlichkeitskriterium in dem Investitionsprogramm für die Kommunen definiert. Dieses Zusätzlichkeitskriterium soll deutlich machen: Es handelt sich bei dem Angebot an die Kommunen nicht um ein Umschuldungsprogramm zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, sondern wir alle stehen zu unserer staatspolitischen Verantwortung. Der Bund hält seine Investitionen und legt zusätzlich noch etwas drauf. Wir erwarten von den anderen Gebietskörperschaftsebenen genau das Gleiche: das Niveau der Investitionen nicht nur beibehalten, sondern im Rahmen des zusätzlichen Impulsprogramms steigern. Zusätzliche Investitionen sind konjunkturpolitisch sinnvoll, notwendig und geboten. Deswegen war es richtig, diese Veränderung und Präzisierung in diesem Programm vorzunehmen.
Insgesamt machte ich keinen Hehl daraus, dass wir Haushälter uns gewünscht hätten, dass wir am Ende dieser Legislaturperiode nicht einen Haushalt mit einer solchen Nettokreditaufnahme vorgelegt hätten. Es bleibt in der Abwägung aller politischen und haushaltspolitischen Aspekte allerdings richtig, dass wir im Verbund mit unseren europäischen Partnern und im transatlantischen Verbund dieses politische Signal setzen. Es bleibt aber auch richtig, dass wir den nachfolgenden Generationen sagen: Mit der Einführung der Schuldenbremse werden wir das, was wir jetzt an zusätzlichen Schulden machen, wieder ausgleichen. Wir bleiben verantwortungsbewusst, nicht nur heute, sondern perspektivisch auch für die nachfolgenden Generationen.
Danke schön.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Die Kollegin Patricia Lips hat jetzt für die CDU/CSU-Fraktion das Wort.
Patricia Lips (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Mittelpunkt der heutigen Debatte stehen Maßnahmen, die zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland beitragen sollen. Auch ich möchte noch einmal betonen, wie wichtig jede einzelne Maßnahme ist. Diese Maßnahmen sind für die Kommunen, die Familien, die Betriebe und für die Menschen in diesem Land insgesamt in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen.
Aber gestatten Sie mir, dass ich gegen Ende der heutigen Debatte ein Thema in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücke, das heute bisher eher am Rande Erwähnung fand, aber - lassen Sie mich das sagen - in den vergangenen Wochen die Öffentlichkeit doch sehr stark beherrschte. Es geht um die Neuregelung der Kfz-Steuer. Sie war bereits deutlich vor der Krise Bestandteil des Koalitionsvertrages. Sie muss aber im Zusammenhang mit dem heute zu beschließenden Konjunkturpaket diskutiert werden. Wir wollen den Menschen auch in diesem Bereich Planungssicherheit geben.
Es wird deutlich - und dies ist das Besondere -, dass im Gegensatz zu nahezu allen anderen Punkten des Konjunkturprogramms diese Neuregelung auf eine über die Krise hinausgehende Zukunft angelegt ist. Ich will grob das Wichtigste noch einmal aufzeigen: Alle zahlen ab dem 1. Juli dieses Jahres einen Sockelbetrag, der sich nach dem Hubraum bemisst und dessen Höhe je nach Antriebsart gestaltet ist. Darauf setzt die CO2-Komponente auf. Der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid - das eigentliche Kernstück - wird für die weitere Berechnung zugrunde gelegt, ohne dass es Grenzen nach oben gibt.
Gleich mehrere Ziele werden mit diesem Gesetz verfolgt. Erstens. Es soll der Umwelt stärker gerecht werden als bisher. Zweitens. Es soll bereits beim Kauf eine Lenkungswirkung hin zu sparsameren Pkw erzielen. Drittens. Es sollen damit auch bei der Industrie entsprechende Impulse zur Entwicklung sparsamerer Motoren gesetzt werden. Viertens. Es soll natürlich auch das bisherige Steueraufkommen - wir haben es eben gehört - in Zeiten wie diesen zumindest annähernd stabil bleiben.
Lassen Sie mich aber noch einen Punkt nennen, den wir bei unserer Bewertung keinesfalls vergessen dürfen. Gestatten Sie mir, dass ich etwas sage, was bei aller Diskussion um Sockelbeträge und Schadstoffhöhen in meinen Augen bei diesem Thema immer wieder zu kurz kam: In Deutschland stehen zurzeit wie anderenorts viele Tausend Arbeitsplätze auf dem Spiel, gerade in dieser Branche. Dabei spreche ich bei weitem nicht allein von den namhaften Zentren und Marken, sondern vor allem von den vielen kleinen und mittleren Zulieferern in diesem Bereich. Das gilt für den Kleinwagen ebenso wie für die Premiumklasse. Uns geht es um den Erhalt dieser Arbeitsplätze in allen Regionen.
Wir stehen nicht für Protektionismus, den manch ein europäischer Nachbar zurzeit betreibt. Wir haben dies heute Morgen bereits mehrfach zum Ausdruck gebracht. Wir sollten aber gerade deshalb aufpassen, dass wir im Übereifer von Forderungen nach Regelungen und Zielen am Ende nicht selbst eigene Arbeitsplätze gefährden, schon gar nicht jetzt und heute. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht staatstragend morgens vor den Kameras den Protektionismus geißeln, um ebendiesen dann hier populistisch einzufordern.
Man kann sich sicherlich bei allen Maßnahmen, die heute Morgen besprochen wurden, immer ein Mehr wünschen. Man kann sich auch einen anderen Weg der Umsetzung wünschen. Ich bin jedoch der Überzeugung, dass wir vor dem Hintergrund des Gesagten, wenn man alle Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket zusammennimmt, heute einen guten, einen wichtigen und einen richtigen Schritt gehen. Lassen Sie uns dieses Paket kraftvoll beschließen, um der Krise wirkungsvoll entgegenzutreten.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Ich schließe die Aussprache.
[Der folgende Berichtsteil - und damit der gesamte Stenografische Bericht der 196. Sitzung - wird am
Montag, den 16. Februar 2009,
auf der Website des Bundestages unter ?Aktuelles?, ?Plenarprotokolle?, ?Endgültige Fassungen? veröffentlicht.]