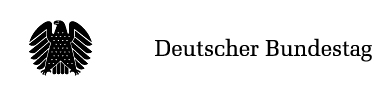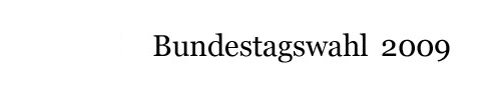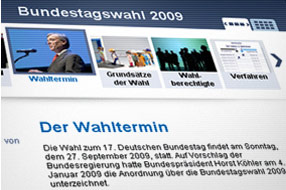Zum Thema Wahlen 2009
- Absolute Mehrheit (Gewichtung 4)
- Aktives Wahlrecht (Gewichtung 2)
- Briefwahl (Gewichtung 1)
- Bundestagswahl (Gewichtung 4)
- Bundestagswahlkreis (Gewichtung 1)
- Bundeswahlausschuss (Gewichtung 3)
- Bundeswahlgesetz (Gewichtung 3)
- Bundeswahlleiter (Gewichtung 1)
- Direktkandidat (Gewichtung 3)
- Fünf-Prozent-Hürde (Gewichtung 4)
- Kanzlerwahl (Gewichtung 2)
- Landeslisten (Gewichtung 1)
- Mandat (Gewichtung 4)
- Sitzverteilung (Gewichtung 3)
- Ungültige Stimmzettel (Gewichtung 3)
- Wahlbenachrichtigung (Gewichtung 4)
- Wahlkampfkostenerstattung (Gewichtung 2)
- Wahlprüfung (Gewichtung 4)
Der erste freie Urnengang seit 17 Jahren
Die Bundestagswahlen – Teil 1: 1949
Keine drei Monate nach Verabschiedung des Grundgesetzes im Mai 1949 finden die Wahlen zum ersten Deutschen Bundestag statt. Mehr als vier Jahre nach Kriegsende, erstmals seit 1932, dürfen die Wähler wieder frei ihr Parlament wählen. 78,5 Prozent, das sind 24,5 Millionen der insgesamt gut 31 Millionen Wahlberechtigten, machen am 14. August 1949 von ihrem Recht Gebrauch.
Das neue demokratische politische System „Bundesrepublik“ wird durch die Stimmen der Wähler mit Leben erfüllt. Die hohe Wahlbeteiligung wird politisch auch als Zustimmung zum Grundgesetz gewertet. Und schon dieser Wahlkampf wird hart und polemisch geführt.
Jede der beiden großen Parteien CDU/CSU und SPD erwartet ihren Sieg und dass sie den Anfang der neuen Bundesrepublik entscheidend bestimmen wird.
Parteien und Parolen
Insgesamt kandidieren in den Bundesländern 16 Parteien sowie Parteilose und Unabhängige für den ersten Deutschen Bundestag. Der Aufwand im Wahlkampf ist noch bescheiden – Plakate und Wagen mit Lautsprechern, die Parolen und Termine für Wahlversammlungen verkünden. Fernsehen gibt es 1949 noch nicht.
In diesem ersten Wahlkampf stehen wirtschaftliche Argumente im Vordergrund. Die Wahlplakate spiegeln in ihren einfachen Botschaften die Nöte und Wünsche der Zeit wider. Die Deutschen wollen aus dem Elend heraus, das ihnen der Krieg hinterlassen hat. Die CDU versichert: „Wir können nicht zaubern, aber arbeiten.“ Die SPD prägt den Slogan: „Alle Millionäre wählen CDU-FDP, alle übrigen Millionen Deutsche die SPD“.
Die FDP erklärt vor dem Bild einer Werft: „Darum geht es: Nur Wirtschaftskönner bürgen für Arbeit und Wohlstand.“ Prognosen gehen von einem Sieg der Sozialdemokraten aus, doch die Wähler schrecken offenbar vor den Vokabeln des Klassenkampfes und der Planwirtschaft im SPD-Programm zurück. Die CDU hat vor allem mit dem Programm der sozialen Marktwirtschaft Erfolg.
Prägend: Kanzler Adenauer und Oppositionsführer Schumacher
Der eine wird erster Bundeskanzler, der andere erster Oppositionsführer im Bundestag: Konrad Adenauer, CDU-Abgeordneter aus Rhöndorf, und Kurt Schumacher, SPD-Vorsitzender, sind die Spitzenkandidaten der aussichtsreichsten Parteien. Zwei starke Persönlichkeiten, die auf Konfrontationskurs gehen.
Adenauer rückt die SPD in die Nähe der Kommunisten und schürt die Angst vor der roten Gefahr. Schumacher setzt auf soziale Gerechtigkeit und die Einheit des Landes gegen Kapitalismus und Westorientierung Adenauers. Eine große Koalition, in der sich einer dem anderen unterordnen müsste, kommt für die Spitzenkandidaten nicht in Frage.
Am Ende gewinnt Adenauer, Schumacher führt die SPD als konstruktive Opposition. Sie soll zur Regierungspolitik alternative Konzepte liefern statt nur zu kritisieren. Schumacher, nach zehnjähriger politischer Haft im Konzentrationslager 1943 todkrank entlassen, starb 1952 im Alter von 57 Jahren.
Wahlergebnis
Die CDU/CSU bildet mit 31 Prozent der Stimmen die stärkste, die SPD mit 29,2 Prozent die zweitstärkste Fraktion. Die FDP erhält 11,9 Prozent der Stimmen, die KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) 5,7 Prozent. Die restlichen Stimmen erhalten unter anderem die BP (Bayernpartei) mit 4,2 Prozent, die DP (Deutsche Partei) mit 4 Prozent und das Zentrum mit 3,1 Prozent.
Die Mandate verteilen sich insgesamt auf zwölf parteipolitische Gruppierungen. Mit der knappen Mehrheit von einer Stimme schließen die Fraktionen von CDU/CSU, FDP und DP (Deutsche Partei) ein Regierungsbündnis.
Entwicklung der Parteienlandschaft
Die Fünf-Prozent-Hürde gibt es 1949 nur landesweit, das heißt, um in den Bundestag einzuziehen, muss eine Partei nur in einem Land fünf Prozent der Stimmen erhalten oder einen Wahlkreis direkt gewinnen. Auch die Zweitstimme wird erst bei der zweiten Bundestagswahl 1953 eingeführt.
Das Ergebnis der ersten Bundestagswahl deutet bereits eine Entwicklung an, die sich in den folgenden Jahren verstärken wird. Noch gibt es viele kleine politische Gruppierungen, aber CDU/CSU, SPD und FDP sind mit Abstand die drei stärksten Parteien. Die kleinen Parteien verschwinden nach und nach, gehen in großen Parteien auf oder scheitern an der späteren bundesweiten Fünf-Prozent-Klausel. Ab 1961 sind nur noch die Union, die Sozialdemokraten und die Liberalen im Parlament, bevor 1983 die Grünen und nach der Wiedervereinigung die PDS in den Bundestag einziehen.