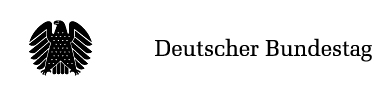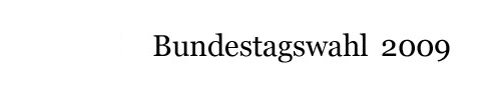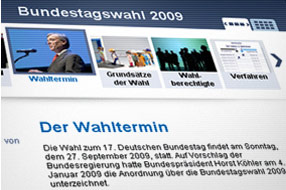Zum Thema Wahlen 2009
- Absolute Mehrheit (Gewichtung 4)
- Aktives Wahlrecht (Gewichtung 2)
- Briefwahl (Gewichtung 1)
- Bundestagswahl (Gewichtung 4)
- Bundestagswahlkreis (Gewichtung 1)
- Bundeswahlausschuss (Gewichtung 3)
- Bundeswahlgesetz (Gewichtung 3)
- Bundeswahlleiter (Gewichtung 1)
- Direktkandidat (Gewichtung 3)
- Fünf-Prozent-Hürde (Gewichtung 4)
- Kanzlerwahl (Gewichtung 2)
- Landeslisten (Gewichtung 1)
- Mandat (Gewichtung 4)
- Sitzverteilung (Gewichtung 3)
- Ungültige Stimmzettel (Gewichtung 3)
- Wahlbenachrichtigung (Gewichtung 4)
- Wahlkampfkostenerstattung (Gewichtung 2)
- Wahlprüfung (Gewichtung 4)
15 Millionen Wahlberechtigte mehr
Die Bundestagswahlen – Teil 12: 1990
Zur ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl nach der Vereinigung sind 15 Millionen mehr Wahlberechtigte aufgerufen. Die Wiedervereinigung ist auch das überragende Thema im Wahlkampf für die Wahl am 2. Dezember 1990. Von der von ihm vorangetriebenen deutschen Einheit und seinen optimistischen Prognosen profitiert Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl (CDU), seine Chancen auf eine Wiederwahl stehen günstig. Für die SPD tritt Oskar Lafontaine an, der die Finanzierung der Einheit zum Thema macht.
Für diese Wahl gelten zwei getrennte Wahlgebiete, das heißt die Fünf-Prozent-Hürde ist abgeschwächt: Für den Einzug in den Bundestag reicht es aus, nur auf dem Gebiet der ehemaligen DDR oder in der Bundesrepublik fünf Prozent der Stimmen zu erlangen. Auch die West-Berliner dürfen erstmals direkt wählen. Die Sonderregelung, dass die 22 Berliner Bundestagsabgeordneten durch das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt werden, fällt weg.
Fast 47 Millionen wählen
Insgesamt sind 60,4 Millionen Deutsche wahlberechtigt, gut 15 Millionen mehr als 1987. Bei der letzten Bundestagswahl vor der Vereinigung waren es 45,3 Millionen Wahlberechtigte gewesen. Knapp 47 Millionen Wähler gehen schließlich zur Wahl, das sind 8,5 Millionen mehr als bei der Wahl zum elften Bundestag. Die Wahlbeteiligung betrug somit 77,8 Prozent, in den westlichen Ländern 78,6 und in den östlichen 74,5 Prozent.
Staatsvertrag für gemeinsame Wahlen
Mit dem am 3. August 1990 unterzeichneten Staatsvertrag wird der Weg zu gesamtdeutschen Wahlen geebnet. Er schafft eine einheitliche Rechtsgrundlage durch Ausweitung des Bundeswahlrechts auf die Länder der DDR.
So wird auch die Mitgliederzahl des Bundestages auf 656 Abgeordnete erhöht, Listenverbindungen verschiedener Parteien werden zugelassen. Bei dieser Wahl bewerben sich 25 Parteien und Listenvereinigungen um das Votum der Wählerinnen und Wähler, darunter erstmals die PDS sowie 31 Einzelbewerber und Wählergruppen wie „Der springende Punkt“ und „Fußballreform“.
Topthema Wiedervereinigung
Der Wahlkampf steht ganz im Zeichen der am 3. Oktober 1990 vollzogenen Vereinigung der Bundesrepublik mit der DDR. Die am heftigsten diskutierte Frage im Wahlkampf ist die der Finanzierung der deutschen Einheit. Sie entfachte einen heftigen Streit zwischen Dr. Helmut Kohl (CDU/CSU) und seinem Herausforderer, dem saarländischen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine (SPD).
Als Bundeskanzler hatte Kohl maßgeblichen Anteil am Zustandekommen der staatlichen Einigung und genießt daher einen „Amtsbonus“. Daher wirbt seine Partei mit der Parole „Kanzler für Deutschland“ auf seinem Porträt. Die SPD setzt dem „Oskar Lafontaine – Der neue Weg“ und „Jetzt das moderne Deutschland wählen“ entgegen. Die Liberalen rufen auf: „Genscher wählen. F.D.P. wählen. Das liberale Deutschland." Die PDS gibt den Slogan „Links ist lebendig“ aus, die Grünen im Westen spielen mit „Aber, aber, wer wird denn gleich in die Luft gehen“ auf die Atomenergie an, für deren Ausstieg sie in diesem Wahlkampf antreten.
Kanzler-Herausforderer Lafontaine
Nachdem Johannes Rau auf eine erneute Kanzlerkandidatur verzichtet hat, stellt die SPD Oskar Lafontaine auf. Lafontaine wurde 1943 geboren, ist Diplom-Physiker, war Oberbürgermeister von Saarbrücken, bevor er 1985 Ministerpräsident im Saarland wird. Nach dem Fall der Mauer warnt Lafontaine vor einer "nationalen Besoffenheit" und sieht den Weg zur Wiedervereinigung mit mehr Skepsis, vor allem ihre Finanzierung. Bei einem Wahlkampfauftritt in Köln-Mülheim wird Lafontaine Opfer eines Attentates, von dem er sich schneller als erwartet wieder erholt. Auf dem SPD-Vereinigungsparteitag im September 1990 in Berlin wird Lafontaine nahezu einstimmig zum Kanzlerkandidaten der vereinigten SPD gewählt.
Wahlergebnis
Die Regierungskoalition aus CDU/CSU und F.D.P. geht als Sieger aus der Wahl hervor. Auf die CDU/CSU entfallen 43,8 Prozent der Stimmen, auf die FDP elf Prozent. Der Anteil der Stimmen der SPD sinkt von 37 auf 33,5 Prozent, ihr schlechtestes Ergebnis seit 1957. Die Grünen verfehlen im Westen die Fünf-Prozent-Hürde, die PDS und Bündnis 90 überwinden sie nur im Osten. Die FDP unter dem populären Außenminister Hans-Dietrich Genscher gewinnt deutlich, in dessen Geburtstadt Halle an der Saale erringt sie ein Direktmandat.
Die westdeutschen Grünen scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde (3,8 Prozent). Die Einteilung in zwei Wahlgebiete sichert dagegen der östlichen Listenverbindung Bündnis 90/Grüne den Einzug ins Parlament, sie erzielt in den neuen Bundesländern einschließlich Berlins 6,1 Prozent der Stimmen.
PDS im Bundestag
Eine neue politische Kraft im Bundestag: Dank der Sonderregelung dieser Wahl, die Sperrklausel getrennt auf Ost- und Westdeutschland anzuwenden, kann die SED-Nachfolgepartei PDS trotz der bundesweit erreichten 2,4 Prozent der Zweitstimmen in den Bundestag einziehen. Denn im Wahlgebiet Ost kommt sie auf 11,1 Prozent der Stimmen, im Westen nur auf 0,3 Prozent. Dem Bundestag hatten bereits seit der Wiedervereinigung 24 PDS-Abgeordnete angehört, die von der letzten Volkskammer der DDR gewählt worden waren.
Wegen zu geringer Abgeordnetenzahl erhalten Bündnis 90/Grüne mit acht Mandaten und PDS/Linke Liste mit 17 Mandaten keinen Fraktionsstatus, sondern lediglich einen Gruppenstatus.