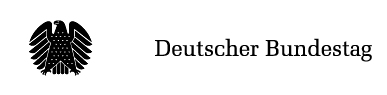Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Protokolle > Vorläufige Plenarprotokolle > Vorläufiges Protokoll der 102. Sitzung vom 07. April 2011
Vorläufiges Protokoll der 102. Sitzung vom 07. April 2011
102. Sitzung
Berlin, Donnerstag, den 7. April 2011
Beginn: 9.00 Uhr
* * * * * * * * V O R A B - V E R Ö F F E N T L I C H U N G * * * * * * * *
* * * * * DER NACH § 117 GOBT AUTORISIERTEN FASSUNG * * * * *
* * * * * * * * VOR DER ENDGÜLTIGEN DRUCKLEGUNG * * * * * * * *
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Die Sitzung ist eröffnet. Nehmen Sie bitte Platz.
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie herzlich zu unserer 102. Plenarsitzung.
Ich habe vor Eintritt in die Tagesordnung zwei Mitteilungen über Umbesetzungen zu machen. Die Fraktion der CDU/CSU hat mitgeteilt, dass der Kollege Dr. Hans-Peter Friedrich aus dem Gemeinsamen Ausschuss ausscheidet. Als seine Nachfolgerin wird die Kollegin Gerda Hasselfeldt vorgeschlagen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es dazu Einverständnis gibt.
Das ist offensichtlich der Fall. Damit ist die Kollegin Hasselfeldt in den Gemeinsamen Ausschuss gewählt.
Der Kollege Joachim Günther ist aus dem Stiftungsrat der Bundesstiftung Baukultur ausgeschieden. Die Fraktion der FDP schlägt an seiner Stelle die Kollegin Petra Müller vor. Sind Sie auch damit einverstanden?
- Wir halten den spontanen Jubel im Protokoll fest. Damit ist die Kollegin Müller zum Mitglied des Stiftungsrates der Bundesstiftung Baukultur gewählt.
Interfraktionell ist vereinbart worden, die verbundene Tagesordnung um die in der Zusatzpunktliste aufgeführten Punkte zu erweitern:
ZP 1 Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktion der SPD:
Gründe des Bundeswirtschaftsministers gegen ein Verbot von Klonfleisch
(siehe 101. Sitzung)
ZP 2 Beratung des Antrags der Abgeordneten René Röspel, Dr. Carola Reimann, Dr. Ernst Dieter Rossmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD
Gesundheitsforschung an den Bedarfen der Patientinnen und Patienten ausrichten - Rahmenprogramm Gesundheitsforschung der Bundesregierung überarbeiten
- Drucksache 17/5364 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung (f)
Sportausschuss
Rechtsausschuss
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Gesundheit
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Haushaltsausschuss
ZP 3 Weitere Überweisung im vereinfachten Verfahren
Ergänzung zu TOP 31
Beratung des Antrags der Abgeordneten Martin Dörmann, Lars Klingbeil, Garrelt Duin, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD
Netzneutralität im Internet gewährleisten - Diskriminierungsfreiheit, Transparenzverpflichtungen und Sicherung von Mindestqualitäten gesetzlich regeln
- Drucksache 17/5367 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie (f)
Innenausschuss
Rechtsausschuss
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen
Union
Ausschuss für Kultur und Medien
ZP 4 Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Rechtsausschusses (6. Ausschuss)
- zu dem Antrag der Abgeordneten Caren Lay, Dr. Dietmar Bartsch, Herbert Behrens, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE
Unlautere Telefonwerbung effektiv verhindern
- zu dem Antrag der Abgeordneten Nicole Maisch, Bärbel Höhn, Kerstin Andreae, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Unerlaubte Telefonwerbung wirksam bekämpfen
- Drucksachen 17/3041, 17/3060, 17/3587 -
Berichterstattung:
Abgeordnete Dr. Patrick Sensburg
Marianne Schieder (Schwandorf)
Stephan Thomae
Halina Wawzyniak
Ingrid Hönlinger
ZP 5 Erste Beratung des von den Abgeordneten Ingrid Hönlinger, Jerzy Montag, Volker Beck (Köln), weiteren Abgeordneten und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des § 522 der Zivilprozessordnung
- Drucksache 17/5363 -
Überweisungsvorschlag:
Rechtsausschuss
ZP 6 Beratung des Antrags der Abgeordneten Rainer Arnold, Dr. Hans-Peter Bartels, Dr. h. c. Gernot Erler, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD
Ausgleich für Radargeschädigte der Bundeswehr und der ehemaligen NVA voranbringen
- Drucksache 17/5365 -
Überweisungsvorschlag:
Verteidigungsausschuss (f)
Rechtsausschuss
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Gesundheit
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Haushaltsausschuss
ZP 7 Beratung des Antrags der Abgeordneten Agnes Malczak, Katja Keul, Tom Koenigs, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Umfassende Entschädigung für Radarstrahlenopfer der Bundeswehr und der ehemaligen NVA
- Drucksache 17/5373 -
Überweisungsvorschlag:
Verteidigungsausschuss (f)
Rechtsausschuss
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Gesundheit
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Haushaltsausschuss
ZP 8 Beratung des Antrags der Fraktion der SPD
Deutschland im VN-Sicherheitsrat - Impulse für Frieden und Abrüstung
- Drucksache 17/4863 -
Überweisungsvorschlag:
Auswärtiger Ausschuss (f)
Verteidigungsausschuss
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Haushaltsausschuss
ZP 9 Beratung des Antrags der Fraktion der SPD
Tschernobyl mahnt - Für eine zukunftssichere Energieversorgung ohne Atomkraft und eine lebendige europäische Erinnerungskultur
- Drucksache 17/5366 -
Von der Frist für den Beginn der Beratungen soll, soweit erforderlich, abgewichen werden.
Der Tagesordnungspunkt 19 wird abgesetzt.
Schließlich mache ich auf eine nachträgliche Ausschussüberweisung im Anhang zur Zusatzpunktliste aufmerksam:
Der am 24. März 2011 überwiesene nachfolgende Gesetzentwurf soll zusätzlich dem Finanzausschuss (7. Ausschuss) und dem Ausschuss für Arbeit und Soziales (11. Ausschuss) zur Mitberatung überwiesen werden:
Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über die Vereinfachung des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
- Drucksache 17/5096 -
Überweisungsvorschlag:
Innenausschuss (f)
Rechtsausschuss
Finanzausschuss
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Sind Sie mit diesen Vereinbarungen einverstanden? - Das ist offensichtlich der Fall. Dann ist das so beschlossen.
Ich rufe nun unseren Tagesordnungspunkt 3 sowie den Zusatzpunkt 2 auf:
3. Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung
Rahmenprogramm Gesundheitsforschung der Bundesregierung
- Drucksache 17/4243 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung (f)
Sportausschuss
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Gesundheit
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
ZP 2 Beratung des Antrags der Abgeordneten René Röspel, Dr. Carola Reimann, Dr. Ernst Dieter Rossmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD
Gesundheitsforschung an den Bedarfen der Patientinnen und Patienten ausrichten - Rahmenprogramm Gesundheitsforschung der Bundesregierung überarbeiten
- Drucksache 17/5364 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung (f)
Sportausschuss
Rechtsausschuss
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Gesundheit
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Haushaltsausschuss
Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 90 Minuten vorgesehen. - Ich höre keinen Widerspruch. Dann können wir so verfahren.
Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort zunächst der Bundesministerin Frau Dr. Schavan.
Dr. Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung:
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Rahmenprogramm Gesundheitsforschung der Bundesregierung ist ein Schwergewicht bei den Rahmenprogrammen für die kommenden Jahre. Dies ist aus gutem Grund so. Denn die demografische Entwicklung in Deutschland - 2050 wird bereits jeder dritte Bürger älter als 65 sein - macht eine Konzentration auf damit verbundene Veränderungen notwendig; diese müssen in der Gesundheitsversorgung, im Gesundheitssystem und vorausgehend in der Gesundheitsforschung vorgenommen werden. Deshalb ist das neue Rahmenprogramm für die kommenden acht Jahre von neuen Schwerpunkten, struktureller Weiterentwicklung und Internationalisierung geprägt. Das sind die drei zentralen Merkmale des neuen Rahmenprogramms. Seitens des BMBF werden bis zum Jahre 2014 rund 6 Milliarden Euro investiert werden.
Wenn ich von Schwergewicht spreche, dann hat das natürlich auch mit der herausragenden Kompetenz und dem herausragenden Potenzial in der Gesundheitsforschung zu tun, die in unseren großen Forschungsorganisationen stecken. Ich denke nur an die Institute der Helmholtz-Gemeinschaft, aber auch - das ist die entscheidende strukturelle Weiterentwicklung - an das, was an zahlreichen Universitätsinstituten in Deutschland schon geleistet wird. Deshalb ist in meinen Augen die größte Veränderung - übrigens auch die größte Veränderung in der Gesundheitsforschung, die es in Deutschland bislang überhaupt gegeben hat - die Gründung von nationalen Gesundheitsforschungszentren. Dies ist eine neue Art der Zusammenarbeit zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung und führt, damit verbunden, zu einer größeren Nähe zu den Erkenntnissen, die in der Forschung gewonnen werden, was den Patienten zugutekommt. Der Grundgedanke ist: Die Erkenntnisse müssen schneller und wirksamer zum Patienten.
In den vergangenen Jahren sind viele Analysen durchgeführt worden, in denen immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass die Trennung der Hochschulmedizin von den Forschungsinstituten den Weg erschwert. Es braucht eine Bündelung der Kräfte, es braucht Verbindungen, und es braucht, damit zusammenhängend, höhere Investitionen in die Hochschulmedizin. Das Rahmenprogramm ist übrigens auch ein großer Beitrag des Bundes - und somit Konsequenz aus der Entscheidung des Parlamentes - zur finanziellen Unterstützung der Hochschulmedizin. Es ist Zeit, dass das große Potenzial, das in unseren Universitäten vorhanden ist, finanziell entsprechend unterstützt wird. Das Rahmenprogramm Gesundheitsforschung wird hierfür in den nächsten Jahren die Voraussetzungen schaffen.
Im April dieses Jahres wird die Auswahl der Standorte stattfinden. Ich werde schon Ende dieses Monats die Deutschlandkarte präsentieren können, die Ihnen zeigen wird, an wie vielen Standorten wir in Zukunft mit sehr viel intensiverer Forschung im Bereich der Gesundheit und mit der Verwirklichung der Schwerpunkte, die in diesem Programm enthalten sind, rechnen können.
Ich nenne drei zentrale Schwerpunkte.
Erstens: die individualisierte Medizin. Dazu sind erhebliche weitere Forschungsanstrengungen notwendig. Dies ist aber auch eine große Herausforderung für die Versorgungssysteme.
Zweitens: die Präventions- und Ernährungsforschung, auch die Versorgungsforschung, die insgesamt eine Verbindung zwischen der Forschung, unserem Gesundheitssystem und der Gesundheitsversorgung herstellt. Es geht dabei um mehr individuelle Zugangswege und eine bessere Versorgung vor allem der multimorbiden Patienten.
Drittens: das Aktionsfeld internationale Kooperation mit dem Schwerpunkt bei vernachlässigten Krankheiten oder, anders gesagt, Volkskrankheiten in den Entwicklungsländern.
Wir haben über diese Themen sowohl im Fachausschuss für Bildung und Forschung als auch im Gesundheitsausschuss und im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung diskutiert. Ich messe dem Aktionsfeld internationale Kooperation eine herausragende Bedeutung bei. Die Gesundheitsforschung muss in den nächsten Jahren angesichts der Möglichkeiten, die wir in Deutschland haben, aber auch angesichts der Möglichkeiten, die wir auf europäischer Ebene haben, noch stärker genutzt werden, um internationale Verantwortung wahrzunehmen. Sie ist ein wichtiges Aktionsfeld der internationalen Verantwortung, auch in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit.
Meine Damen und Herren, ich werde nicht auf weitere Einzelheiten eingehen; denn das Rahmenprogramm Gesundheitsforschung liegt Ihnen vor. Ich will auf den Antrag der SPD eingehen, der heute in diesem Hause eingebracht worden ist. Mich hat dieser Antrag insofern verwundert, als er die Tatsachen im Hinblick auf das Rahmenprogramm Gesundheitsforschung an vielen Stellen ins Gegenteil verkehrt.
Erstens. Wenn Sie davon reden, dass dieses Rahmenprogramm allgemein gehalten ist, dann muss ich Ihnen sagen - wir haben ausdrücklich und ausführlich darüber diskutiert -: Wir legen bewusst ein Rahmenprogramm vor, das in den nächsten acht Jahren Entwicklungen möglich macht. Wir legen bewusst ein Programm vor, das die Richtung vorgibt, basierend auf dem, worüber wir mit dem Gesundheitsforschungsrat diskutiert haben. Wir legen Schwerpunkte fest. Jeder von Ihnen weiß, dass es einer Verwechslung von Äpfeln mit Birnen gleicht, wenn man ein Rahmenprogramm mit konkreten Förderausschreibungen verwechselt.
Zweitens. Sie schreiben, die verstärkte Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft - es ist auch die Rede von einer Stärkung der Gesundheitswirtschaft - sei das Leitmotiv dieses Rahmenprogramms. Wir haben lange darüber diskutiert. Wenn in diesem Rahmenprogramm von Translation und Wissenstransfer die Rede ist - und zwar auf der Basis der Zentren, die wir in den letzten Jahren schon aufgebaut haben -, dann geht es eben nicht um verkaufbare Produkte, sondern es geht um neue Therapien, um neue Leitlinien für Diagnose und Therapie, um unmittelbare Verbesserungen für die Patienten.
Nachdem wir so viel darüber diskutiert haben, lieber Herr Röspel, kann ich, wenn ich jetzt Ihren Antrag lese, nur davon ausgehen, dass Sie nicht wahrnehmen wollen, dass vieles von dem, was in dieses Rahmenprogramm aufgenommen worden ist, gerade aus den gemeinsamen Diskussionen, die wir geführt haben, resultiert. Ich finde das bedauerlich; denn der Bereich der Gesundheitsforschung wäre wunderbar geeignet, um auch einmal gemeinsam die Richtung für die nächsten Jahre vorzugeben.
- Das ist wahr. - Ganz abgesehen davon hielte ich es, wenn die Gesundheitswirtschaft und die damit verbundene Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen dieses Parlament und diese Bundesregierung gleichgültig lassen würden, für eine komische Grundeinstellung.
Das Leitmotiv ist klar - dabei können wir auch gut auf Entwicklungen der letzten Jahre aufbauen -: Wir wollen die Wege zum Patienten verkürzen. Wir wollen, dass das, was die Gesundheitsforschung an neuen Ansätzen und individualisierter Medizin ermöglicht, in dem gesamten System der Gesundheitsversorgung wirklich Platz greift und wirkt. Aber wir wollen auch, dass sich die Gesundheitswirtschaft in Deutschland gut entwickeln kann,
weil sie eine Wachstumsbranche schlechthin ist, weil sie gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und vor dem Hintergrund von hochqualifizierten Arbeitsplätzen, die in dieser Branche geschaffen werden, von großer Bedeutung ist.
Sie schreiben, es gebe Defizite bei der Ausbildung klinischer Forscher. Sie wissen aber, dass die genannten Defizite mit diversen Förderschwerpunkten ganz gezielt angegangen werden, zum Beispiel in den Klinischen Studienzentren oder in den Integrierten Forschungs- und Behandlungszentren.
Sie sprechen davon, dass wir uns zu wenig mit der gesundheitsökonomischen Dimension des ganzen Themas beschäftigen. Sie wissen aber, dass längst Zentren der gesundheitsökonomischen Forschung eingerichtet werden.
Ich nenne diese wenigen Punkte aus Ihrem Antrag, weil ich der Meinung bin, dass wir in der Frage der Gesundheitsforschung einschließlich der damit verbundenen Schwerpunkte und strukturellen Verbindungen und Veränderungen möglichst viel Zusammenarbeit brauchen - auch zwischen Bund und Ländern. Deshalb wünsche ich mir für die gute Umsetzung dieses Schwergewichtes unserer Forschungsstrategie eine gute Verbindung zu den Ländern und einen möglichst weitgehenden parteiübergreifenden Konsens; denn wir reden über ein Forschungsfeld, das zutiefst mit humaner Entwicklung in unserer Gesellschaft, exzellenter Forschung und neuen Verbindungen zwischen der Forschung, dem Gesundheitssystem und der Gesundheitsversorgung zusammenhängt. Das Potenzial war noch nie so groß. Die finanziellen Investitionen waren noch nie mit so vielen Möglichkeiten verbunden, und die Strukturen, die wir auf den Weg bringen, sind die Konsequenz aus dem, was in vielen Analysen über das Gesundheitssystem und die Gesundheitsforschung in Deutschland zutage getreten ist. Deshalb geht mein Dank auch an diejenigen, mit denen dieses Programm aufseiten des Parlaments diskutiert werden konnte. Ich bitte um Unterstützung für die Umsetzung in den nächsten acht Jahren.
Vielen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nächster Redner ist der Kollege René Röspel für die SPD-Fraktion.
René Röspel (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Oktober 2007 ist die ?Roadmap für das Gesundheitsforschungsprogramm der Bundesregierung“ publiziert worden, herausgegeben vom Gesundheitsforschungsrat des BMBF. Das ist ein Rat, der mit hochkarätigen deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besetzt ist. Er hat sich im Beratungsprozess mit über 900 Beteiligten getroffen - leider waren darunter keine Patientenvertreter und keine Vertreter der Komplementärmedizin; dazu werde ich gleich kurz noch etwas sagen - und einige Jahre diskutiert. Er hatte die Aufgabenstellung, zu beraten, welche aussichtsreichen Forschungsthemen im Bereich der Gesundheit zu identifizieren sind und der Bundesregierung sozusagen mit auf den Weg gegeben werden können, um ein Gesundheitsforschungsprogramm zu erarbeiten und zu beschließen.
Dieses haben wir im Oktober 2007 auf den Tisch bekommen, und ich muss sagen: Es ist ein richtiges Schwergewicht - 120 Seiten vollgepackt mit Informationen, wissenschaftlichen Arbeiten, Handlungsoptionen und Vorschlägen. Wir waren damals, als wir darüber diskutiert haben, sehr zufrieden damit und haben gesagt: Es wird spannend, was für ein Gesundheitsforschungsprogramm aus den Vorschlägen der beteiligten Wissenschaftler entstehen wird.
Knapp anderthalb Jahre später haben wir nachgefragt. Im Januar 2009 bekamen wir die Antwort: Im April/Mai wird es eine Kabinettsbefassung mit dem Gesundheitsforschungsprogramm geben. Ein weiteres Jahr später, im Februar 2010, haben wir noch einmal nachgefragt, wann das Gesundheitsforschungsprogramm vorliegen wird. Es wurde dann eine ähnliche Antwort gegeben: Kabinettsbefassung im April/Mai.
Ende 2010 flatterte eine Hochglanzbroschüre des BMBF in unsere Büros - übrigens ohne vorherige Diskussion; ich weiß nicht, in welchen parlamentarischen Zirkeln das vorher besprochen worden ist -, auf der stand: ?Rahmenprogramm Gesundheitsforschung der Bundesregierung“.
Das Deckblatt ist übrigens im seit 2005 üblichen CDU-Orange gehalten. Wir waren sehr gespannt, was in diesem Rahmenprogramm steht. Es sind 48 Seiten; es müssen ja auch nicht wieder 120 Seiten sein. Aber wenn man hineinschaut, dann findet man erst einmal eine ganze Reihe von Hochglanzfotos. Sehr interessant! Zieht man sie ab, bleiben von den 48 Seiten 30 Seiten Text.
Auch das ist okay.
Wenn man sich diesen Text dann aber ansieht - das ist alles andere als ein Schwergewicht, Frau Schavan, das ist ein wirkliches Leichtgewicht -, dann ist die Enttäuschung sehr groß,
und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist ein inhaltlicher: Bei der Erarbeitung des Gesundheitsforschungsrahmenprogramms haben Sie die wissenschaftlichen Chancen nicht genutzt;
sie finden sich im Gesundheitsforschungsprogramm nicht wieder. Sie haben die Arbeit der deutschen Wissenschaft schlicht und einfach nicht genutzt.
Der zweite Punkt, der mich fast ärgert, ist: Sie haben nicht die Möglichkeit genutzt, mit dem Gesundheitsforschungsprogramm ein gesellschaftliches und politisches Zeichen mit einer entsprechenden Dimension zu setzen. Wenn man das Programm liest, dann erhält man in der Tat den Eindruck, dass die Gesundheitsforschung in diesem Programm dazu dienen soll, möglichst schnell wirtschaftlich verwertbare Produkte zu generieren. Sie nennen das: Erkenntnisse ?an den Patienten bringen“. Das zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Programm. Um das visuell deutlich zu machen, habe ich rote Zettel eingelegt. Überall dort, wo sich ein roter Zettel befindet, wird die Wirtschaft betont. Das darf man machen, aber es dient nicht der Gesundheitsforschung.
Wir als SPD haben eine andere Auffassung, Frau Schavan. Gesundheitsforschung soll nicht der Wirtschaft dienen, sondern den Menschen.
Sie hingegen - das haben wir auch in Ihrem Redebeitrag gerade wieder gehört - zäumen das Pferd von der anderen Seite auf. Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Die Frage ist: Wie können wir den Menschen dienen, und wie kann man vom Menschen her darüber nachdenken, welche Gesundheitsforschung betrieben werden muss?
Dann ergeben sich auch noch andere Fragen: Was müssen wir machen, damit die Menschen gesund bleiben? Was müssen wir in der Forschung tun, damit Kranke wieder gesund werden?
Vor dem Hintergrund dieser Sichtweise ergeben sich wieder andere Fragen: Wie sehen die Lebensbedingungen von Menschen aus? Wie schaffen wir Arbeitsplätze und Situationen, mit denen es gelingt, dass Menschen gesund bleiben? Wie schaffen wir entsprechende Lebensbedingungen? Welche Ernährungsforschung und Versorgungsforschung betreiben wir? Wie gehen wir mit Kranken um?
Das sind die Fragen, die sich ergeben, wenn man vom Menschen her denkt, und das finden wir in dem Gesundheitsforschungsprogramm leider nicht.
Ihre Antworten sind anders. Zum Teil sind sie nicht vorhanden; die Bereiche Arbeits- und Dienstleistungsforschung gibt es nicht. Es gibt aber ein Kapitel über Versorgungsforschung, Ernährungs- und Präventionsforschung. Wie sehen hier Ihre Antworten aus? Sie können sich hier nicht darauf zurückziehen, dass das nur ein grober Überblick ist. Es muss mehr sein als nur Textbeiträge.
Ich habe alles mit Spannung gelesen. Auf Seite 33 schreiben Sie:
Die Bedeutung der gesundheitsökonomischen Forschung hat in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen.
Der Bedarf an fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen … wird immer dringlicher. Forschung kann hierfür konsistente Entscheidungsgrundlagen schaffen.
Das ist alles richtig. Jetzt warten wir auf die Vorschläge. Was aber kommt? Nichts. Es folgt das nächste Kapitel: ?Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses“. Darin verweisen Sie darauf, dass mehr Lehrstühle für Versorgungsforschung geschaffen werden müssen. Das ist Länderaufgabe. Wo ist die Verantwortung des Bundes?
Welche Vorschläge bieten Sie zur Gesundheitsforschung für die Menschen?
Das Programm ist eine inhaltliche Enttäuschung für uns. Sie machen keine Gesundheitsforschung, sondern Krankheitenerforschung. Das greift zu kurz.
Ich will ein aktuelles Beispiel nennen. Einige Kollegen haben gestern an einer Veranstaltung zur Komplementärmedizin teilgenommen, bei der es auch um Naturheilkunde und alternative medizinische Verfahren ging. 90 Prozent der Menschen, die auf diese Weise behandelt werden, sind sehr zufrieden. Das spielt also gesellschaftlich eine Rolle.
In der ?Roadmap Gesundheitsforschung“ von 2007 wird die Komplementärmedizin im Kapitel ?Krebserkrankungen“ berücksichtigt. Es wird ernsthaft vorgeschlagen, sich damit zu befassen. In dem vermeintlichen Schwergewicht Gesundheitsforschungsprogramm findet sich kein Wort dazu. Man findet nicht einmal das Wort ?Behinderung“. Aber zu einem Gesundheitsforschungsprogramm gehört, wie ich finde, auch Gesundheitsforschung für Menschen mit Behinderung.
Das alles ist sehr enttäuschend. Sie hatten drei Jahre Zeit für das Gesundheitsforschungsprogramm, die Sie nicht genutzt haben. Wir als SPD hatten drei Wochen Zeit, als wir erfuhren, dass die Debatte sehr schnell auf die Tagesordnung gesetzt wird. Wir haben einen Antrag erarbeitet. Er mag nicht vollständig oder auch verbesserungswürdig sein; aber wir sagen ausdrücklich: Wir wollen Gesundheitsforschung, die von den Bedarfen der Menschen ausgeht.
Damit stehen wir nicht alleine. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen sieht das genauso. Die Frage ist: Was hat der Patient davon? Das gilt auch für die Forschung.
Wir wollen einen Aktionsplan Präventions- und Ernährungsforschung. Sie kündigen ihn seit Jahren an. Wir sagen: Legen Sie ihn endlich vor!
Wir wollen die Stärkung der Patientenautonomie, und wir wollen die klinische Forschung stärken. Was Sie eben an bereits existierenden Maßnahmen aufgeführt haben, Frau Schavan, ist doch auf eine Initiative der SPD zur Förderung nichtkommerzieller und klinischer Forschung zurückzuführen, die wir in guter Zusammenarbeit, Herr Kretschmer, gemeinsam in der Großen Koalition auf den Weg gebracht haben. Sonst wäre nichts passiert.
Wir wollen auch Gender- und Kinderaspekte einbeziehen. Das sind nur einige Beispiele aus unserem Antrag.
Sie wollen in den nächsten fünf Jahren 5,5 Milliarden Euro einsetzen. Auch darauf sind wir sehr gespannt. Wo sind eigentlich neue Mittel? Denn Sie zählen Forschungsmittel dazu, die längst bewilligt sind. Entscheidend ist aber nicht das Geld oder die Höhe der Summe, sondern die Frage: Was nutzt letzten Endes den Menschen? Dafür ist die Forschung da.
Das Gesundheitsforschungsprogramm erfüllt diesen Anspruch nicht. Bedienen Sie sich gerne aus unserem Antrag. Das tut den Menschen im Lande sicherlich gut.
Danke schön.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Ich erteile dem Kollegen Dr. Peter Röhlinger für die CDU/CSU-Fraktion, Entschuldigung: für die FDP-Fraktion, das Wort.
- Mögliche Fraktionswechsel sollten schon subjektive individuelle Entscheidungen bleiben. Sie werden nicht durch das Präsidium veranlasst. - Bitte schön, Herr Kollege.
Dr. Peter Röhlinger (FDP):
Herr Präsident, ich freue mich, dass wir in dieser fröhlichen Stunde auch ein fröhliches Wort übrig haben.
Ich begrüße Sie herzlich, Frau Ministerin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich widme mich im Folgenden dem von Ihnen genannten tatsächlichen Schwergewicht. Ich empfinde es als Veterinärmediziner und Bürger, der 40 Jahre lang das Gesundheitswesen der DDR kennengelernt hat, auch persönlich als eine große Freude, dass wir nun die Chance haben, der Spitze der europäischen medizinischen Forschung zu zeigen: Wir sind hier und wollen unseren Beitrag leisten.
Ich gehe davon aus, dass das Rahmenprogramm Gesundheitsforschung der Bundesregierung die strategische Ausrichtung der medizinischen Forschung für die kommenden Jahre darstellt. Es bildet die Grundlage für die Finanzierung medizinischer Forschung an Hochschulen, Universitätskliniken, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und in Unternehmen.
Die Bundesregierung ist einer der wichtigsten Akteure auf dem Gebiet der Gesundheitsforschung, denn sie finanziert anteilig Wissenschaftsorganisationen wie die Helmholtz-Gemeinschaft, die Leibniz-Gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft und die Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Sie unterhält Ressortforschungseinrichtungen, und sie fördert medizinische Forschungsprojekte. Daraus erwachsen Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei wird hoffentlich ein Großteil dessen, was Sie, Herr Röspel, angesprochen haben, integriert werden.
Wir haben als Parlamentarier Zeit, das zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ergänzen.
Dieses Programm setzt für die institutionelle Förderung und für die Projektförderung des BMBF einen gemeinsamen Rahmen und richtet beide Förderarten neu aus. Das Ziel ist, dass Forschungsergebnisse in Zukunft schneller aus der Grundlagenforschung und der klinischen Forschung in die medizinische Regelversorgung und damit zu den Patienten kommen. Dieser Prozess, der in der Vergangenheit manchmal Jahrzehnte gedauert hat, soll durch neue Strukturen und neue Formen der Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beschleunigt werden. Dafür sind - die Zahlen haben wir zum Teil schon gehört - für das Jahr 2011 insgesamt mehr als 1 Milliarde Euro in den Haushalt eingestellt, für den Zeitraum 2011 bis 2014 über 5,5 Milliarden Euro.
Die Laufzeit ist auf acht Jahre angelegt. Auf der Veranstaltung, die wir gestern gemeinsam besucht haben, hatte ich den Eindruck, dass wir überfraktionell, gerade was die Komplementärmedizin angeht, durchaus übereinstimmende Ansichten haben.
Die Tatsache, dass die Laufzeit auf acht Jahre angelegt ist, gibt uns die Möglichkeit, nicht im Raster von vier Jahren denken zu müssen, sondern in längeren Zeiträumen. Das sind wir den Bürgern schuldig, und dieser Zeithorizont macht uns Abgeordneten Hoffnung, in den nächsten Jahren etwas mehr Kraft zu investieren.
Die Patienten stehen - so geht es aus dem Text hervor - im Mittelpunkt. Partner der Regierung sind in erster Linie die Forschungseinrichtungen. Aber wir haben auch - darin unterscheiden wir uns vielleicht, Herr Röspel - ein ungestörtes Verhältnis zu den Unternehmen als Partner bei der Lösung außerordentlich komplizierter Vorhaben. Im Rahmenprogramm Gesundheitsforschung sind sechs Aktionsfelder definiert. Ich möchte an dieser Stelle nur auf einige eingehen, die mir besonders interessant erscheinen.
Zunächst geht es um die Erforschung von Volkskrankheiten. Diese Forschung wird gebündelt. Es werden sechs deutsche Zentren der Gesundheitsforschung gegründet. Diese Zentren sind so aufgestellt, dass eine neue Qualität der Zusammenarbeit in der Wissenschaft entstehen kann; das muss auch so sein. Erstmals werden hier universitäre und außeruniversitäre Einrichtungen mit ihren jeweils besten Forscherinnen und Forschern gleichberechtigt und gemeinsam wissenschaftliche Fragestellungen definieren und bearbeiten. Bei den Vorgesprächen zum Wissenschaftsfreiheitsgesetz ist mir ans Herz gelegt worden: Wir brauchen nicht mehr Geld, sondern neue Strukturen. Wir brauchen Kooperation, auch mit den Unternehmen.
Das ist ein neuer Aspekt, der sich in diesem Rahmenprogramm wiederfindet.
Das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, zum Beispiel Parkinson, Demenz und Alzheimer, und das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung sind bereits gegründet.
Vier weitere Zentren werden eingerichtet, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu Krebs, zu Infektions- und zu Lungenkrankheiten. Hier werden sicherlich - darüber sind wir uns alle einig - die Kliniken und Einrichtungen mit großem Interesse dabei sein. Sie werden sich fragen: Sind wir dabei, oder gehören wir zu den Einrichtungen, die aus diesen oder jenen Gründen nicht einbezogen werden? - Da können wir uns auf schwierige Diskussionen gefasst machen. Frau Ministerin, Sie plädierten für eine gute Zusammenarbeit mit den Ländern. Ich sehe da durchaus Spannungsfelder. Aber auch dafür sind wir da. Sonst würden das andere schon längst gemacht haben.
Beim Aktionsfeld 2 geht es um die Forschungsherausforderung. Das Stichwort heißt individualisierte Medizin. Dieses Aktionsfeld ist der ganzheitlichen Behandlung gewidmet; denn durch die großen Fortschritte der medizinischen Forschung in den vergangenen Jahren ist das Verständnis der grundlegenden Krankheitsmechanismen inzwischen stark gewachsen. Dabei ist deutlich geworden, dass individuelle Unterschiede, zum Beispiel Alter, Geschlecht, sozialer Hintergrund und genetische Disposition, eine große Rolle spielen. Die Erforschung dieser Aspekte muss forciert werden, um Diagnose und Therapie künftig stärker als heute auch auf individuelle Bedürfnisse und Voraussetzungen einzelner Menschen oder einzelner Gruppen von Menschen auszurichten.
Mir sagen die Chefs in Heidelberg und in anderen Orten: Wenn die Patienten künftig mit ihrem Chip zum Arzt oder in die Klinik kommen und eine Fülle von Informationen mitbringen, dann kann der Mediziner Kosten auf dem einen oder anderen Gebiet vermeiden, weil er sehr speziell reagieren und auf die Anwendung von diesem oder jenem Diagnostikum oder Therapeutikum verzichten kann.
Die Bundesregierung unterstützt die Entwicklung von Diagnostika und Therapeutika und spannt in der Förderung den Bogen entlang des Innovationsprozesses von der lebenswissenschaftlichen Grundlagenforschung über die präklinische und klinisch-patientenorientierte Forschung bis zur Marktreife. Der Übergang von einer Stufe des Innovationsprozesses zur nächsten wird erleichtert. Die Erforschung seltener Krankheiten wird ebenso besonders intensiv gefördert.
Die Präventions- und die Ernährungsforschung liefern Erkenntnisse über den Einfluss von Ernährung und Bewegung. Das betrifft speziell unsere Berufsgruppe;
denn die Bewegungsarmut betrifft uns alle, die wir hier sitzen.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege.
Dr. Peter Röhlinger (FDP):
Man sieht, das Ministerium denkt auch an uns, obwohl man sagt: Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt. - In diesem Fall haben Sie, Frau Ministerin, auch dieses Tabu gebrochen.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege, wenn Sie gelegentlich an die Redezeit dächten, würde uns das auch wieder mehr Bewegung am Rednerpult ermöglichen.
Dr. Peter Röhlinger (FDP):
Ich nähere mich dem Ende.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das wollen wir nicht hoffen, aber die Redezeit geht zu Ende, Herr Kollege Röhlinger.
Dr. Peter Röhlinger (FDP):
Ich möchte zum Schluss auf die neuen Strukturen in der internationalen Kooperation und auf die Zusammenarbeit mit dem BMZ verweisen.
Herzlichen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Ich erteile nun das Wort der Kollegin Petra Sitte für die Fraktion Die Linke.
Dr. Petra Sitte (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Sich um die Gesundheit der Bevölkerung zu sorgen, gehört wohl zu den höchsten Ansprüchen einer Gesellschaft. Diese Aufgabe bedarf, soll sie auch nur annähernd gerecht für die Menschen erfüllt werden, eines zutiefst solidarischen Ansatzes. Herr Röspel hat schon gesagt, dass von den Menschen aus gedacht werden soll.
Für diesen Ansatz bedeutet das, dass das Gesundheitsforschungsprogramm nicht mehr nur in den Grenzen von Nationalstaaten verfolgt werden kann, und für diesen Ansatz bedeutet das, dass die Grenzen zwischen fachwissenschaftlichen Disziplinen überschritten werden müssen.
Was heißt das jetzt aus der Sicht der Linken? Ein modernes Gesundheitsforschungsprogramm muss zwangsläufig seinen Horizont erweitern. Deshalb ist uns besonders wichtig, dass soziale, kulturelle, soziologische, demografische, aber auch ökologische Faktoren einzubeziehen sind, weil auch diese die Gesundheit maßgeblich beeinflussen.
Im Zentrum des Gesundheitsforschungsprogramms sollen nun so große Volkskrankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel-, Infektions-, Lungen- oder neurodegenerative Erkrankungen stehen. Der Anstieg bei diesen Erkrankungen und die Dramatik ihres Verlaufs werden, wie zwischenzeitlich belegt, eindeutig auch durch unsere Lebensweise geprägt. Daher müssen in neuer Qualität auch Präventions- und Versorgungsforschung in das Konzept integriert werden. Die Linke hat an dieser Stelle wiederholt kritisiert, dass Gesundheitsforschung in dieser Bundesregierung viel zu sehr auf Pharmaentwicklung, Biotechnologie und Medizintechnik verengt ist.
Tatsächlich hätte die Bundesregierung längst weiter sein können. Herr Röspel hat es schon zu Recht gesagt: Immerhin lagen mit dem damaligen als - neudeutsch - ?Roadmap für die Gesundheitsforschung“ bezeichneten Konzept der schwarz-roten Koalition von 2007 viele deutlich konkretere Vorschläge auf dem Tisch. Aber offensichtlich ist die schwarz-gelbe Gemeinschaftspraxis tapfer entschlossen, ihre konzeptionelle Blutarmut ohne rote Helferzellen zu überstehen.
Also muss das Parlament die konkrete strukturelle und finanzielle Umsetzung der angekündigten Initiativen kontrollieren und mit eigenen Vorschlägen bereichern. Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie uns bereits in den Haushaltsberatungen Auskunft darüber gibt, in welchem Verhältnis die einzelnen Aktionsfelder zueinander stehen und wie sie jeweils finanziell unterlegt werden.
Die Erforschung großer Volkskrankheiten ist wahrlich eine Mammutaufgabe, an die sich hohe Erwartungen richten. Das alles ist nicht ohne verlässliche Strukturen, ohne neue bundesweite Vernetzungen und Kooperationen zu schaffen. Also macht die Bildung von Zentren für Gesundheitsforschung unter dem Dach der starken Helmholtz-Gemeinschaft durchaus Sinn. Wenn jedoch die Universitätsklinika in Augenhöhe mitwirken sollen, dann müssen sich Bund und Länder darüber verständigen, wie der chronischen Unterfinanzierung der Universitätsmedizin begegnet werden kann.
Ansonsten können die Klinika ihre Chance, endlich wieder stärker in öffentlich geförderte, nicht kommerzielle Forschung einzusteigen, kaum befriedigend wahrnehmen. Insofern hatten Sie in Ihrer Rede recht. Das Ganze muss jetzt aber auch verbindlich festgehalten werden.
Eine unabhängige klinische Forschung kann dem Wissen über Therapien entscheidende Impulse geben; das wissen wir. Mithin wird die Möglichkeit, eigene Forschungsvorhaben zu verfolgen, auch für wissenschaftlichen Nachwuchs attraktiv. Deshalb betrachte ich es als Fortschritt, dass Nachwuchsfragen in jedem Themengebiet des Programms eine Rolle spielen. Allerdings müssen Sie jetzt nachlegen und verlässliche Perspektiven konzipieren.
Gesundheitsprobleme können, wie ich schon eingangs gesagt habe, nicht mehr nationalstaatlich gelöst werden; sie tragen globalen Charakter. Wer heute meint, dass die wohlhabenden Staaten von den Krankheiten der sogenannten armen Länder verschont bleiben, verkennt den Ernst der Lage. Die Linke sagt: Wir tragen eine hohe Verantwortung dafür, dass Krankheiten, die mit Armut einhergehen, wie HIV, Malaria, Tbc oder tropische Krankheiten, ausgerottet werden können.
Die Pharmaindustrie ihrerseits ignoriert nämlich erfahrungsgemäß die dramatischen Folgen, weil in den armen Ländern auf sie keine kaufkräftigen Kunden warten. Es ist eine Bankrotterklärung der reichen Staaten, dass die Millenniumsziele der Vereinten Nationen nicht erreicht worden sind.
Nicht genug damit, dass so viele Menschen wie nie hungern, nämlich über 1 Milliarde: Nein, sie sind infolgedessen auch noch dramatisch geschwächt und fast wehrlos gegen Krankheiten. So stehen wir weltweit vor verschärften armutsbedingten medizinischen Großproblemen und damit einhergehenden gesellschaftlichen Konflikten. Krasses Beispiel etwa sind multiresistente Tuberkulosekeime, die sich in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion entwickelt haben und die sich nunmehr über ganz Europa ausbreiten.
Deutschland bezeichnet sich immer wieder gern als ?Apotheke der Welt“. Angesichts dessen, was ich gerade gesagt habe, kann ich nur feststellen: Dieser Satz ist falsch. Wenn überhaupt, dann sind wir Apotheke höchstens für den reicheren Teil der Welt. Unter den Fördernationen findet sich Deutschland als eines der reichsten Länder nämlich nur auf Platz 20. Das ist völlig inakzeptabel!
Lediglich 20 Millionen Euro für sogenannte Produktentwicklungspartnerschaften zwischen Industrie und Forschern stehen beispielsweise 800 Millionen Euro gegenüber, die im Rahmen der Pharmainitiative in den letzten Jahren ausgegeben wurden. Das müssen wir ändern.
Meine Damen und Herren, das Gesundheitsforschungsprogramm bietet uns durchaus auch auf diesem Feld eine Chance, die hohe Kompetenz wissenschaftlicher Einrichtungen tatsächlich in den Dienst dieser Gesellschaft wie auch der Weltgemeinschaft zu stellen. Packen wir es endlich an!
Danke schön.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält nun die Kollegin Krista Sager vom Bündnis 90/Die Grünen.
Krista Sager (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Bundesregierung hat in ihrem nationalen Rahmenprogramm zur Gesundheitsforschung die Präventionsforschung, die Versorgungsforschung und auch die globale Herausforderung mit einem Schwerpunkt auf vernachlässigte und armutsbedingte Krankheiten aufgegriffen und zu eigenen Aktionsfeldern gemacht. Das bewerten wir erst einmal durchaus positiv. Ich sage aber auch: Wenn man sich die finanzielle Gewichtung anschaut, kann man in der Tat nur von allerersten Schritten sprechen. Da müssen mit Sicherheit weitere Schritte folgen.
Die Bedeutung der Präventionsforschung wird besonders durch den demografischen Wandel unterstrichen. Wir müssen junge Menschen vor Erkrankung schützen, wir müssen ältere Menschen länger gesund und aktiv erhalten. Ein wichtiges Thema für die Präventionsforschung ist aber auch die soziale Spaltung im Präventionsbereich. Prävention darf nicht nur die gebildete Mittelschicht erreichen, sondern sie muss auch Kinder aus armen Familien und Menschen, für die gesunde Ernährung nicht alltäglich ist, erreichen.
Deswegen muss die interdisziplinäre und kooperative Präventionsforschung ganz besonders verstärkt werden.
In einer alternden Gesellschaft gibt es aber auch immer mehr Menschen mit chronischen Erkrankungen, deren Leid gemildert und deren Lebensqualität erhalten werden muss. Gesundheitsforschung muss deswegen auf die Erforschung chronischer Erkrankungen einen Schwerpunkt legen. Auch die Schmerz- und die Pflegeforschung müssen verstärkt werden. Frau Schavan, ich finde, dass in einem nationalen Gesundheitsforschungsprogramm die Pflegewissenschaften einen sehr viel stärkeren Stellenwert brauchen, als das in Ihrem Programm der Fall ist,
und zwar nicht nur hinsichtlich der wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern auch, was die akademische Professionalisierung des Fachkräftepotenzials angeht.
Die Stärkung der Versorgungsforschung war - gerade vor dem Hintergrund begrenzter finanzieller Möglichkeiten - für uns immer ein besonders wichtiges Anliegen. Der medizinische Fortschritt muss auch bei denen ankommen, die es am nötigsten haben und bei denen er am meisten bewirkt - nicht nur bei denen, die es sich leisten können. Deswegen ist gerade die Stärkung der Versorgungsforschung unter dem Gesichtspunkt von Gerechtigkeit, aber auch unter dem Gesichtspunkt von Qualität und Effizienz für uns Grüne ein ganz besonderes Anliegen.
Männer und Frauen werden in unserem System unterschiedlich unterversorgt und überversorgt. Man muss sich da nur die Herzkrankheiten und die psychischen Krankheiten anschauen. Zum Teil kommen Medikamente auf den Markt, die nur an männlichen Probanden getestet worden sind. Deswegen muss die Bundesregierung dafür sorgen, dass genderspezifische Aspekte in die Gesundheitsforschung systematischer integriert werden, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Wir begrüßen - auch Frau Sitte hat das angesprochen -, dass die Bundesregierung jetzt mehr gegen armutsbedingte Krankheiten tun will. Das ist in der Tat nicht nur ein Thema, das Solidarität und globale Verantwortung betrifft, es hat auch etwas mit Selbstschutz zu tun. Resistente Formen der Tuberkulose können auch ganz schnell bei uns ankommen.
Bei den geförderten Produktentwicklungspartnerschaften muss jetzt dafür gesorgt werden, dass die Kriterien für Lizenzierung und Erfolg transparent entwickelt werden. Unsere Entwicklungspolitiker werden ganz besonders darauf achten, dass dabei in Zukunft in Zusammenarbeit mit den NGOs Fortschritte erzielt werden.
Der größte Teil der Mittel aus diesem Rahmenprogramm geht in die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung. Ich sage ausdrücklich: Fokussierung auf die großen Volkskrankheiten und Bündelung von Kräften und Ressourcen zur Erforschung der großen Volkskrankheiten finden wir im Prinzip richtig. Zur Erreichung des Ziels der schnelleren Translation, also der schnelleren Überführung der medizinischen Forschungsergebnisse in die klinische Praxis bzw. in die Patientenbehandlung, müssen aber eigentlich die Universitätskliniken ins Zentrum gerückt werden. Warum? Die medizinische Forschung braucht unbedingt die Nähe zu den Patientinnen und Patienten. Sie braucht die Nähe zur klinischen Erfahrung. Sie braucht die Überprüfung ihrer eigenen Erwartung in der klinischen Praxis. Sie braucht aber auch die Nähe zum ärztlichen Nachwuchs; denn wir müssen gerade die jungen Ärzte auch für die medizinische Forschung und für die Kooperation mit der medizinischen Forschung interessieren und gewinnen. Das heißt, wenn man Translation als Ziel ernst nimmt, dann müssen Herzstück und Schnittstelle der Deutschen Zentren eigentlich die Universitätskliniken sein.
Was ist aber passiert? Wir sind wieder von den Besonderheiten der föderalen Forschungsförderung eingeholt worden. 90 Prozent der Mittel sollen vom Bund kommen. Also wurden, um die Länder im Boot zu halten, die Helmholtz-Zentren in die Mitte gerückt; sie wurden als Partner gesetzt. Sie mussten sich im Gegensatz zu den Universitäten dazu keinem qualitativen Wettbewerb stellen. Sie sind von vornherein privilegiert, weil sie Geförderte und Förderer zugleich sind. Es ist kein Wunder, dass der Verband der Universitätskliniken, der Medizinische Fakultätentag und die Hochschulrektorenkonferenz protestiert haben. Durch ihren Protest und durch ihren Druck gibt es jetzt verschiedene Zentrenmodelle und eine Entwicklung in Richtung einer Netzwerkstruktur.
Damit sind aber nicht alle Probleme und Ängste beseitigt. Werden die Helmholtz-Zentren forschende junge Ärzte, Publikationen und Drittmitteleinwerbung aus den Universitätskliniken und aus den Unis zu sich herüberziehen? Werden die Länder Komplementärmittel, die sie jetzt brauchen, bei der Grundfinanzierung der Unikliniken abziehen? Das alles sind offene Fragen. Die Frage ?Wird es Kooperation auf Augenhöhe geben?“ ist bisher nicht beantwortet.
Ich finde es nicht unproblematisch, so viel Geld auf Dauer in eine Struktur hineinzustecken, die bisher noch so wenig erprobt ist. Wir brauchen ganz dringend nicht nur eine Evaluation der Ergebnisse, sondern beizeiten auch eine Evaluation der Strukturen sowie der Folgen und Risiken dieser Strukturen, bevor wir auf Dauer so viel Geld in diese stecken. Das ist eine Sache, zu der ich von Ihnen, Frau Schavan, eine Zusage erwarte, und das erwarten auch die Universitätskliniken von Ihnen.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Der Kollege Michael Kretschmer erhält als Nächster das Wort für die CDU/CSU-Fraktion.
Michael Kretschmer (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Über 5,5 Milliarden Euro, nahezu 6 Milliarden Euro, wird der Bund zwischen 2011 und 2014 für die Gesundheitsforschung ausgeben. Über nicht weniger Geld sprechen wir heute. Das ist ein gewaltiger Kraftakt. Das macht klar, welche Bedeutung wir der Medizin und der Gesundheitsforschung beimessen. Es ist nicht weniger als knapp die Hälfte des Geldes, das das Bundesministerium für Bildung und Forschung jährlich als Etat zur Verfügung hat. Es ist ein gewaltiger Kraftakt und, wie ich finde, ein deutliches Zeichen in die richtige Richtung.
Es reicht in diesem Zusammenhang nicht, über Geld zu sprechen; wir müssen auch über Strukturen und über Qualität sprechen. Ganz wichtig ist, auch im Hinblick auf das 8. Forschungsrahmenprogramm und andere Diskussionen, die derzeit laufen: In der Forschung muss es zuallererst um Exzellenz gehen. Es ist alles nichts ohne Exzellenz.
Diese Erkenntnis hatte vor Jahren auch schon eine andere Bundesforschungsministerin. Sie hatte festgestellt, dass Deutschland bei der klinischen Forschung weit zurück lag, und deswegen versucht, mit Zentren für klinische Studien und ähnlichen Dingen die Qualität zu heben. Vieles davon ist gut gelungen. Deswegen empfinde ich nicht alle Reden, die wir heute gehört haben, als zielführend. Wir können nämlich gemeinsam auf das stolz sein, was wir auf den Weg gebracht haben.
Wir haben heute gehört, das Programm sei zu nahe an der Umsetzung, zu nahe an den Unternehmen, die später die Medikamente herstellen. Das ist erstens falsch, und zweitens widerspricht der Vorwurf dem, was die SPD, als sie in der Regierung war, einmal selber mit vorangetrieben hat.
Translation ist ein ganz zentrales Thema in der Gesundheitsforschung. Was nutzt es uns, wenn wir im Labor, im Forschungsinstitut die größten Dinge erforschen und Fortschritte erzielen, wenn die Ergebnisse nicht umgesetzt werden, nicht zum Patienten kommen? Es ist richtig, so wie es hier angelegt ist: Translation, also die Überführung des Wissens in die klinische Anwendung, muss zentrales Thema eines jeden Gesundheitsforschungsprogramms sein.
Wenn Sie die Menschen fragen, was Allensbach und andere Forschungseinrichtungen ab und an machen, was sie sich von der Forschung am meisten wünschen und was die wichtigsten Themen sind, dann wird das Thema Gesundheit genannt. Der Grund ist ihre Sorge um die schweren Krankheiten Demenz oder Krebs. Deswegen glaube ich, dass wir mit diesem Programm vollkommen richtig liegen. Die großen Volkskrankheiten und die Seuchen der Gegenwart gehen wir an. Wir versuchen, dies in Zusammenarbeit mit den Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung mit einer neuen Struktur zu bewältigen.
Dabei hat das Parlament einen deutlichen eigenen Akzent gesetzt, indem es neben den Zentren für Krebs, Diabetes, Neurodegeneration und Infektion zwei weitere Einheiten errichten will. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestags haben gesagt: Wir wollen, dass die Erkrankungen von Herz und Kreislauf sowie der Lunge auch in diesen Zentren ein Thema sind. Jetzt ist dies auf dem Weg. Ich finde, die Kritik ist an den Haaren herbeigezogen, und sie ist auch ein bisschen verletzend.
Die Helmholtz-Gemeinschaft ist eine der größten deutschen Wissenschaftsorganisationen. Sie hat eine große Exzellenz und ist international anerkannt. Wir haben sie damit beauftragt, diese Deutschen Zentren zu organisieren. Natürlich gibt es einen Wettbewerb bei den Projekten, die in den Deutschen Zentren verfolgt werden. Dabei muss sich auch eine Gruppe, die in der Helmholtz-Gemeinschaft mitarbeitet, im Rahmen dieses Wettbewerbs bewerben. So ist es auch passiert. Wir haben im Übrigen eine große Gemeinsamkeit zwischen Klinikern und außeruniversitären Forschern. Man sollte nicht versuchen, diese durch eine kleinteilige Diskussion in diesem Bereich kaputtzumachen.
Ich will die Frage aufwerfen, wie es sich mit den Bundesländern, denen die Kliniken gehören, der Hochschulmedizin und der außeruniversitären Forschung verhält. Ich glaube, wir haben auch hier in den vergangenen Jahren deutliche Maßnahmen ergriffen, um zu helfen. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass wir die Universitätskliniken nicht übernehmen sollten. Das würde völlig an der Sache vorbeigehen.
Wir haben die für Forschung und Entwicklung zur Verfügung stehenden Mittel deutlich erhöht. Wir haben versucht, mit den Zentren für klinische Forschung die Qualität zu erhöhen. Dies ist uns in großen Teilen gelungen. Zuletzt haben wir in der Frage von Programmpauschalen und der Overheadfinanzierung - es werden in Zukunft 20 Prozent sein - dafür gesorgt, dass diejenigen, die wirklich gut sind und sich im Wettbewerb bewähren, am Ende keine Probleme bekommen, weil dies zulasten ihrer Gemeinkostenfinanzierung geht. Nein, meine Damen und Herren, wir haben die Strukturen geändert. Wir haben dies so gemacht, dass Wettbewerb stattfindet und dass am Ende wirklich die Besten erfolgreich sein können, sodass es am Ende in Gänze zu einer Erhöhung von Exzellenz und Qualität kommt. Ich glaube, der Weg ist richtig.
Es ist die Frage angesprochen worden, ob alle Themen richtig bearbeitet worden sind und ob man sich nicht noch mehr vorstellen könnte. Man kann sich immer mehr vorstellen. Aber auch die Mittel der Bundesrepublik Deutschland und dieses Ministeriums, das einen hohen Etat hat, sind begrenzt. Deswegen ist erstens die Konzentration auf die großen Volkskrankheiten wichtig. Zweitens kommen eine Missionsorientierung und eine Methodenorientierung hinzu. Ich denke, es ist ein großer Schritt, dass wir Qualität in der Breite und Vergleichbarkeit organisieren und neben der klinischen Studie die präklinische Phase und am Ende auch die Markteinführung mit bedenken. Das heißt, vom Menschen her zu denken. Das heißt, den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen. Ich finde die Kritik, die hier geäußert worden ist, völlig falsch. Sie ist in der Sache absolut daneben.
Der Kollege Röspel hat einen Antrag angesprochen, den wir in der vergangenen Legislaturperiode gemeinsam gefertigt haben. Ich finde, das ist ein großartiges Werk.
- Es gab eine gute Zusammenarbeit und kluge Ideen. - Vieles von dem realisieren wir jetzt, weil die frühere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt die Ideen einfach nicht umgesetzt hat. Das gehört zur Wahrheit dazu.
Ich glaube, mit dem jetzigen Gesundheitsminister haben wir jemanden, der die Dinge mit uns gemeinsam voranbringen will.
Ich finde, die Ministerin hat vollkommen recht, wenn sie sagt, dieses Thema sollte zu Gemeinsamkeit führen. Wir sollten gemeinsam für die Gesundheit in diesem Land arbeiten. Die Menschen haben so große Hoffnungen, und wir können in diesem Bereich wirklich so viel gemeinsam bewegen: Lassen Sie uns nicht über Kleinigkeiten reden und parteitaktisch das Ganze betrachten, sondern stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt und tun wir etwas für die Gesundheit in diesem Land!
Wir haben gemeinsam die Möglichkeit.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Carola Reimann für die SPD-Fraktion.
Dr. Carola Reimann (SPD):
Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Wohl kaum ein Bereich ist so komplex und solch starken Veränderungen unterworfen wie unser Gesundheitssystem. Die aus dem demografischen Wandel, der hier schon angesprochen worden ist, resultierende Notwendigkeit der Versorgung älterer und multimorbider Patientinnen und Patienten erfordert fortlaufend Anpassungen und in vielen Bereichen auch mutige Strukturreformen.
Auch wenn unser Gesundheitssystem zweifelsohne zu einem der besten der Welt gehört, stehen wir doch vor großen Herausforderungen, denen wir uns auch stellen müssen. Vieles in unserem System ist nach wie vor zu unkoordiniert, zu intransparent und viel zu wenig am Patienten orientiert.
Das führt im Übrigen nicht nur zu unnötigen zusätzlichen Kosten, sondern hat auch Einfluss auf die Qualität der Versorgung von Millionen von Versicherten. Allein im Bereich der Versorgung sind noch ganz viele Fragen ungeklärt: Wie überwinden wir das isolierte Nebeneinander verschiedener Institutionen? Wie schaffen wir eine stärkere Patientenorientierung bei den Versorgungsabläufen? Wie entwickeln wir neue Versorgungsformen, und wie beschleunigen wir deren Einführung dann in der Praxis?
Angesichts der demografischen Entwicklung und der vielen offenen Fragen nicht nur im Bereich der Versorgung, sondern auch in anderen Teilbereichen des Gesundheitssystems bedarf es eines breit aufgestellten, gut vernetzten Gesundheitsforschungsbereichs in Deutschland. Grundsätzlich begrüßen wir es daher sehr, dass sich die Bundesregierung dieses Themas annimmt.
Wirft man nun aber einen Blick in das von Ihnen vorgelegte Rahmenprogramm Gesundheitsforschung, so stellt man leider fest, dass es der herausragenden Bedeutung der Gesundheitsforschung und damit dem selbst gestellten Anspruch nicht gerecht wird.
Wer gehofft hat, dass die ständigen Verschiebungen und Überarbeitungen letztlich genutzt wurden, um hier ein Programm mit Substanz vorzulegen, der wurde enttäuscht.
Ihr Papier bleibt in überwiegenden Teilen abstrakt, vage, unbestimmt. Weitgehend richtigen Problemdarstellungen folgen leider keine konkreten Lösungsansätze, keine klaren konkreten Maßnahmen und auch keine konkreten Forschungsprojekte.
Besonders enttäuschend finde ich, dass das Rahmenprogramm einem Hauptproblem der Gesundheitsforschung, nämlich der nach wie vor viel zu geringen Patientenorientierung, viel zu wenig Beachtung schenkt. Auch der Kollege Röspel hat das schon ausgeführt. Das finde ich sehr bedauerlich.
Kolleginnen und Kollegen, damit hier kein Zweifel aufkommt: Wir brauchen eine starke Gesundheitswirtschaft im Bereich der Pharmaindustrie genauso wie in der Medizintechnik und der Telemedizin.
Öffentlich geförderte Gesundheitsforschung muss sich aber immer an den Hilfebedürftigen und an den Kranken orientieren.
Die Fragen, die im Rahmenprogramm gestellt werden müssen, dürfen nicht lauten: ?Wie können wir der pharmazeutischen Industrie am besten helfen?“, oder: ?Wie können wir wissenschaftliche Erkenntnisse schneller ökonomisch verwerten?“, sondern die Fragen müssen lauten: ?Was hat der Patient davon?“, und: ?Wie können wir mit den neuen Erkenntnissen Patienten besser, umfassender und systematischer versorgen?“. Das muss der Leitgedanke eines Gesundheitsforschungsprogramms sein.
Liebe Ministerin, wären Sie diesem Gedanken gefolgt - Sie haben heute Morgen noch einmal betont, dass Sie den Weg zum Patienten kürzer machen wollen -, dann hätten Sie sich stärker mit der Gesundheitsforschung und den eingangs gestellten Fragen befasst. Gesundheitsforschung und Versorgungsforschung sind enthalten, aber deren Anteil ist eigentlich marginal. Die gegenwärtige Gesundheitsforschung konzentriert sich schwerpunktmäßig immer noch zu sehr an medizinischen Produkten; viel zu wenig sind die Prozesse, die Behandlungsketten und die Abläufe bei der Therapie des Patienten im Blick. Dazu, wie Sie diesem Problem konkret begegnen wollen, findet sich im Papier gar nichts.
Ebenso wenig befasst sich das Programm mit der Frage der Stärkung der Patientenautonomie in einem immer komplexer werdenden Gesundheitssystem. Bei einer gleichzeitig älter werdenden Gesellschaft ist das eine der ganz großen Herausforderungen.
Wirtschaftsminister - Pardon! - Gesundheitsminister Rösler
- da hat die Berichterstattung der vergangenen Tage Wirkung gezeigt - spricht ja gerne vom mündigen, eigenverantwortlichen Patienten. Bislang beschränkte sich das bei Schwarz-Gelb allerdings auf finanzielle Eigenverantwortung in Form von Zusatzbeiträgen und Kostenerstattungen. Wenn Sie es mit dem mündigen Patienten wirklich ernst meinen würden, dann würden sich in diesem Programm Möglichkeiten zur Stärkung der Patientenautonomie wiederfinden. Aber auch hier leider Fehlanzeige.
Eines der sechs Aktionsfelder im Rahmenprogramm Gesundheitsforschung befasst sich mit Präventions- und Ernährungsforschung. Das ist ohne Frage zu begrüßen; denn gerade im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung und der Zunahme chronischer Erkrankungen wird die Bedeutung der Prävention weiter zunehmen. Doch auch hier geht das Rahmenprogramm nicht über Altbekanntes und Bewährtes hinaus.
Seit Jahren diskutieren wir im Rahmen des von uns immer wieder geforderten Präventionsgesetzes über die Orientierung an den Lebensverhältnissen.
Bislang werden mit gängigen Präventionsangeboten genau diejenigen nicht erreicht, die wir aber vor allem erreichen müssen. Lieber Kollege Röhlinger, damit sind nicht sich schlecht ernährende und bewegungsarme Abgeordnete gemeint,
sondern Menschen mit niedrigem Einkommen, mit niedrigem Bildungsstand und Migrationshintergrund.
All diese Menschen haben schlechtere Gesundheitschancen in unserem Land.
Die Erforschung und Bekämpfung ungleicher Gesundheitschancen in Deutschland gehört mit zu den größten Herausforderungen, vor denen wir in der Gesundheitsversorgung stehen.
Auch hier schweigt die Bundesregierung; denn dazu findet sich nichts im Rahmenprogramm Gesundheitsforschung. Allein das zeigt schon, dass dieses Programm von der Versorgungsrealität weit entfernt ist und sich nicht an dem Bedarf der Betroffenen orientiert. Hier müssen Sie dringend nachbessern, wenn Sie den Kampf gegen ungleiche Gesundheitschancen in unserem Land wirklich ernst nehmen.
Das von Ihnen vorgelegte Rahmenprogramm ist ein Papier der schönen Worte, ein Papier des kleinsten gemeinsamen Nenners, auf den sich BMBF und BMG gerade noch haben einigen können. Es bleibt deutlich - auch das wurde hier schon angesprochen - hinter der bereits 2007 vorgelegten Roadmap zurück, die wesentlich klarer, konkreter und substanzieller war. Da wurde im Zusammenhang mit der Definition des Begriffs ?Gesundheitsforschung“ sehr klar ausgeführt:
Erkenntnisse der Grundlagenforschung sollen für das ärztliche Handeln nutzbar gemacht werden und - umgekehrt - Beobachtungen und Fragen aus der Versorgungspraxis in die Grundlagenforschung eingebracht werden.
Da wurde also an prominenter Stelle die Frage angesprochen, was Gesundheitsforschung eigentlich leisten soll. Das vermisse ich jetzt.
Dass das, was hier jetzt vorgelegt wurde, etwas mager ist, müssen Sie inzwischen wohl selbst gemerkt haben. Wenn man sich anstatt der Hochglanzbroschüre die entsprechende Bundestagsdrucksache ansieht, dann erkennt man, dass nach 18 Seiten schöner Worte und Situationsbeschreibung darauf hingewiesen wird, dass das Programm in den kommenden Jahren natürlich ausgefüllt und konkretisiert werden muss. Ja, in der Tat, hier muss noch einiges ausgefüllt, konkretisiert und überarbeitet werden, damit Ihr Programm der Bedeutung der Gesundheitsforschung und der Versorgungsrealität gerecht wird.
Wenn Sie Ideen brauchen, dann empfehle ich die Lektüre unseres Antrags.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Frau Kollegin!
Dr. Carola Reimann (SPD):
Ich komme zum Schluss. - Er zeigt, welche Impulse für eine bessere Gesundheitsforschung im Sinne der Patientinnen und Patienten gegeben werden müssen. Wir wollen, dass das Programm die Versorgungsrealität aufgreift und Projekte für die Versorgung entwickelt. Erst dann ist es wirklich ein Gesundheitsforschungsprogramm, von dem auch Patientinnen und Patienten profitieren, und nicht einfach nur ein Programm, das den Titel tragen könnte: Grundlagenforschung in der Medizin unter besonderer Berücksichtigung von Volkskrankheiten.
Danke.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf der Ehrentribüne hat der Parlamentspräsident der Hellenischen Republik, Herr Philippos Petsalnikos, mit seiner Delegation Platz genommen.
Ich begrüße Sie, Herr Präsident, herzlich im Namen aller Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, von denen Sie einige bei Ihren Gesprächen gestern bereits kennengelernt haben.
Es ist uns, Herr Präsident, eine große Freude, dass Sie und Ihre Delegation gerade in diesen Tagen Deutschland besuchen. Ihr offizieller Besuch in Berlin findet auf den Tag genau 70 Jahre nach dem Einmarsch von Truppen der damaligen deutschen Wehrmacht in Griechenland statt, die am 6. April 1941, von Bulgarien kommend, die griechische Grenze überschritten haben. Wir sind uns sehr bewusst, dass die darauf folgenden vier Jahre der deutschen Besatzung Griechenlands in Ihrem Volk tiefe Wunden hinterlassen haben. Umso dankbarer sind wir dafür, dass seit dieser Zeit so viele Griechen - unbeschadet des persönlichen Leids, das sie erfahren haben - Deutschen versöhnlich entgegengekommen sind und damit die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass wir die traditionell gute, enge freundschaftliche Verbindung zwischen unseren Ländern haben wiederherstellen können. Seien Sie uns ganz herzlich willkommen.
Ich will gerne hinzufügen, dass wir im Deutschen Bundestag - übrigens auch aus eigenem Interesse - mit besonderer Intensität, aber auch mit hohem Respekt die beachtlichen politischen und ökonomischen Kraftanstrengungen verfolgen, die Sie zur Stabilisierung des griechischen Staatshaushalts und zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Volkswirtschaft in den vergangenen Monaten unternommen haben. Wir wünschen Ihnen dafür viel Erfolg.
Die Debatte wird fortgesetzt mit Ulrike Flach, die für die FDP-Fraktion das Wort erhält.
Ulrike Flach (FDP):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das heute vorliegende Rahmenprogramm Gesundheitsforschung baut - das wissen wir alle - auf Programmen der Vergangenheit auf. Aber es arbeitet mit einem Volumen von 5,5 Milliarden Euro, einer Summe, die, Frau Ministerin, in der Vergangenheit noch nie in Forschung und Innovation hineingegeben worden ist. Ich bin froh und glücklich, dass die Koalition die Kraft gehabt hat, dies auch haushalterisch umzusetzen.
Aber es ist mehr als ein Forschungsprogramm. Die Ansätze dieses Programms gehen nicht nur fiskalisch über die Ansätze der Vergangenheit hinaus, sondern mit ihnen werden heute neben den Gesundheitszentren vor allem mit den Bereichen Versorgungsforschung und individualisierte Medizin auch neue, sehr patientenorientierte Wege beschritten. Wir wollen, liebe Kollegen, blühende Forschungslandschaften; denn wir wissen, dass die Zukunft unseres Hightechlandes natürlich von Innovation abhängt. Aber wir wollen diese Innovationen auch ganz bewusst aus Sicht der Patienten.
Zu Recht weist zum Beispiel der Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, Professor Windeler, darauf hin - das möchte ich den Kollegen von der SPD an dieser Stelle einfach einmal ins Stammbuch schreiben -:
In Deutschland stehen Grundlagenforschung, klinische Forschung und Versorgungsforschung in einem Missverhältnis. … Aber diejenigen, die Innovationen entwickeln, kümmern sich zu wenig darum, wie sie in der Versorgung untergebracht werden können.
So Windeler über die Vergangenheit unter Ulla Schmidt und eine SPD-betonte Gesundheitspolitik.
Innovationen an sich seien kein medizinischer Wert, betonte er.
Als wir Ende des letzten Jahres das neue Arzneimittelgesetz auf den Weg brachten, sind wir genau diesem Gedanken gefolgt. Entscheidend ist der medizinische Nutzen von Arzneimitteln, und damit lautet die zentrale Frage, die natürlich auch den heutigen Tag mit Blick auf die Gesundheitsforschung bestimmt: Was hat der Patient von dem, was wir hier machen?
Deswegen sind vergleichende Studien so wichtig. Nicht alles, was als Innovation identifiziert wurde, hat auch Platz in der Versorgung. Wir brauchen empirisch gesicherte Daten darüber, welche Innovationen in der Diagnose, der Therapie und in der Medizintechnik die Versorgung der Menschen verbessern. Wir haben begrenzte Ressourcen - das wissen wir alle -, und wir wollen Erkenntnisse darüber gewinnen, wo eine hohe Breitenwirkung erzielt wird.
Ein typisches Beispiel - auch das für die Kollegen von der SPD - sind zum Beispiel die sogenannten Disease-Management-Programme oder die integrierte Versorgung, bei denen wir bis heute nicht wissen, ob die einstmals damit verbundenen Hoffnungen sich wirklich erfüllt haben. Hier haben wir sehr viel Geld ausgegeben; aber nach wie vor ist die Frage nicht geklärt, ob die Patienten von den in den Programmen festgelegten Qualitätszielen wirklich profitieren. Der gute Wille allein, liebe Kolleginnen und Kollegen, reicht eben nicht. Nur eine konsequente Forschung wird zeigen, ob für den Patienten etwas dabei herauskommt.
Das betrifft auch das zweite Aktionsfeld des Programms, auf das ich an dieser Stelle ganz besonders Bezug nehmen möchte: die individualisierte Medizin. Das ist ein Gebiet, welches vor allem dadurch gekennzeichnet ist, dass es zwischen großen Visionen und noch größeren Bedenken immer hin und her schwankt.
Individualisierung als neues Leitbild der Medizin? - Das ist eine Frage, die uns in den nächsten Jahren immer wieder umtreiben wird, in der Forschung und in der Gesundheitspolitik. Sind Effektivitätssteigerungen zu erwarten, oder wird die biologisch orientierte Medizin unbezahlbar bleiben? Wie hoch ist der tatsächliche Nutzen für die oft schwerkranken Patienten? Schon heute können wir je nach Krankheit höchst unterschiedliche Kostenentwicklungen erkennen, wie etwa bei Arzneikosten für zielgerichtete Therapien bei Brust-, Darm- oder Lungenkrebs: einerseits horrende Kosten für individuelle Profile, andererseits Preise für Gentests und ganze Genomanalysen im freien Fall.
Zwischen 400 und 700 Wirkstoffe, die man zur maßgeschneiderten Therapie rechnen darf, sind inzwischen in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung. Was aber fehlt, sind zum Beispiel standardisierte Gewebeproben und Biobanken. Studienergebnisse sind damit oft nicht mehr reproduzierbar. Der G-BA hat zu Recht darauf verwiesen, dass vor einer Erstattungsfähigkeit durch die Kassen die individualisierte Medizin zuerst von der Diagnose bis zur Behandlung eindeutig ihren Nutzen zeigen muss.
Für uns heißt das: Das ist der treibende Grund für Gesundheitsforschungsprogramme. Das müssen wir absichern. Dafür müssen wir sorgen; denn die Menschen in diesem Lande haben einen Anspruch darauf, dass neue Methoden in der Medizin forschungsmäßig unterlegt und dann in der Praxis umgesetzt werden. Die Debatte, ob die Wirtschaft profitiert oder nicht, ist eine völlig virtuelle. Es geht darum, dass wir forschen, damit die Menschen in diesem Lande in eine gesunde Zukunft gehen; in eine Zukunft, in der sie alles nutzen können, was möglich ist, und das zu einem vernünftigen Preis. Ich sage Ihnen ganz offen, Frau Ministerin: Ich bin als Haushaltspolitikerin und als Gesundheitspolitikerin froh, dass wir heute diesen Weg mit diesem Programm gehen können.
Herzlichen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält jetzt die Kollegin Martina Bunge für die Fraktion Die Linke.
Dr. Martina Bunge (DIE LINKE):
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich unterstreiche für die Linksfraktion ebenfalls, dass Sie, verehrte Frau Ministerin Schavan, in dem vorgelegten Rahmenprogramm viele wichtige Punkte benennen. Wenn man aber genauer hinschaut, ist die Einschätzung nicht mehr ganz so schmeichelhaft. Herr Kretschmer, das sind unseres Erachtens nicht nur Kleinigkeiten.
Ihr Ausgangspunkt ist - und das wiederholen Sie gebetsmühlenartig -, dass Demografie und medizinischer Fortschritt große Herausforderungen sind, uns aber auch vor massive Probleme stellen. Das ist eingängig und klingt beim ersten Hinhören logisch; ich sage aber: Man kann damit ganz schön darüber blenden, wie differenziert die Prozesse dahinter sind. Tatsächlich werden die Menschen älter, und der Anteil der Älteren in der Gesellschaft wird sich erhöhen. Wissenschaftliche Studien zeigen aber: Weder muss die Wirtschaftskraft aufgrund der alternden Gesellschaft sinken, noch müssen die Gesundheitskosten deshalb in die Höhe schießen. Unseres Erachtens pflegen Sie diesen Mythos, um Ihre unsoziale Politik begründen zu können.
Seit Jahrzehnten betragen die Gesundheitskosten ziemlich konstant 10 bis 11 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist der wahre Maßstab.
Wir stellen immer wieder fest, dass sich die sogenannten Prognosen nicht bewahrheiten. Ich möchte einen Artikel aus dem Spiegel von 1975 zitieren. In diesem Artikel ging es um die Frage, was, wenn es so weiterginge wie damals, im Jahr 2000 sein würde. Dort steht, dass die Westdeutschen dann das ganze Jahr hindurch nur für den Gesundheitsdienst arbeiten müssten. Diese Situation ist nicht eingetreten. Das sind Horrorszenarien. Wir lehnen es ab, solche Horrorszenarien zu verbreiten, und wir werden nicht müde, dieses unwissenschaftliche Herangehen abzulehnen.
Die Bundesregierung scheint nicht wirklich zu glauben, dass die alternde Gesellschaft ein Problem darstellt. Vergeblich habe ich ein Aktionsfeld gesucht, in dem man sich explizit mit den Folgen des demografischen Wandels für die Gesundheitsforschung auseinandersetzt. Das Wort ?Alter“ taucht in Ihrem Programm siebenmal auf, das Wort ?Wirtschaft“ hingegen 62-mal; das wurde vonseiten der SPD auch schon angesprochen.
Wohlgemerkt: Wir reden hier über das Rahmenprogramm für die Gesundheitsforschung für die kommenden acht Jahre. Daher ist ein langfristiges Denken wichtig. Folgerichtig schreiben Sie im Abspann auch, dass es jetzt darauf ankommt, ?diesen Rahmen auszufüllen und weiter zu konkretisieren.“ Dort steht, dass ?heute noch nicht absehbare Herausforderungen“ einzubeziehen sind.
Ich sage Ihnen ehrlich: Ich hätte mich gefreut, wenn Sie heute Bekanntes und bereits Erforschtes stärker einbezogen hätten. So hingegen beruht Ihr Ansatz für die Prävention auf altbackenen Konzepten. Verhaltensprävention ist überholt. Wenn Minister Rösler das nicht mitbekommen hat, obwohl dies schon seit vielen Jahren bekannt ist - als die Ergebnisse veröffentlicht wurden, war er noch in der Grundschule -, ist das die eine Sache. Aber Sie, Frau Ministerin Schavan, hätten das doch mitbekommen müssen.
Längst wird der Paradigmenwechsel in Richtung Verhältnisprävention eingefordert. Frau Ministerin, Sie geben den Ton an. Ich denke, im Bereich der Forschung können Sie die Stoßrichtung bestimmen. Das haben wir vermisst.
In Ihrem Programm ist kein einziges Wort über den Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit zu finden. Wir wissen, dass maßgeblich soziale Faktoren wie Bildung, Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Einkommen und sozialer Status den Gesundheitszustand, ja, sogar die Lebenserwartung beeinflussen. Als Herausforderungen im Bereich Vorsorge nennen Sie aber nur die Präventions- und die Ernährungsforschung. Das ist zwar ein anderer Ansatz als bisher, greift unseres Erachtens aber viel zu kurz.
Wir müssen erforschen, was uns gesund erhält, über welche Ressourcen wir verfügen müssen, um gesund zu bleiben. In diesem Zusammenhang spielen die sozialen Faktoren die Hauptrolle. Der Ansatz der Stärkung der Ressourcen ist im Kinder- und Jugendalter und im Erwerbsalter wichtig, er ist für Menschen mit Behinderung und für Menschen im Ruhestand wichtig, also für alle.
Es gibt viele wissenschaftliche Erkenntnisse. In manchen Bereichen ist es erforderlich, endlich einmal Studien in Auftrag zu geben, zum Beispiel bei der schon erwähnten Komplementärmedizin, die Potenziale hat. Diese sind aber nicht für alle nachvollziehbar ausgewiesen. Vor allen Dingen brauchen wir Umsetzungsstrategien. Das sind die Aufgaben von heute, die erledigt werden müssen, damit sich das Wohlbefinden in der alternden Gesellschaft tatsächlich und maßgeblich verbessert.
Nebenbei bemerkt würden wir uns dadurch auch an die Definition des Begriffs ?Gesundheit“ der Weltgesundheitsorganisation halten, nach der Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen ist, sondern der Zustand eines vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens.
Es geht also nicht nur darum, das Rahmenprogramm Gesundheitsforschung der Bundesregierung umzusetzen und zu konkretisieren.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Frau Kollegin.
Dr. Martina Bunge (DIE LINKE):
Es gibt Änderungs- und Ergänzungsbedarf. Ich denke, diese Aufgabe müsste bald in Angriff genommen werden.
Danke schön.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nächster Redner ist der Kollege Eberhard Gienger für die CDU/CSU-Fraktion.
Eberhard Gienger (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute schon sehr viel über Gesundheit und das Gesundheitsforschungsprogramm gehört. Ich möchte mich bezüglich des Programms besonders auf das Aktionsfeld von Präventions- und Ernährungsforschung konzentrieren, weil mir dieses Thema als Forschungs- und als Sportpolitiker natürlich am Herzen liegt. Eine wichtige Aufgabe der medizinischen Forschung sehen wir im Bereich der großen Volkskrankheiten; das ist heute schon mehrfach erwähnt worden. Schon heute leiden Millionen Menschen in Deutschland an Diabetes, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an Krebs, an neurodegenerativen Erkrankungen, an Arteriosklerose oder auch an Störungen des Stoffwechsels.
In den nächsten Jahrzehnten wird die Häufigkeit dieser Erkrankungen aufgrund der steigenden Lebenserwartung noch zunehmen. Die steigende Anzahl älterer Menschen hat auch eine Zunahme von Demenzerkrankungen und demzufolge Pflegebedürftigkeit zur Folge. Neben der Suche nach Therapie und Heilung gewinnen somit die Pflege und die Versorgungsforschung rasant an Bedeutung. Da viele Volkskrankheiten durch einen angepassten Lebensstil gelindert oder vielleicht sogar verhindert werden können, werden Prävention und richtige Ernährung zu wichtigen Instrumenten unseres Gesundheitssystems.
Alle Teile des Körpers, die eine Funktion haben, werden gesund, wohlentwickelt und altern langsamer, sofern sie mit Maß gebraucht und in Arbeiten geübt werden, an die man gewohnt ist. Wenn sie aber nicht benutzt werden und träge sind, neigen sie zur Krankheit, wachsen fehlerhaft und altern schnell.
So hat das Hippokrates vor ungefähr zweieinhalbtausend Jahren ausgedrückt. Was vor zweieinhalbtausend Jahren bereits bekannt war, hat in den industrialisierten Gesellschaften längst zu einem Wandel geführt, und zwar zu einem Wandel unseres Krankheitspanoramas. Die neuen Leiden in unserer modernen Gesellschaft heißen also Zivilisations- oder Volkskrankheiten. Sie betreffen offensichtlich trotz guter medizinischer Versorgung einen zunehmend größeren Teil unserer Bevölkerung.
Studien des Robert-Koch-Institutes haben ergeben, dass ungefähr ein Viertel der deutschen Bevölkerung an Herz-Kreislauf-Problemen und ungefähr genauso viele an Rückenschmerzen leiden. Der technologisch-gesellschaftliche Wandel führt also zu einem Bewegungsmangel und einem einseitigen Bewegungsverhalten. Diese Faktoren begünstigen natürlich die Entwicklung der bereits erwähnten Krankheiten. Viele Kinder leiden ebenfalls an solchen Erkrankungen. Die Tendenz ist steigend.
Ein gesundheitsgerechtes Bewegungsverhalten wirkt also der Entwicklung dieser Krankheitsbilder entgegen und stellt einen Schutzfaktor für die Gesundheit dar. Daher kommt der Prävention eine besondere Bedeutung zu. Zum einen soll sie die Lebensqualität der Menschen in allen Lebensbereichen verbessern, zum anderen führt sie zu einem erhofften Nebeneffekt, nämlich der Senkung der Ausgaben für die Behandlung von chronischen Krankheiten. Dies darf erwähnt werden, ohne den Vorwurf hören zu müssen, dass es in unserem Programm nur um einen ökonomischen Nutzen gehe.
Von besonderer Bedeutung ist, dass ein sehr großer Teil der Erkrankungen kaum schicksalhaft ist, sondern weitestgehend verhaltensbedingt. Beispielsweise sind extremes Übergewicht und die daraus resultierenden Folgeerkrankungen nicht allein durch Lebensumstände bedingt und nur in seltenen Fällen durch organische Defekte hervorgerufen, sondern sie sind auch das Ergebnis fehlender körperlicher Aktivität. Das heißt, dass das Auftreten und der Verlauf chronischer Krankheiten in hohem Maße durch persönliches Verhalten sowie durch Fehlanreize und gesundheitliche Belastungen aus dem sozialen und physischen Umfeld verursacht werden.
Überzeugende Beweise stützen die Hypothese, dass Inaktivität das Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko einer Anzahl von chronischen Krankheiten erhöht. Die stichhaltigsten Beweise für diese Kausalzusammenhänge existieren für Koronararterienerkrankungen, Hypertonie, Dickdarmkrebs, Fettleibigkeit und nicht zuletzt auch Diabetes mellitus. Ein körperlich aktiver Lebensstil verringert allerdings die Wahrscheinlichkeit der Mortalität und erhöht die Lebenserwartung.
Da durch ein Mehr an Bewegung nicht alle Krankheiten verhindert werden können, ist die Einrichtung der Gesundheitsforschungszentren der richtige Weg. Damit wird im Kampf gegen die Volkskrankheiten ein neuer Weg beschritten. Ich finde, unsere Ministerin hat dies in überzeugender Weise dargestellt.
Es werden auch neue Ansätze und Wege zur Prävention gesucht, die dazu beitragen, dass diese Krankheiten erst gar nicht entstehen können.
Unter dem Dach der nationalen Präventionsstrategie entwickelt das BMBF einen Aktionsplan, der die Forschungsförderung zu allen für Präventions- und Ernährungsfragen relevanten Ansätzen - von der Epigenetik bis hin zur Epidemiologie - zusammenführt und interdisziplinär verknüpft. Wenn wir uns im Jahr 2018 mit der nächsten Auflage des Rahmenprogramms Gesundheitsforschung befassen werden, dann wird schon zu erkennen sein, dass wir viele unserer ambitionierten Ziele erreicht haben.
Ich kann mir sehr wohl vorstellen, lieber René Röspel und Kollegen, dass gerade das Thema ?Präventions- und Ernährungsforschung“ ein guter erster Schritt auf einem gemeinsamen Weg ist. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die SPD und die anderen Oppositionsparteien zur Ausgestaltung dieses Rahmenprogramms beitragen können.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält nun die Kollegin Birgitt Bender für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.
Birgitt Bender (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Lieber Herr Gienger, alles, was Sie zum Zusammenhang zwischen Bewegung, Ernährung und Volkskrankheiten sagen, ist richtig. Was ich bei der Union aber immer wieder vermisse, ist die Erkenntnis, dass es beim Thema Prävention auch und gerade um soziale Fragen geht.
Es nützt doch nichts, wenn Sie joggen oder ich mit einem Streetstepper in den Bundestag fahre. Es geht darum, dass man sich in die Stadtteile begibt, in denen viele Kinder morgens kein Frühstück bekommen und nicht zu Fuß zur Kita gebracht werden.
Damit muss man sich befassen. Wenn man sich mit dem Thema Forschung beschäftigt, sollte es auch um die Frage gehen, wie man diese Leute erreicht. Natürlich müssen wir dies auch in der Gesundheitspolitik umsetzen. Auch der Gesundheitsminister redet ja von Eigenverantwortung, meint damit aber nur, dass die Leute mehr zahlen sollen. Er spricht aber nicht von Empowerment und der Befassung mit den unteren sozialen Schichten.
Das ist bei Ihnen leider immer noch nicht eingepreist. Vielleicht ist dies eine Gelegenheit, das zu ändern.
Frau Ministerin Schavan, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie sich beim Rahmenprogramm Gesundheitsforschung Gemeinsamkeit wünschen. Ich will ausdrücklich begrüßen, dass - nach jahrelangem Drängen der Grünen - nun endlich ein Aktionsfeld Versorgungsforschung integriert ist. Was Sie dazu an Prosa schreiben, findet teilweise auch unsere Zustimmung, so etwa die Aussage, dass in Bezug auf Psychotherapie, Ergo- und Logopädie geforscht werden muss. Das ist richtig. Aber insgesamt sehe ich in diesem Programm sehr viel Produktorientierung. Da geht es um Arzneimittel, Diagnostik und Medizinprodukte. Was praktisch völlig fehlt, ist der Blick auf Verfahren des Gesamten. Das Wort ?Gesundheitssystemforschung“ kommt nicht einmal vor. Ich sehe überhaupt nicht, dass es hier entsprechende Ansätze gibt. Aber wir brauchen einen Blick auf das Gesamte, darauf, was den Menschen nützt und sie am Ende gesünder macht. Darauf werden wir achten.
Stattdessen sehen wir im Haushalt 2011, dass das BMBF mit gut 5 Millionen Euro ein Projekt zur Magnetresonanztomografie fördert. Brauchen wir aus gesundheitspolitischer Sicht ein solches Projekt? Deutschland ist Weltmeister bei der MRT-Diagnostik. Im Jahre 2009 wurde sie bei fast 6 Millionen Personen angewendet. Anders gesagt: Jeder 15. Bürger wurde innerhalb eines Jahres in die Röhre geschoben. Kassen und Wissenschaft stellen die therapeutische Notwendigkeit in vielen Fällen infrage. Was wir im Bereich der Versorgungsforschung brauchen, ist die Beantwortung der Frage, wann eine MRT-Untersuchung sinnvoll ist und wann nicht. Daran, dass dies bei Ihnen geschieht, habe ich Zweifel.
Nach dem, was Sie, Frau Flach, vorhin gesagt haben, müssten Sie daran eigentlich interessiert sein. Denn immerhin - das begrüße ich sehr - haben Sie betont, dass nicht alles, was neu ist, den Menschen nützt und dass wir mehr Verfahren brauchen, mit denen der Nutzen überprüft werden kann.
Was ich in diesem Rahmenplan auch vermisse, ist die Komplementärmedizin, also die alternativen Heilweisen, die die klassischen Verfahren ergänzen können. Dazu braucht es Forschung, aber wir sehen davon so gut wie nichts.
Es hat ein Vierteljahr gedauert, bevor mir das BMBF überhaupt mitteilen konnte, wie viele Fördermittel denn dafür in den letzten fünf Jahren geflossen sind. Es waren zusammengerechnet gerade einmal 1,2 Millionen Euro. Im Gegensatz dazu fördert in den USA das National Institute of Health die komplementärmedizinische Forschung jährlich mit mindestens 120 Millionen Dollar. Ich finde, daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen und Geld zur Erforschung der Komplementärmedizin in die Hand nehmen. Frau Ministerin, es geht übrigens nicht nur, wie Sie im Ausschuss angedeutet haben, um die chinesische Medizin. Die ist auch ein Ansatz. Aber wir sollten auch etwa die Homöopathie und die Anthroposophie in den Blick nehmen, die Heilweisen mit deutschen Wurzeln. Auch diese haben hier einen ganz hohen Stellenwert.
Stattdessen ist leider viel von Genetik die Rede. Immerhin habe ich da die kritischen Anmerkungen von Frau Flach gehört. Ich will aber auch darauf hinweisen, dass sehr nebulös bleibt, was Sie da eigentlich erforschen wollen. Ich erinnere daran, dass jüngst noch Geld in ein Projekt geflossen ist - inzwischen ist es eingestellt -, in dem es um die Forschung an geistig behinderten Kindern, um fremdnützige Forschung ging. Das ist etwas, was als medizinische Untersuchung gar nicht zulässig wäre. Als Forschung haben Sie es aber zunächst unterstützt. Da kann ich nur sagen: Hier ist überfällig, dass der Schutz von Probanden, Datenschutz und Transparenz in der Forschung gewährleistet wird. Frau Ministerin, da haben Sie noch Hausaufgaben zu machen.
Danke schön.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält nun der Kollege Florian Hahn für die CDU/CSU-Fraktion.
Florian Hahn (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Alle Menschen wünschen sich ein langes und vor allem gesundes Leben. Auch wenn wir uns zu vielen Anlässen wie zum Geburtstag oder zum neuen Jahr gegenseitig Gesundheit wünschen, spielt gesundheitsbewusstes Leben und Verhalten im Alltag oftmals keine ausreichende Rolle. Spätestens jedoch, wenn man im Bekannten- oder Familienkreis mit schwerer Krankheit konfrontiert wird, erkennt man auf ganz persönliche Weise, welchen enorm hohen Stellenwert ein unbeschwertes und gesundes Leben einnimmt.
Aus diesem Grund stellt die Gesundheitsforschung einen der wichtigsten Bereiche für uns alle dar. Das Ziel des Gesundheitsforschungsprogramms der Bundesregierung ist es, dass alle Menschen schnell von den Forschungsergebnissen profitieren können.
In der Gesundheitsforschung werden neue oder bessere Diagnoseverfahren und Therapien entwickelt, um kranken Menschen effektiver zu helfen. Für uns als christlich-liberale Koalition steht dabei der erkrankte Mensch mit seinen Nöten im Mittelpunkt, dem wir Hand in Hand mit der Wissenschaft helfen wollen.
Was uns die Patienten und deren Gesundheit wert sind, das zeigen auch die enormen finanziellen Mittel, die hierfür aufgewendet werden: Fast 6 Milliarden Euro werden insgesamt zur Verfügung gestellt. Es handelt sich damit um das größte Förderungsprogramm für Gesundheitsforschung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Die Schwerpunkte beim Gesundheitsförderungsprogramm setzen wir bei der Erforschung von Volkskrankheiten sowie der Gesundheitswirtschaft. Doch auch die individualisierte Medizin und die globale Zusammenarbeit sind wichtige Themen des Programms. Wir wollen die Fähigkeiten der Wissenschaft bündeln und Translation beschleunigen. Dazu werden sechs deutsche Gesundheitszentren geschaffen. Letztes Jahr wurde beispielsweise mit dem Deutschen Zentrum für Diabetesforschung in München-Oberschleißheim bereits das zweite eröffnet.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege Hahn, darf Ihnen der Kollege Röspel eine Zwischenfrage stellen?
Florian Hahn (CDU/CSU):
Nein.
Das kann er danach machen. - Allein in Deutschland sind rund 8 Millionen Menschen von der Zuckerkrankheit betroffen, fast genauso viele Personen haben einen bislang unerkannten Diabetes oder ein hohes Erkrankungsrisiko. Es ist daher wichtig und notwendig, dass wir mit dem Zentrum neue Perspektiven für Prävention, Therapie und Diagnose des Diabetes schaffen. Durch die Kooperation mit Pharmaunternehmen können so Forschungsergebnisse schneller in die Praxis übertragen werden. Wir bringen die Forschung quasi ?ans Bett der Patienten“.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, in einer globalisierten Welt dürfen nicht nur Wirtschaftsaktivitäten global betrachtet werden, sondern ganz besonders auch die Gesundheitsforschung. In diesem Zusammenhang ist es mir wichtig, auf die vernachlässigten Krankheiten hinzuweisen, mit denen wir uns in dem Programm ebenfalls beschäftigen. Sie erzeugen in den Entwicklungsländern großes Leid und sind für den Tod vieler Menschen verantwortlich. Leider war die staatliche Forschungsförderung lange Zeit auf Krankheiten beschränkt, die hauptsächlich unsere Bürger im eigenen Land betreffen. Vor diesem Hintergrund stellen wir uns mit dem Gesundheitsforschungsprogramm neu auf. Wir machen nicht an den nationalen Grenzen halt, sondern helfen auch den Menschen in anderen Teilen der Welt. Dazu sind wir allein schon durch unser christliches Menschenbild verpflichtet.
Noch in diesem Jahr wird die Fördermaßnahme für Produktionspartnerschaften anlaufen. Dabei handelt es sich um internationale Non-Profit-Organisationen, deren Aufgabe es ist, Medikamente gegen vernachlässigte Krankheiten zu günstigen Preisen auf den Markt zu bringen.
Ich möchte Ihnen nun ein aktuelles Beispiel dafür nennen, wie die Förderung direkt dort ankommt, wo sie benötigt wird. Eines von 100 Kindern leidet an einem angeborenen Herzfehler. Viele von ihnen müssen rasch operiert werden. Der sogenannte RepliCardio ist ein neues Instrument zur Herstellung eines Herzmodells und hilft den Ärzten bei der Entscheidung, ob und wie operiert werden kann. Dieses Verfahren wurde vom Kompetenznetz Angeborene Herzfehler in Kooperation mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum entwickelt und vom BMBF gefördert. Das individuelle Herzmodell kann insbesondere dazu beigetragen, die Dauer der Operationen drastisch zu verkürzen. Oft entscheiden Minuten darüber, ob der Eingriff erfolgreich abgeschlossen werden kann oder ob es zu irreparablen Spätfolgen kommt.
Wie wichtig und weitsichtig die Überlegungen innerhalb des Forschungsförderungsprogramms sind, kann man darüber hinaus an der Alzheimerforschung erkennen. Rund 1,2 Millionen Menschen in Deutschland sind derzeit von der unheilbaren Krankheit betroffen. Statistiken gehen davon aus, dass es im Jahr 2050 rund 3 Millionen Menschen sein werden. Mit dem Alois Alzheimer Research Center, in dem die Ludwig-Maximilians-Universität München, die Technische Universität München, das Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen und das Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung integriert sind, ist ein weiterer Leuchtturm in der Forschungslandschaft geschaffen worden.
Insgesamt stellt das neue Förderungsprogramm einen Meilenstein in der Gesundheitsforschung dar. Wir sorgen mit dem enormen Mitteleinsatz von fast 6 Milliarden Euro dafür, dass Innovationen schneller bei den Patienten im Alltag ankommen. Wir lassen der Forschung aber auch genug Spielraum, um innovativ arbeiten zu können; denn das größte Innovationshemmnis - das wissen wir - ist unter anderem die Bürokratie. Die Änderungswünsche und der Antrag der SPD sind gerade auch deshalb abzulehnen.
Herzlichen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Das Wort erhält nun der Kollege Michael Gerdes für die SPD-Fraktion.
Michael Gerdes (SPD):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mein Kollege René Röspel und meine Kollegin Carola Reimann haben die Sicht der SPD-Fraktion auf das Rahmenprogramm der Bundesregierung bereits deutlich gemacht. Wir sehen große Lücken im Gesundheitsforschungsprogramm, besonders mit Blick auf sozialpolitische Fragen. Vor allem fehlt uns Sozialdemokraten der Blickwinkel der Patientinnen und Patienten. Mir persönlich fehlt auch der Blickwinkel der Beschäftigten im Gesundheitswesen. Im Rahmenprogramm finde ich keinen Hinweis darauf.
Frau Ministerin Schavan, Sie räumen der Gesundheitswirtschaft eine äußerst prominente Stellung ein und begründen dies mit dem Wachstumspotenzial der Branche. Mit moderner Medizintechnik und innovativen Medikamenten kann man offensichtlich viel Geld verdienen. Dagegen habe ich im Grundsatz nichts einzuwenden. Ich habe aber ein Problem damit, wenn die wirtschaftlichen Interessen von Forschung fast wichtiger erscheinen als der medizinische Fortschritt und die Gesundheit der Menschen in diesem Land.
Ganz deutlich wird diese Auffassung der schwarz-gelben Regierung auf Seite 4 der Unterrichtung. Dort steht schwarz auf weiß:
Des Weiteren soll die Gesundheitsforschung auf eine wirtschaftliche Verwertbarkeit ihrer Erkenntnisse hinarbeiten … schon in der Grundlagenforschung und der präklinischen Forschung.
Aus meiner Sicht darf nicht nur erforscht werden, wie wir neue Technologien schneller oder besser implementieren und vermarkten können; vielmehr muss es darum gehen, welche gesundheitlichen Vorteile die Menschen daraus ziehen können.
Der Mensch und seine Gesundheit gehören an die erste Stelle, nicht der mögliche Profit.
Ich füge ausdrücklich hinzu: Ich freue mich über jede Branche, die wirtschaftlich erfolgreich ist. Aber wir sollten auch darüber diskutieren, für wen Arbeitsplätze in der Gesundheitswirtschaft entstehen, welche Anforderungen die Beschäftigten erfüllen müssen, wie sich Berufsbilder verändern und unter welchen Bedingungen heute und in Zukunft gearbeitet werden muss.
Gibt es Ideen, wie die Arbeitsbelastung von Ärzten und Pflegepersonal gesenkt werden kann? Was muss eine Pflegerin künftig können? Wie schafft sie es, in einer alternden Gesellschaft immer mehr Patienten zu versorgen? Wie kann sie Familie und Beruf vereinbaren?
Insbesondere im Bereich der Pflege- und Dienstleistungsforschung sehe ich Lücken in dem Programm von Ministerin Schavan.
Die Pflegebranche braucht wissenschaftlich fundierte Antworten auf den steigenden Pflegebedarf.
Ich habe kürzlich Praxistage in der Seniorenpflege und im Krankenhaus durchgeführt.
- Wir alle, jawohl. - Dabei ist wahrscheinlich uns allen aufgefallen, dass die Ärzte und Pfleger eine sehr gute Arbeit leisten. Aber sie alle bewegen sich am Rande der Leistungsgrenze. Hohe Fallzahlen und viel Dokumentierung rauben ihnen in vielen Fällen die Zeit für die Patienten. Diese Probleme müssen erforscht werden. Kurzum: Ihrem Programm fehlt das Aktionsfeld, das sich den Fragen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer widmet.
Gesundheitsforschung muss sich auch ganz konkret mit den Bedürfnissen der Patienten auseinandersetzen. Haben wir überhaupt genügend Erkenntnisse darüber, was sich Patienten wünschen bzw. welche Anforderungen sie an das Gesundheitssystem stellen? Finden sich Patienten in einem System zurecht, das immer komplexer wird und ständig neue Behandlungsmethoden hervorbringt? Wer heute gesund werden will, braucht im Zweifel einen Case-Manager, der durch das System führt, um medizinische und soziale Dienstleistungen optimal zu koordinieren. Von Patientenautonomie ist da nicht mehr viel zu spüren.
Auf diese Systemfragen müssen wir Antworten finden. An dieser Stelle sind mir die Ausführungen der Bundesregierung zu abstrakt. Das Aktionsfeld der Versorgungsforschung muss dringend erweitert werden. Denn ohne Verbesserungen im System nützt uns die erfolgreichste Forschung nichts. Neue und verbesserte Geräte machen keinen Sinn, wenn der Patient nicht weiß, ob er die richtige Therapie bekommt oder wie er den richtigen Weg durch das Gesundheitslabyrinth findet.
Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, steht das diesjährige Wissenschaftsjahr unter dem Motto ?Forschung für unsere Gesundheit“. Das BMBF ruft die Bürgerinnen und Bürger zum Dialog auf und fragt nach den Erwartungen an die Gesundheitsforschung. Diese Herangehensweise wünsche ich mir auch für das vorliegende Rahmenprogramm: Erforschen Sie nicht in erster Linie die Wirtschaftlichkeit der Medizin,
sondern orientieren Sie sich an den Bedürfnissen der Menschen!
Lassen Sie sich nicht davon leiten, was der Gesundheitsindustrie hilft, sondern orientieren Sie sich daran, was für die Beschäftigten gut ist und was die Patienten gesund macht.
Herzlichen Dank.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Rudolf Henke für die CDU/CSU-Fraktion.
Rudolf Henke (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Verehrte Damen und Herren! Opposition ist ein schwieriges Tun. Ich glaube, es ist doppelt schwierig, wenn man an einem Teil der Vorbereitungen für das Gesundheitsforschungsprogramm teilgenommen hat, damals sogar in einer gemeinsamen Koalition mit der CDU/CSU-Fraktion in der ersten Regierung Merkel,
und jetzt erlebt, dass in der zweiten Regierung Merkel ein großer Teil eigener Forderungen umgesetzt wird. Deswegen findet sich auch in dem von Ihnen vorgelegten Antrag an sehr vielen Stellen ein Lob. Sie machen sogar Vorschläge, was alles der Deutsche Bundestag an dem Programm begrüßen soll. In mehreren Spiegelstrichen wird das ausgeführt. Trotzdem müssen Sie hier irgendwie Nöligkeit verbreiten,
- doch -, damit der Eindruck entsteht, als wäre alles kritisch zu bewerten.
Sie setzen darauf, dass die Menschen das Programm nicht gelesen haben, und tragen dann in Ihrem Antrag Dinge vor, die im Programm bereits enthalten sind, und tun so, als wären Sie die einzigen Erfinder dieser Punkte.
Ein plastisches Beispiel dafür ist das, was gerade geschehen ist. Sie haben behauptet, im Programm befinde sich kein Hinweis auf die Verbesserung der Situation der Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Liebe Kollegen, Sie sollten sich vergegenwärtigen, dass auf der Grundlage des Haushalts der Bundesregierung
- ich wollte darauf eigentlich nicht an dieser Stelle, sondern zu einem späteren Zeitpunkt eingehen - das Wissenschaftsfeld Versorgungsforschung allein im Jahr 2010 mit einer Ausschreibung in Höhe von 54 Millionen Euro für die Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen für das Gesundheitssystem bedacht worden ist. Ich bin bereit, darüber zu diskutieren, ob das reicht und ob zum Beispiel die DFG das im Rahmen ihrer Förderung hinreichend ergänzt. Wenn sie das nicht täte, müsste man noch einmal über die Summe diskutieren. Aber Sie tun so, als geschähe hier nichts, und wollen die Leute für dumm verkaufen. Das ist nicht in Ordnung.
Sie sagen außerdem, das alles sei wirtschaftskonzentriert. Das ist es nicht. Frau Bunges Zählerei mit dem Wortzählautomaten nutzt dabei nichts.
Was ist denn das für ein Niveau? Das ist ja kleinstes Pepita: Worte zählen durch ihre Bedeutung, nicht durch ihre Zahl.
Ich zitiere Seite 4 der Unterrichtung durch die Bundesregierung:
Primäres Ziel der Gesundheitsforschung ist es, Qualität und Sicherheit der Gesundheitsversorgung der Patientinnen und Patienten weiter zu steigern.
Das ist das primäre Ziel, um das es geht. Die Frage, ob die Wirtschaft dabei mitwirkt, ist eine Frage des Instrumentes. Wir wären doch töricht und dumm, wenn wir nicht bereit wären, die Produktivkraft der Wirtschaft zum Wohle der Patientinnen und Patienten zu nutzen.
Deswegen sage ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen: Lassen Sie die Tassen im Schrank!
Ich zitiere aus dem gemeinsamen Vorwort von Frau Schavan und Herrn Rösler zum Rahmenprogramm Gesundheitsforschung:
Aus der Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entstehen die Ansätze, die bei entsprechender Weiterentwicklung und erfolgreicher Übertragung in die medizinische Praxis den Menschen in unserem Land ein beschwerdefreies, selbstbestimmtes und langes Leben ermöglichen.
Das ist die Zielsetzung. Sie versuchen jetzt, es umzumünzen und einen Teil des Publikums mit den bei der SPD und den Linken üblichen und weitverbreiteten Ressentiments über die schwarz-gelbe Koalition zu bedienen. Das ist der Ansatz, den Sie praktizieren. Das ist nicht in Ordnung. Dagegen wehren wir uns.
In einer Zeit, in der um die finanzielle Stabilität gerungen werden muss, ist es ein deutliches Zeichen des Bundes, für die Gesundheitsforschung in den Jahren 2011 bis 2014 mehr als 5,5 Milliarden Euro allein aus dem Haushalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vorzusehen.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege Henke, Sie lassen doch jetzt sicherlich gerne den Kollegen Röspel, der vorhin mit seiner Wortmeldung nicht zum Zuge gekommen ist, zu Wort kommen.
Rudolf Henke (CDU/CSU):
Ja, sehr gerne.
René Röspel (SPD):
Vielen Dank, Herr Henke, dass das möglich ist. - Die Zahl 5,5 Milliarden Euro auf fünf Jahre wird ständig hervorgehoben. Sie schreiben im Gesundheitsforschungsprogramm, dass sich diese 5,5 Milliarden Euro auf fünf Jahre aus den Geldern für die institutionelle Förderung, Projektförderung und dem Bundesanteil an der DFG-Förderung, jeweils bezogen auf die Gesundheitsforschung, zusammensetzen. Es handelt sich also um nichts anderes als die Aufzählung dessen, was in den letzten Jahren bereits gemacht bzw. etatisiert worden ist. Deshalb lautet meine konkrete Frage: Sie suggerieren 5,5 Milliarden Euro. Wie viele Mittel werden wirklich zusätzlich bzw. neu bereitgestellt?
Rudolf Henke (CDU/CSU):
Lieber Herr Kollege Röspel, diese Frage werden Sie sich doch schon beantwortet haben, als Sie den Bundestag aufgefordert haben, zu begrüßen, dass sich die Bundesregierung im Rahmenprogramm Gesundheitsforschung für eine Stärkung der krankheitsbezogenen Projektforschung bzw. Projektförderung ausspricht. Das haben Sie an die erste Stelle gesetzt. Ob Sie dieses Geld jetzt zusätzlich haben oder ob Sie dieses Geld bloß ausgeben oder in den Haushalt schreiben
oder ob Sie dieses Geld in dieses Programm stecken: Der entscheidende Punkt ist doch, dass es zur Verfügung steht.
Der entscheidende Punkt ist, dass es genutzt werden kann.
Dann - das verstehe ich gar nicht - sagen Sie, Frau Reimann und andere aus Ihrer Gruppe, das sei alles zu abstrakt und zu unbestimmt. - Ja, klar, es kommen jetzt Ausschreibungen. An diesen Ausschreibungen nimmt natürlich die Wissenschaftsgemeinde teil. Da gibt es Projektträger, die diese Ausschreibungen betreiben. Was hätten Sie denn gern? Wenn ich mir Ihren Katalog von Forderungen zur Konkretisierung ansehe, dann habe ich das Gefühl, Sie wollen schon die 200 000 Adressen und Geburtsdaten derer wissen, die dann in der Bevölkerungskohorte erfasst sein sollen. Das möchten Sie wahrscheinlich offenlegen.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass Sie hier davon träumen, einen wissenschaftlichen Fünf- oder Zehnjahresplan vorgelegt zu bekommen. Das ist aber ein falsches planwirtschaftliches Verständnis des Wissenschaftsprozesses auch in der Gesundheitsforschung.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, leider findet man zurzeit in meinem Heimatland Nordrhein-Westfalen, wo eine schwarz-gelbe Koalition
dadurch für eine große Stimulation der wissenschaftlichen Entwicklung gesorgt hat, dass sie ein Hochschulfreiheitsgesetz verabschiedet hat, eine aus Ihrer Partei stammende Philosophie, die diese neu geschaffene Hochschulautonomie wieder in eine Welt zurückführen will, in der der Staat den Wissenschaftsprozess steuert. Genau diesen Anspruch, nämlich die Steuerung des Wissenschaftsprozesses durch den Staat, atmet Ihr Antrag.
Da haben wir lieber mehr Vertrauen in die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aus der Motivation des Gesundheitsforschungsprogramms die Beiträge leisten werden, die dann Patientinnen und Patienten zum Wohl gereichen. Deswegen bin ich sehr dafür, über manches zu diskutieren.
Ich finde es zum Beispiel falsch - -
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Nein, ?zum Beispiel“ nicht mehr.
Rudolf Henke (CDU/CSU):
Nicht mehr? - Also: Ich finde es etwa falsch, dass zur Wertung individualisierter Medizin in diesem Programm steht - Zitat -:
Erste Schritte auf dem Weg zur individualisierten Medizin sind das Verständnis grundlegender Krankheitsmechanismen und die Identifizierung molekularer Schaltstellen für die Ausprägung einer Erkrankung.
Das halte ich für falsch.
Nein, erste Annäherung an individualisierte Medizin ist, dass der Arzt dem Patienten begegnet, ihn nach seinen Beschwerden befragt, sich ihm so weit nähert, dass eine körperliche Befunderhebung stattfindet, und er dann ein individuelles diagnostisches und therapeutisches Konzept daraus macht. Das findet seit Hippokrates statt.
Deswegen ist das, was im Programm steht, nicht die erste Annäherung an individualisierte Medizin. Individualisierte Medizin ist mehr als bloß molekulargenetisch begründete Medizin. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, -
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Herr Kollege!
Rudolf Henke (CDU/CSU):
- ist mein Satz, mit dem ich dann gern enden möchte: Dieses Gesundheitsforschungsprogramm als Ganzes nimmt den Menschen in den Blick und dient einer individualisierten Medizin in allen Ausprägungen des Menschseins.
Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Präsident Dr. Norbert Lammert:
Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 17/4243 und 17/5364 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden? - Das ist der Fall. Dann sind die Überweisungen so beschlossen.
Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 4 auf:
Beratung des Antrags der Abgeordneten Christel Humme, Caren Marks, Petra Crone, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD
Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen gesetzlich durchsetzen
- Drucksache 17/5038 -
Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f)
Innenausschuss
Rechtsausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Arbeit und Soziales
Haushaltsausschuss
Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind auch für diese Aussprache 90 Minuten vorgesehen. - Ich höre keinen Widerspruch. Dann können wir so verfahren.
Ich eröffne die Aussprache und erteile der Kollegin Caren Marks für die SPD-Fraktion das Wort.
Caren Marks (SPD):
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Schon auf dem ersten Internationalen Frauentag 1911 forderten Frauen gleiche Rechte. Sie kämpften für ihr Wahlrecht, aber auch für bessere Bezahlung und für gute Arbeit. Was hat sich in 100 Jahren getan? Das Wahlrecht für Frauen wurde 1918 durchgesetzt. Die formalrechtliche Gleichstellung mit den Männern wurde 1949 im Grundgesetz verankert. Unser Recht hier in Deutschland sowie das EU-Recht verbieten Diskriminierung aufgrund des Geschlechts auch beim Lohn. So weit zum geltenden Recht.
Doch wie sieht die Arbeitswirklichkeit von Frauen in diesem Land aus? Trotz guter Bildungsabschlüsse haben Frauen nach wie vor schlechtere Chancen in der Arbeitswelt, haben seltener Führungspositionen inne, und sie erhalten deutlich weniger Lohn als Männer. Zur Durchsetzung von gleichem Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit fordern wir, die SPD-Bundestagsfraktion, in unserem Antrag die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Herstellung von Entgeltgleichheit vorzulegen.
Denn eines ist klar: Frauen haben mehr verdient als unverbindliche Sonntagsreden der Frauenministerin und der Arbeitsministerin sowie der Kanzlerin.
Traurig, aber wahr: Erwerbstätige Frauen erhalten in unserem Land nach wie vor im Schnitt 23 Prozent weniger Lohn als Männer. Damit liegen wir deutlich über dem Durchschnitt in der Europäischen Union mit 18 Prozent Lohndifferenz. Wir haben hier im Deutschen Bundestag mehr als nur ein Mal über die wirklichen Ursachen der Entgeltungleichheit zwischen Männern und Frauen diskutiert. So haben Frauen vor allem aufgrund fehlender Kinderbetreuungsangebote längere Erwerbsunterbrechungen, und sie sind auch deswegen vermehrt in Teilzeitarbeit beschäftigt. Mit knapp 70 Prozent stellen Frauen die große Mehrheit der Beschäftigten im Niedriglohnsektor dar. Der von uns seit langem zu Recht geforderte gesetzliche Mindestlohn würde also einen wichtigen Beitrag zu mehr Lohngerechtigkeit für Frauen in unserem Land leisten.
Doch selbst wenn alles gleich ist - Qualifikation, Tätigkeit, Alter, Betrieb -, liegt der Durchschnittslohn von Frauen bei etwa 8 bis 12 Prozent unter dem der Männer. Dies ist nichts anderes als Diskriminierung von Frauen in unserem Land.
Wenn sowohl von der Frauenministerin als auch von der Kanzlerin so kluge Sprüche wie ?Frauen müssten beim Gehalt einfach nur besser verhandeln“ zu hören sind, so ist das erstens zynisch und zweitens lebensfremd. Wie gut, dass weder Frau Schröder noch Frau Merkel ihr Gehalt bisher wirklich verhandeln mussten.
Statt die Verantwortung bei den Frauen einseitig abzuladen, sollte diese Bundesregierung ihr Nichthandeln als Gesetzgeber infrage stellen. Es helfen keine Appelle an die Freiwilligkeit von Unternehmen; der Gesetzgeber ist bei der Beseitigung der Entgeltungleichheit klar gefordert. Vielleicht sollte die Bundesregierung wieder einmal einen Blick in unser gutes Grundgesetz werfen. So heißt es in Art. 3 Abs. 2:
Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
Da müsste doch auch bei dieser schwarz-gelben Bundesregierung etwas klingeln. Wenn es erwartungsgemäß bei der Frauenministerin nicht klingelt, so vielleicht beim Finanzminister; denn laut EU-Kommissarin Reding würde die Beseitigung der Lohnunterschiede das Bruttoinlandsprodukt um rund 30 Prozent steigern. Das klingt doch auch für einen Finanzminister durchaus interessant.
Die Lohndiskriminierung von Frauen werden wir nur mit einem Gesetz beseitigen können. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Verantwortlichen aus eigenem Antrieb nicht tätig werden. Also müssen die Arbeitgeber durch ein Gesetz verbindlich dazu aufgefordert und gegebenenfalls auch gezwungen werden, Entgeltgleichheit herzustellen. Ein solches Gesetz muss folgende Kernelemente enthalten: Es muss zuerst einmal Transparenz über die Entlohnung in den Betrieben hergestellt werden. Die Geheimniskrämerei hinsichtlich der Bezahlung in den Betrieben ist zu beenden; denn sie begünstigt vor allem Lohndiskriminierung mit den entsprechenden Auswirkungen.
Also müssen die Arbeitgeber verpflichtet werden, Entgeltberichte zu erstellen. Diese sind von einer staatlichen Behörde entsprechend zu prüfen. Datenschutz ist natürlich zu gewährleisten. Wird Entgeltungleichheit festgestellt, muss das Gesetz einen Prozess zur Beseitigung der Lohndifferenz einleiten und natürlich auch festlegen. Auch muss es wirksame Instrumente der Kontrolle und Durchsetzbarkeit enthalten.
Mit dem Gesetz wollen wir, die SPD-Bundestagsfraktion, die Unternehmen zum Tätigwerden verpflichten. Dabei wollen wir auch die Rolle der Gewerkschaften und Betriebsräte stärken. Weigert sich der Arbeitgeber, für Transparenz und Entgeltgleichheit zu sorgen, so ist auch der Klageweg, der im Gesetz zu regeln ist, ein notwendiger Schritt. Die Verbandsklage wird hier unumgänglich sein.
Da zu erwarten ist, dass diese Bundesregierung - auch gerade leider diese Frauenministerin; schade, dass sie nach wie vor dieser Debatte nicht beiwohnt - gesetzgeberisch wohl nicht handeln wird, kündige ich Ihnen an: Wir, die SPD-Bundestagsfraktion, werden ein Entgeltgleichheitsgesetz vorlegen. Denn wo sich Schwarz-Gelb vor der Wirtschaft wegduckt, werden wir handeln und die Lohndiskriminierung von Frauen endlich wirksam gesetzlich bekämpfen.
Worthülsen und leere Versprechungen à la Merkel, Schröder und von der Leyen haben Gleichstellungspolitik in diesem Land noch nie vorangebracht. Frauen haben endlich mehr verdient.
Vielen Dank.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Die Kollegin Nadine Schön hat das Wort für die CDU/CSU-Fraktion.
Nadine Schön (St. Wendel) (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 25. März war der diesjährige Equal Pay Day. Der Durchschnittsmann hätte am 25. März anfangen können, zu arbeiten, und hätte am Ende des Jahres das gleiche Geld auf dem Konto wie die Durchschnittsfrau, die seit Beginn des Jahres gearbeitet hat.
Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Einen kleinen Moment, Frau Kollegin, wir müssen erst einmal sehen, dass der Ton verstärkt wird, damit Sie nicht schreien müssen. Die Techniker werden sich darum kümmern. Auch das ist eine Frage der Gleichberechtigung.
Nadine Schön (St. Wendel) (CDU/CSU):
Ich hoffe aber nicht, dass wir auch die Empfindlichkeit beim Mikro gesetzlich regeln müssen. Das klappt wohl auch so. - In Deutschland beträgt die Entgeltungleichheit 23 Prozent. Das ist eine Zahl, die wir nicht hinnehmen dürfen. Es lohnt sich, sich die Ursachen der Entgeltungleichheit anzuschauen; denn das Thema ist sehr komplex.
Die erste Ursache ist der Grad der Qualifikation von Frauen. Glücklicherweise sind die jungen Frauen heute in der Regel genauso gut qualifiziert wie die Männer; aber noch gibt es Unterschiede. Und niedrigere Qualifikation führt selbstverständlich zu niedrigeren Löhnen. Problematisch ist auch die Art der Qualifikation, die Berufswahl. Mädchen entscheiden sich häufig für schlecht bezahlte Dienstleistungsberufe. Zu selten wählen sie technische und mathematisch-naturwissenschaftliche Ausbildungsgänge und Studienfächer. Aber genau die lassen relativ hohe Löhne erwarten. Die Konsequenz: Wir haben zwar viele sehr gut ausgebildete Frauen mit im Schnitt besseren Abschlüssen als die Männer. Im Geldbeutel macht sich das aber leider fast nie bemerkbar.
Ein weiterer Grund ist die Position im Unternehmen. Wir wissen: Nur selten besetzen Frauen die hohen, gut bezahlten Positionen; nur selten sind Frauen in Führungspositionen. Die Folgen sind: wenig Führungspositionen, geringer Gehaltsdurchschnitt, hohe Entgeltungleichheit. Dieser Zusammenhang ist einfach nachzuvollziehen.
Ein weiterer Grund für die Lohnlücke liegt im Lebensverlauf vieler Frauen: Schwangerschaft, Erziehungszeit und Pflegezeiten. Bei Frauen findet man mehr Brüche im beruflichen Lebensverlauf und mehr Erwerbsunterbrechungen. Das verhindert eine Karriere und ein kontinuierliches Aufsteigen in höhere Gehaltsklassen.
Besonders verantwortlich für den Einkommensknick ist die hohe Teilzeitquote. Frauen arbeiten überdurchschnittlich oft - etwa zu 35 Prozent - in einem Teilzeitjob, bei den Männern sind es gerade einmal 5 Prozent. Entsprechend geringer ist das Einkommen bei Frauen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Gründe - Art und Grad der Qualifikation, Position, Erwerbsunterbrechungen und vor allem die hohe Teilzeitquote - sind die harten Faktoren, die erwiesenermaßen zum großen Teil zur Entgeltungleichheit beitragen. Ich sage das deshalb so ausführlich, weil die Zahl von 23 Prozent oft so unerklärlich hoch erscheint.
Rechnet man diese Faktoren heraus, so gelangt man zu einer Lohnlücke von 6 bis 10 Prozent. Das ist wesentlich weniger als die genannten 23 Prozent, aber natürlich immer noch 6 bis 10 Prozent zu viel.
Versucht man, diese 6 bis 10 Prozent zu erklären, dann wird es noch schwieriger; denn dann kommt man in den subjektiven Bereich. Zwei Gründe kann man ausmachen. Erstens müssen wir feststellen: Es ist sicher eine Mentalitätsfrage. Studien haben ergeben - das hat nicht die Ministerin erfunden, liebe Kollegin Marks -, dass Frauen bei Gehaltsverhandlungen bescheidener sind als ihre männlichen Kollegen. Wir fordern weniger und bekommen deshalb auch weniger. Das ist wohl eine falsche Bescheidenheit. Hier sind wir Frauen selbst gefragt, etwas zu ändern.
Ich glaube allerdings nicht, dass das der entscheidende Grund für die Lücke von 6 bis 10 Prozent ist.
Den zweiten Grund
halte ich für viel wesentlicher, und das ist schlicht und einfach Diskriminierung, nämlich Diskriminierung, die sich darin äußert, dass Frauen weniger zugetraut wird, dass eine mögliche Schwangerschaft schon beim Berufseinstieg mit eingepreist wird und Frauen deshalb trotz gleicher Qualifikation schlechter bezahlt werden. Das gibt es, und das muss genannt werden, und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der eigentliche Skandal.
Insgesamt kann man festhalten: Die Ursachen der Entgeltungleichheit sind sehr unterschiedlich, aber hinnehmbar ist die Lohnlücke von 23 Prozent deswegen noch nicht. Wir müssen uns fragen: Welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Was tun wir? Die SPD hat sich in ihrem Antrag dafür entschieden, die vermeintliche Allzweckwaffe auszupacken, nämlich die staatliche Regulierung.
Da soll es gesetzliche Fristen, eine neue Entgeltgleichheitskommission und ein Verbandsklagerecht für Antidiskriminierungsverbände geben. In Anbetracht der vielen verschiedenen Ursachen, die wir ausgemacht haben, meine ich, dass Sie bei diesen Forderungen zu staatsgläubig und vor allen Dingen zu undifferenziert sind. Wirksamer erscheinen mir von den Ursachen hergeleitete Gegenmaßnahmen. Wir müssen bei einem so komplexen Thema doch an die Wurzeln, an die Ursachen des Übels, und genau das tun wir,
zum Beispiel mit Maßnahmen gegen das eingeschränkte Berufswahlverhalten. Von wegen: Die Mädchen interessieren sich nicht für Technik! Schauen Sie sich all die MINT-Initiativen, den Girls‘ Day, Roberta an! Es gelingt, mehr Frauen für technisch geprägte Berufe zu interessieren, und der Frauenanteil in diesen Berufen steigt.
Was ist aber mit denen, die nach wie vor kein Interesse an solchen Berufen haben? Wollen wir hinnehmen, dass alle anderen dann halt schlecht bezahlt werden, weil sie leider Gottes einen frauenspezifischen und damit automatisch schlechter bezahlten Beruf gewählt haben? Nein! Wir müssen uns fragen: Muss die Bezahlung in diesen Berufen zwingend so schlecht sein? Liebe Kolleginnen und Kollegen, den Lohn bestimmen bei uns in Deutschland die Tarifparteien.
Deshalb appelliere ich an die Tarifparteien:
Nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr! Bewerten Sie frauenspezifische Berufe in den Lohnrunden besser! Sorgen Sie dafür, dass es auch in diesen Branchen branchenspezifische Mindestlöhne gibt! Man kann nicht immer nur mit dem Finger auf andere zeigen und nach der Politik schreien. Hier haben auch die Tarifparteien Verantwortung, und die müssen sie auch wahrnehmen.
Aber auch die Politik kann einiges tun. Wir müssen weiter daran arbeiten, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Wir sind hier auf dem richtigen Weg.
Der Ausbau der Betreuungsinfrastruktur, der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz, das Elterngeld mit den Partnermonaten, die Familienpflegezeit, die Initiativen zur familienbewussten Arbeitszeit und die Programme zum Wiedereinstieg - all das trägt dazu bei, dass beide Partner - ich betone: beide Partner - Beruf und Familie vereinbaren können. Alles das sind Schritte zu einer kontinuierlichen Erwerbsbiografie auch von Frauen.
Es ist aber auch klar - ich denke, das muss uns allen bewusst sein -: Ganz ohne Unterbrechungen wird es nicht gehen. Gerade weil das so ist, weil wir immer Brüche im Lebensverlauf und immer Auszeiten haben werden, ist es wichtig, dass wir das nicht immer als Nachteil sehen. Solche Unterbrechungen sind doch positiv zu bewerten. Sie bringen neue Erfahrungen und neue Kompetenzen mit sich. Deshalb kann ich nur an die Unternehmen appellieren: Nutzen Sie diese Kompetenzen und berücksichtigen Sie diese auch in der Gehaltsstruktur! Ermutigen Sie auch die Männer, sich auf solche Auszeiten, beispielsweise bei der Elternzeit oder bei der Pflegezeit, einzulassen! Denn Lebenskompetenz ist doch auch im Unternehmen oft viel wichtiger als dröges Fachwissen.
Ein weiteres Thema für Politik und Wirtschaft gleichermaßen: Sorgen wir endlich dafür, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen! Die Debatte über Wege dorthin führen wir derzeit.
Schließlich müssen wir gemeinsam auch dafür sorgen, dass tatsächliche Diskriminierung aufgedeckt wird. Auch das liegt letztlich im Interesse der Unternehmen selbst; die Kollegin hat darauf hingewiesen. Mit Logib-D gibt es ein Instrument, das die entsprechende Transparenz in einem Betrieb herstellt. Mehrere Hundert Unternehmen haben schon daran teilgenommen. So kann man echte Diskriminierung erkennen und wirksam bekämpfen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, es lohnt sich, die Ursachen der Entgeltungleichheit genauer unter die Lupe zu nehmen; denn nur dann gelangen wir zu einer differenzierten Sicht der Dinge und zu differenzierten Lösungen. Es sind viele kleine Stellschrauben, mit denen wir die Rahmenbedingungen für ein verbessertes Einkommen von Frauen beeinflussen können; hier können wir intelligent und mit vielen kleinen Schraubenziehern arbeiten. Den Vorschlaghammer staatlicher Regulierung brauchen wir dazu nicht.
Vielen Dank.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Das Wort hat die Kollegin Sabine Zimmermann für die Fraktion Die Linke.
Sabine Zimmermann (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Liebe Kollegin Schön, ich muss Ihnen sagen: Seit 100 Jahren warten die Frauen auf gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit und kämpfen dafür.
Wie lange wollen Sie noch an die Wirtschaft appellieren, damit das endlich Wahrheit wird? Das ist mir aus Ihrem Vortrag weiß Gott nicht klargeworden.
Die Frau Bundeskanzlerin hat zum Internationalen Frauentag eine Videobotschaft versandt. Sie plauderte ein wenig über ihre Kindheitserinnerungen in der DDR und darüber, welche Blumen sie am 8. März ihrer Mutti schenkte. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition, kennen Sie die Lieblingsblumen Ihrer Kanzlerin? Ich helfe Ihnen ein wenig, weil Sie mich so anschauen. Es sind Freesien. Ich denke, es wäre besser gewesen, wenn die Kanzlerin in der Videobotschaft ein wenig weiter zurück in die Geschichte geblickt und die Begründerinnen des Frauentages und ihre Motive benannt hätte.
Es waren nämlich die Arbeiterbewegung und ihre Vorkämpferinnen, allen voran Clara Zetkin. Als im August 1910 in Kopenhagen die II. Internationale Sozialistische Frauenkonferenz beschloss, einen internationalen Frauentag durchzuführen, stellte sie zugleich klar - ich zitiere -:
Es muss auch erkannt werden, dass der Weg zur Gleichstellung der Frau mit dem Manne nur durch die ökonomische Gleichstellung der Frau geschehen kann.
Ich denke, nur das ist der richtige Weg, nicht Appelle an die Wirtschaft.
Mehr als 100 Jahre danach ist diese Forderung so aktuell wie damals. Frauen erhalten 23 Prozent weniger Lohn als Männer. Die Verdienstunterschiede in Deutschland sind so groß wie nie und wie nirgendwo sonst in Europa. Und: Sie sind über die letzten Jahre noch gewachsen. Das ist ungerecht. Ich denke, es ist wichtig, dass man als Antwort darauf auch gesetzliche und staatliche Regelungen schafft.
70 Prozent aller Beschäftigten im Niedriglohnsektor sind Frauen. Das kommt nicht allein daher, dass Frauen oft Teilzeit arbeiten. Nein, rund 7,3 Millionen Frauen arbeiten Vollzeit. Von ihnen erhalten aber 2,5 Millionen Frauen einen Lohn unterhalb der Niedriglohnschwelle. Ich frage Sie: Ist das gerecht? Das heißt, jede dritte Vollzeit arbeitende Frau ist davon betroffen. Meine Damen und Herren der Koalition, lassen Sie sich diese Zahl bitte noch einmal auf der Zunge zergehen: Jede dritte Vollzeit arbeitende Frau arbeitet im Niedriglohnbereich. Das ist ein Skandal.
Deshalb ist klar: Wir brauchen in Deutschland endlich einen gesetzlichen Mindestlohn.
Sie wehren sich dagegen. Der Skandal ist, dass der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland nicht eingeführt wird. In Europa gibt es in 20 von 27 Ländern einen gesetzlichen Mindestlohn. Das kann doch nicht schlecht sein.
Das wäre ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
Natürlich reicht der Mindestlohn nicht aus. Schaut man sich die Ursachen für die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern an, dann wird schnell deutlich: Es geht um eine direkte Diskriminierung, wenn Frauen am gleichen Arbeitsplatz in eine niedrigere Lohn- bzw. Gehaltsgruppe eingestuft werden als Männer. Um die riesige Lohnlücke zwischen Frauen und Männern zu verringern, ist aber mehr nötig. In den traditionellen Frauenbranchen wie dem Einzelhandel oder auch dem Friseurhandwerk wird deutlich schlechter bezahlt. Hinzu kommt der hohe Anteil von Frauen in Teilzeit und Minijobs. Zu zwei Dritteln sind die Lohnunterschiede aus diesen genannten Gründen zu erklären.
Aber statt dieses Problem anzugehen, hat Ihre Arbeitsmarktpolitik der letzten Jahre uns in Deutschland in eine Situation gebracht, in der sich dieses Problem noch mehr verschärft hat: Mit den Hartz-Gesetzen wurden prekäre Beschäftigungsverhältnisse gefördert und der Niedriglohnsektor weiter ausgebaut. Vor allem die typischen Frauenbranchen sind davon betroffen. Deshalb ist zu befürchten: Wenn es nicht zu einem Kurswechsel kommt, wird sich diese Ungleichbehandlung mit der steigenden Frauenerwerbstätigkeit weiter verfestigen oder sogar verstärken. Bei diesem Punkt, meine Damen und Herren von der SPD, hat Ihr Antrag leider eine Leerstelle.
Die Linke fordert: Ein Entgeltgleichheitsgesetz, das seinem Namen gerecht wird, muss das Problem der prekären, niedrig entlohnten und unfreiwilligen Teilzeitarbeit angehen. Das ist der richtige Weg.
Die Wirtschaftsjournalistin Julia Dingwort-Nusseck - sie war von 1976 bis 1988 Präsidentin der Landeszentralbank Niedersachsen; sie ist also nicht dem linken Spektrum zuzuordnen - befürchtete zu Recht:
Wenn es in dem bisherigen Tempo weitergeht, werden wir im Jahre 2230 den Zustand der Gleichberechtigung von Mann und Frau erreicht haben.
Ich hoffe, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass diese düstere Prognose nicht wahr wird.
Danke.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Die Kollegin Sibylle Laurischk hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion.
Sibylle Laurischk (FDP):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Einkommen von Frauen liegt in Deutschland im Schnitt um fast ein Viertel unter dem der Männer. Zudem ist die Lohnlücke in Deutschland im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn deutlich höher. Sowohl aus Art. 3 Grundgesetz als auch aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz folgt ein Verbot der Lohndiskriminierung. Art. 3 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz verpflichtet uns, dagegen etwas zu tun.
Im Koalitionsvertrag haben wir uns zur Umsetzung des Prinzips ?gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ verpflichtet. Die Umsetzung dieses Ziels ist auf einem guten Weg. Dabei wollen wir aber keine gesetzlichen Regelungen zur Überwindung der Entgeltungleichheit schaffen, wie es die SPD in ihrem Antrag fordert. Wir als FDP setzen auf Selbstverpflichtung und sind der Meinung, dass Selbstverpflichtungen letztendlich auch eine sehr viel nachhaltigere Möglichkeit darstellen,
solche Ungleichbehandlungen zu beseitigen.
Die bürokratischen Vorschläge der SPD würden Kosten verursachen und die Wirtschaft erneut belasten.
Zu dem Argument der Linken, dass eine gesetzliche Regelung, die es in 20 Ländern in Europa gibt, ein Plus darstelle, kann ich nur sagen:
Die deutsche Wirtschaft ist gerade deshalb leistungsfähig, weil sie solche Verpflichtungen nicht zu tragen hat.
Wir werden uns dafür einsetzen, dass das nicht kommt.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Laurischk, möchten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Beck zulassen?
Sibylle Laurischk (FDP):
Nein, ich möchte fortfahren.
- Wir sind dabei, das zu ändern; das wissen Sie. Das brauchen wir in diesem Zusammenhang nicht zu diskutieren.
Wir haben allerdings zu klären, auf welche Ursachen die noch immer bestehende Ungleichbehandlung zurückzuführen ist. Das liegt im Wesentlichen an folgenden Punkten:
Typische Frauenberufe werden trotz individueller Lohnverhandlungen schlechter bewertet und vergütet als klassische Männerberufe. Hier wäre natürlich auch vonseiten der Gewerkschaften im Rahmen der Tarifautonomie noch einiges zu tun.
Frauen sind in bestimmten Berufen, Branchen und auf höheren Stufen der Karriereleiter unterrepräsentiert.
Vor allem ist trotz höherer und besserer Schulabschlüsse und einer fachlich hervorragenden Ausbildung das Arbeitszeitvolumen bei Frauen geringer als bei Männern. Familienbedingte Unterbrechung der Erwerbstätigkeit ist ein weiterer Faktor. Die hohe Anzahl von Teilzeit arbeitenden Frauen und von Frauen in niedrig bezahlten und gering qualifizierten Arbeitsverhältnissen trägt nach wie vor zum Fortbestehen der Lohndiskriminierung von Frauen bei.
Die Überwindung der Rollensterotype bei Ausbildung und Beschäftigung sowie ein modernes Rollenverständnis gerade der Männer würden einen erheblichen Beitrag zur Überwindung der Entgeltdiskriminierung leisten.
Auffällig in Bezug auf das unterschiedliche Lohngefüge zwischen Männern und Frauen ist, dass ein deutliches Gefälle zwischen West- und Ostdeutschland besteht. Frauen, die in Ostdeutschland arbeiten, verdienen zwar ebenfalls weniger als ihre männlichen Kollegen, aber die Lohnlücke ist dort deutlich geringer als im Westen. Dies wird wohl mit der besseren Kinderbetreuungsinfrastruktur zusammenhängen. Deswegen ist für uns der Ausbau der Kinderbetreuung mit dem Ziel, bis 2013 für bundesweit durchschnittlich 35 Prozent der unter dreijährigen Kinder Betreuungsplätze zu haben, eine der wesentlichen Maßnahmen, die wir zur Überwindung des Gender Pay Gap verfolgen.
Ein weiteres wichtiges Instrument zur Beseitigung der Lohnlücke ist die Einführung des Logib-D-Verfahrens. Dies eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, in einem freiwilligen Selbsttest zu untersuchen, inwieweit Entgeltgleichheit im Unternehmen sichergestellt ist. Dieses Verfahren wurde gut angenommen. Es ist ein Instrument, das im Rahmen der Selbstverpflichtung, auf die wir setzen, Wirkung zeigt.
Darüber hinaus haben wir zur Bekämpfung des Gender Pay Gap das Unternehmensprogramm ?Erfolgsfaktor Familie“ zur Durchsetzung einer familienbewussten Personalpolitik und das Aktionsprogramm ?Perspektive Wiedereinstieg“ auf den Weg gebracht, welches Frauen nach einer familienbedingten Erwerbsunterbrechung die Reintegration ins Berufsleben erleichtert.
Die Überwindung der Lücke zwischen den Löhnen von Frauen und Männern ist ein wichtiges gleichstellungspolitisches Signal. Dafür ist ein Umdenken in der Gesellschaft genauso erforderlich wie das Aufbrechen von Rollenbildern und das Selbstverständnis eines modernen Familienbildes.
Wir haben in diesem Jahr den 100. Internationalen Frauentag gefeiert. Ich verweise ich nochmals darauf, dass unser Grundgesetz in Art. 3 Abs. 2 ausführt:
Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
Meine Damen und Herren, daran arbeiten wir.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Monika Lazar hat jetzt das Wort für Bündnis 90/Die Grünen.
Monika Lazar (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Forderung ?Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit“ begleitet uns schon lange. Wir finden sie in den Römischen Verträgen von 1957, und Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes haben Sie gerade angesprochen, zu Recht. Sie haben ja das Zitat gebracht, in dem steht, dass sich der Staat dafür einsetzen soll. Er hat also eine entsprechende Verpflichtung. Von daher gebe ich den Hinweis, dass wir nicht allein auf Freiwilligkeit setzen sollten. Wir als Gesetzgeber, im Parlament, haben durchaus die Aufgabe, entsprechende Rahmenbedingungen zu setzen.
Es gibt ferner das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Wir könnten also der Meinung sein, wir hätten genug Gesetze. Aber wir kennen die Zahlen: Seit Jahren beträgt der durchschnittliche Lohnunterschied 23 Prozent. Damit sind wir im EU-Vergleich auf einem hinteren Platz. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass wir uns von dort wegbewegen.
Wir wissen - das wurde schon ausgeführt -: Es handelt sich hierbei um eine komplexe Materie. Beim Gender Pay Gap kommt einiges zusammen: die hohe Teilzeitquote bei Frauen, die häufigeren und längeren Erwerbsunterbrechungen wegen der Erziehung der Kinder oder der Pflege von Angehörigen, die geringere räumliche Mobilität von Frauen. Dazu gehört aber auch die sogenannte vertikale Polarisation auf dem Arbeitsmarkt. Das bedeutet nichts anderes, als dass Frauen in Führungspositionen unterrepräsentiert sind und selbst dort dramatisch weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen.
Natürlich ist es immer noch so, dass junge Frauen und Mädchen schlecht bezahlte Berufe wählen und sich auf deutlich weniger Berufe und Branchen als Männer konzentrieren. Nun könnten wir, wie es Ministerin Schröder gerne macht, sagen: Selber schuld! Die jungen Frauen können ja Maschinenbau studieren und den Beruf in den Vordergrund stellen. - Aber so einfach ist das nicht. Wir brauchen durchaus vieles: bessere Kinderbetreuung, mehr Männer, die ihre Vaterrolle auch zeitlich stärker ausfüllen,
flexible Arbeitszeiten gerade für Eltern und selbstverständlich eine andere Arbeitskultur. Ich denke, darin sind wir uns im ganzen Hause einig.
Aber das ist nicht alles. Der verschieden hohe Lohnunterschied in Ost- und Westdeutschland wurde schon angesprochen. In Westdeutschland beträgt er 25 Prozent, in Ostdeutschland 6 Prozent. Das liegt unter anderem daran, dass die ostdeutschen Männer weniger verdienen. Es gibt sicherlich auch einige westdeutsche Männer, die weniger verdienen würden. Der geringere Unterschied im Osten ist aber nicht nur der besseren Kinderbetreuung geschuldet. Es ist nämlich auch so, dass die große Mehrheit der ostdeutschen Frauen wirtschaftlich für sich selbst verantwortlich ist; das ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Die Hausfrauenehe spielt keine Rolle mehr; es gibt sie nur zu einem geringen Prozentsatz. Bei knapp drei Vierteln aller Paare in Ostdeutschland sind beide Partner erwerbstätig. Auch der Anteil der Teilzeitarbeit ist wesentlich geringer als in Westdeutschland. Die Frauen im Osten sind also aufgrund ihrer Ausbildung hochqualifiziert, und sie wollen mehr und auch eher Vollzeit arbeiten.
Interessant ist auch, dass es einen Unterschied zwischen Stadt und Land gibt. In ländlichen Regionen ist die Lohnlücke um fast 10 Prozent größer als in der Stadt. Auch wenn die Ursachen noch nicht ausreichend erforscht sind - entsprechende Forschungen laufen -, gibt es einige Auffälligkeiten: Die Frauen auf dem Land nehmen noch häufiger Minijobs an, sind häufiger Hinzuverdienerinnen, und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist wegen der größeren räumlichen Entfernungen meistens noch schwieriger zu bewerkstelligen.
Zu den Führungspositionen - das habe ich vorhin schon angesprochen - gibt es eine aktuelle Studie vom WSI, nach der der Lohnunterschied 18 bis 24 Prozent beträgt. Er ist also kein bisschen geringer, obwohl die Frauen sicherlich genauso qualifiziert sind.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wir sind uns in vielem einig, was Ihren Antrag und auch die Eckpunkte betrifft, die Sie jetzt für ein Entgeltgleichheitsgesetz vorlegen. Viele dieser Forderungen finden Sie auch in unserem Antrag ?Frauen verdienen mehr“, den wir im März hier im Plenum diskutiert haben. Auch wir wollen den Ausbau der Verbandsklage. Ich denke, das ist wirklich ganz wichtig. Wir wollen die Tarifparteien zu einer diskriminierungsfreien Arbeitsbewertung verpflichten. Wir brauchen endlich Transparenz bei den Entgelten. Wir möchten auch erreichen, dass sich die Beschäftigten über ihr Arbeitsentgelt und dessen Zusammensetzung austauschen dürfen. Ich denke, das ist sehr wichtig. Klauseln in Arbeitsverträgen, die das verbieten, sind nicht rechtmäßig.
Notwendig ist in diesem Zusammenhang selbstverständlich auch ein flächendeckender Mindestlohn. Dass Frauen einen Anteil von knapp 70 Prozent an den Niedriglohnbeschäftigten haben, hat die Kollegin bereits ausgeführt.
Neben den gesetzlichen Regelungen für die Entgeltgleichheit brauchen wir dringend ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft. Ich denke, da sind wir auch sehr nahe beieinander.
Der Equal Pay Day war in diesem Jahr der 25. März. Ich würde mich sehr freuen, wenn es an diesem Tag mehr als nur warme Worte geben würde, warme Worte, wie sie unter anderem in der lauen Pressemitteilung der Ministerin Schröder standen. Ich würde mich freuen, wenn wir da gemeinsam vorankommen, damit es mehr gibt als nur warme Worte oder Selbstverpflichtungen. Ich denke, wir sollten auch unserem Anspruch als Gesetzgeber gerecht werden und die Rahmenbedingungen vorgeben. Deshalb lade ich die Koalitionsfraktionen herzlich dazu ein, mit uns gemeinsam den Weg zu gehen, nicht nur auf Freiwilligkeit zu setzen, sondern den Rahmen selber vorzugeben.
Vielen Dank.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Ewa Klamt hat jetzt für die CDU/CSU-Fraktion das Wort.
Ewa Klamt (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Gleichberechtigung ist keine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Sie muss - immer noch - in unserer Gesellschaft ausgebaut und gelebt werden. Frauen meiner Generation können bei diesem Thema aufgrund langjähriger Erfahrungen mitreden. Wir wissen, was wir hier einfordern wollen.
Die existierende Lohnungleichheit in Deutschland ist eine der ungelösten Herausforderungen. Die entscheidende Frage ist: Was sind die Ursachen der Lohnlücke, und wie können wir sie bekämpfen? Wir wissen, dass die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen drei Kernursachen hat: Erstens. Frauen sind in bestimmten Berufszweigen und Branchen unterrepräsentiert. Zweitens. Qualifikationen, die Frauen in das Erwerbsleben einbringen, werden häufig schlechter bewertet. Drittens. Frauen steigen öfter und länger aus dem Erwerbsleben aus.
Wir wissen zum Beispiel, dass Frauen aus circa 350 Ausbildungsberufen im Wesentlichen nur zehn aus dem Dienstleistungs- und Sozialbereich auswählen.
Die Wahl der Studiengänge zeigt ein ähnliches Bild: Männer fokussieren sich auf die technisch-naturwissenschaftlichen Zweige, Frauen wählen vermehrt sprach- oder sozialwissenschaftliche Studiengänge. Frauen und Männer gehen also bereits zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn unterschiedliche Wege; sie richten ihre Berufswahl nach unterschiedlichen Kriterien aus. Das Problem ist jedoch, dass jeder Einzelne individuell entscheidet. Wir als Gesetzgeber können vom Kindergarten bis hin zur allgemeinen schulischen Bildung versuchen, Frauen frühzeitig für technische oder naturwissenschaftliche Berufe zu begeistern.
Deshalb sind die Programme des Familienministeriums wie ?Komm, mach MINT“, der Girls‘ Day, aber auch ?Neue Wege für Jungs“ der richtige Ansatz, das Berufswahlspektrum von jungen Frauen und Männern zu erweitern.
Der zweite Aspekt ist die Tatsache, dass nach wie vor Frauen und ihre Qualifikationen im Berufsleben schlechter bewertet werden.
So sehen Unternehmen Frauen häufig als Unsicherheitsfaktor, da sie dem Arbeitgeber durch Elternzeit und Erziehungspausen nur bedingt zur Verfügung stehen. Ihre Tätigkeit wird, bewusst oder unbewusst, nach dem Ausfallrisiko bewertet. Entscheidend ist daher in den Betrieben ein Bewusstseinswandel dahin gehend,
das Potenzial und die Fähigkeiten von Frauen besser zu nutzen. Der Fachkräftemangel und der demografische Wandel zeigen vielen Unternehmen bereits heute die richtige Weichenstellung auf. Wer dringend benötigte Fachkräfte haben und halten möchte, muss das Potenzial von Frauen nutzen. Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit wird darüber entscheiden, wer zukünftig in diesem Land über genügend Fachkräfte verfügt.
Der dritte Aspekt ist die familienbedingte Unterbrechung der Erwerbstätigkeit. Es sind nach wie vor mehrheitlich junge Frauen, die sich der Kindererziehung widmen und dafür ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen. Nach ihrer Rückkehr ins Berufsleben reduzieren sie verstärkt ihre Stundenzahl; sie nehmen besonders häufig Teilzeitmodelle in Anspruch. Statistiken und Studien belegen, dass insbesondere in Deutschland die Erwerbsunterbrechung ein maßgeblicher Faktor der ungleichen Entlohnung ist. Insofern trifft der Satz des SPD-Antrages zu, dass es Aufgabe der Politik ist, Prozesse in Gang zu setzen und bei der Überwindung typischer Blockaden zu helfen. Das von der CDU vorgeschlagene ?audit berufundfamilie“ ist ein richtiger Ansatz. Die Politik zeigt hier den Unternehmen Lösungswege auf. So kann sich ein gesellschaftlicher Bewusstseinswandel entfalten. Unternehmen mit einem großen Frauenanteil nehmen dies heute in hohem Maße an. Sie verzichten schon aus ökonomischen Gründen nicht mehr auf gut ausgebildete Frauen. Fakt ist: Wir sind keine Erziehungsdiktatur. Auch wenn wir uns wünschen, dass sich mehr Männer in Familienarbeit und Kinderbetreuung einbringen, bleibt die Entscheidung, welcher Partner sich der Kindererziehung widmet, eine individuelle Entscheidung.
Die Hoheit über die Kinderbetten zu erlangen, wie es der ehemalige Arbeitsminister Olaf Scholz verlangte, ist nicht Ziel unserer CDU/CSU-Politik.
Für mich sind alle drei geschilderten Problembereiche komplex miteinander verknüpft. Klar ist, dass wir die Ungleichheit in der Entlohnung ursachengerecht angehen müssen. Fest steht auch, dass gesellschaftlicher Wandel nicht per Gesetz verordnet werden kann. Aber mit dem Ausbau der Kinderbetreuung, dem Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz, dem Projekt ?Perspektive Wiedereinstieg“ und dem Elterngeld für beide Elternteile hat die CDU die Weichen richtig gestellt.
Der Unterschied in der Lohnlücke zwischen Deutschland Ost und Deutschland West zeigt eines: Die Rahmenbedingungen von Kinderbetreuung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind entscheidend; eine Kollegin hat das bereits genannt. Weil in Ostdeutschland 61 Prozent der Frauen nach einer Kinderpause in eine Vollzeitbeschäftigung zurückkehren, beträgt der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern hier nur 6 Prozent, während er im Westen bei 24 Prozent liegt. Das zeigt, dass ein gut ausgebautes Kinderbetreuungssystem die Rückkehr in die Vollbeschäftigung ermöglicht und für mehr Entgeltgleichheit sorgt.
Der Antrag, den die SPD heute vorlegt, wird keiner der genannten Herausforderungen gerecht. Ihre Forderungen, von denen ich nur einige wenige zitieren möchte, sehen folgendermaßen aus:
... die Unternehmen werden aufgefordert, einer behördlichen Stelle anonymisierte, geschlechtsspezifisch aufgeschlüsselte betriebliche Entgeltdaten in Form eines betrieblichen Entgeltberichts in regelmäßigen Abständen vorzulegen;
- ich zitiere weiter -
die behördliche Stelle prüft den Entgeltbericht auf Verdachtsmomente, die auf eine geschlechtsspezifische Ungleichbehandlung hinweisen. Das Ergebnis ist betriebsöffentlich zugänglich zu machen;
die Unternehmen stellen sicher, dass bei der Erstellung des Berichts Betriebs- und Personalräte, Gleichstellungsbeauftragte und Beschäftigte sowie Tarifvertragsparteien einbezogen werden.
- Liebe Frau Humme, wenn ich mir vorstelle, was das an bürokratischem Aufwand für die rund 3,4 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen sowie für die Selbstständigen bedeutet, stellt sich mir die Frage, ob sie demnächst überhaupt noch Frauen einstellen.
Ich sage Ihnen: Wir brauchen weder neue Behördenmitarbeiter, die unzählige Daten sammeln und verarbeiten, noch brauchen wir neue Berichtspflichten, die zuallererst unseren Mittelstand treffen.
Die Quintessenz einer lösungsorientierten und realistischen Gleichstellungspolitik muss sein
- Schreien macht nichts besser; Sie können für Ihre Fraktion reden -, die sozialen Risiken in den Lebensläufen und Erwerbsbiografien der Menschen zu erkennen und familien-, gleichstellungs- und kinderfreundliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Dann erreichen wir, dass Frauen der Wiedereinstieg in sozialversicherungspflichtige Vollzeitjobs gelingt und die wesentlichen Ursachen für eine fehlende Entgeltgleichheit beseitigt werden.
Statt immer neue Gesetze zu erfinden, sollten auch Sie, liebe Kollegen von der SPD, erkennen, dass wir uns auf unsere Kernaufgabe konzentrieren müssen, nämlich auf die Schaffung von Grundlagen und Rahmenbedingungen.
Ich danke Ihnen.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Sigmar Gabriel gebe ich jetzt als erstem Mann in der Debatte das Wort. Sollte sich die Entgeltgleichheit bei uns in Redezeit ausdrücken, haben die beiden Männer sehr gut verhandelt. Er spricht für die SPD-Fraktion.
Sigmar Gabriel (SPD):
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir sind uns aber sicher einig, dass die Herstellung von Gleichberechtigung keine alleinige Aufgabe der Frauen ist.
Meine Damen und Herren! Ich will den Argumenten begegnen, dass das nur für mehr Bürokratie sorgen würde, dass dies eine Aufgabe der Tarifvertragsparteien sei und die Politik sich herauszuhalten habe. Ich lese Ihnen einen Satz vor, um den es hier eigentlich geht:
Niemand darf wegen seines Geschlechts … benachteiligt oder bevorzugt werden.
Das ist einer der fundamentalen Sätze der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Recht und Gesetz in Deutschland durchzusetzen, ist nicht die Aufgabe von Privatpersonen, auch nicht von Tarifvertragsparteien, sondern die Aufgabe des Gesetzgebers, der Exekutive, des Staates. Deswegen geht es hier um staatliches Handeln und nicht um Fragen der Bürokratie oder um Aufgaben von Privatpersonen.
Es geht auch nicht um Bewusstseinsbildung. Es geht um Recht und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt und um die Durchsetzung unserer Verfassung. Es geht nicht darum, dass den Unternehmen ein Lernauftrag erteilt werden soll. Frau Schön, es geht auch nicht um ein Privatvergnügen. Es ist nicht egal, ob man das macht oder nicht. Es geht darum, dass wir der Verfassung unseres Landes Geltung verleihen. Es ist einer der gröbsten Verstöße gegen die Verfassung, dass Frauen und Männer in diesem Land für gleiche Arbeit ungleich bezahlt werden. Das ist einer der größten sozialpolitischen Skandale in dieser Republik.
Damit wir uns hier verstehen: Wir haben diesen Antrag schon zur Zeit der Großen Koalition eingebracht. Frau Merkel und die nicht anwesende Familienministerin bzw. ihre Vorgängerin haben ihn im Duett abgelehnt. Für uns ist das keine neue Erkenntnis. Es ist übrigens spannend, wie wichtig die zuständigen Kabinettsmitglieder diese Debatte offensichtlich finden.
Leistung lohnt sich nicht für Frauen in Deutschland. Es geht darum, Frau Kollegin Schön, dass wir der sozialen Marktwirtschaft Geltung verleihen und dass sich Leistung lohnt. Es ist übrigens ein interessanter Meinungswandel, dass Sie das für die Aufgabe der Tarifvertragsparteien halten; denn ich habe noch gut in Erinnerung, dass CDU/CSU und FDP die Tarifvertragsfreiheit infrage stellen und den Flächentarifvertrag abschaffen wollten. Aktuell verhindern Sie im Kabinett ein Gesetz über die Tarifeinheit. Sie zerstören die Tarifverträge und sagen gleichzeitig, dass sich die Tarifvertragsparteien um die Gleichbehandlung von Männern und Frauen kümmern sollen. Das kennzeichnet Ihre Politik in diesem Bereich.
- Wenn das reine Polemik ist, dann beschließen Sie endlich die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Sie wissen, dass 70 Prozent der Niedriglöhner in Deutschland Frauen sind. Machen Sie das doch endlich!
- Herr Kollege Kauder, ich weiß, dass Sie wenig Zugang zu diesem Lohnsektor haben. Nein, es geht darum, dass für Männer und Frauen eine Untergrenze eingeführt wird. Wenn wir wissen, dass in weiten Teilen Deutschlands keine Tarifverträge gelten, weil sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gar nicht mehr trauen, sich zu organisieren, dann muss der Staat eine untere Grenze einführen. Das wussten Ihre Vorgänger Ludwig Erhard und andere besser als Sie heute.
Herr Kollege Kauder, meine Damen und Herren von der Regierungskoalition, es geht nicht an, dass die Bundeskanzlerin das zum Privatproblem der Frauen macht. Ich zitiere einmal aus einem Interview mit der Emma. Dort rät die Bundeskanzlerin Frauen, die weniger als ihre männlichen Kollegen verdienen, ?selbstbewusst zum Chef zu gehen und zu sagen: Da muss sich was ändern!“
Wo sind wir eigentlich hingekommen? Es geht doch nicht darum, dass die betroffenen Frauen aufgefordert werden, etwas zu tun. Es ist die Aufgabe der Politik, einen Missstand, der Millionen von Frauen betrifft, zu beseitigen. Das ist unsere Aufgabe. Das geht auch Sie an. Sie können sich nicht ständig vor der Verantwortung drücken.
Ich sage hier ganz offen: Lernen Sie doch auch von den Fehlern der Sozialdemokratie. Wir haben auch einmal gedacht, dass Selbstverpflichtungen helfen. Heute wissen wir: Sie helfen nicht.
Sie möchten jetzt eine freiwillige Frauenquote in Aufsichtsräten und Vorständen einführen. Ich stelle mir einmal vor, wie wir zu den DAX-Vorständen und Aufsichtsräten sagen: Jungs, ihr müsst jetzt zu 40 Prozent freiwillig auf den Millionenjob verzichten, damit Platz für die Frauen ist. - Wenn Sie glauben, dass das funktioniert, dann glauben Sie auch, dass man mit Gänsen über Weihnachten diskutieren kann.
Das kann man nicht ohne den Gesetzgeber durchsetzen. Es ist schlimm, dass die Kanzlerin diese Entwicklung, die bei Ihnen durch Frau von der Leyen in Gang gekommen war, wieder gestoppt hat. Es gibt immer nur Window Dressing in der CDU/CSU und FDP. Wenn es darauf ankommt, schlagen Sie sich in die Büsche.
Vielleicht hilft es Ihnen ja, sich die Realität in den unterschiedlichen Lohnsegmenten in Deutschland anzuschauen; es geht dabei nicht nur um den Niedriglohnsektor. Sie scheinen auch in diesen Bereichen ein Wahrnehmungsproblem zu haben. Ihre Familienministerin sagte in einem Interview:
Wir können den Unternehmen nicht verbieten, Elektrotechniker besser zu bezahlen als Germanisten.
Darum geht es aber nicht. Erklären Sie Ihrer Familienministerin bitte, dass es nicht darum geht, unterschiedliche Gehälter zu nivellieren, sondern dass man etwas dagegen tun muss, dass Ingenieure besser bezahlt werden als Ingenieurinnen. Das muss doch die Politik interessieren.
Der Lohnunterschied im Beruf der Ingenieure beträgt zwischen den Männern und Frauen 17 Prozent. Wie erklären Sie das einer fleißigen und gut qualifizierten Frau?
Nun komme ich zum Größten, das Sie sich bisher geleistet haben. Ihre Frauenministerin sagte über die Frauen:
Zumindest müssen sie sich darüber bewusst sein, dass mit bestimmten Berufswünschen gewisse Einkommensperspektiven verbunden sind.
Das würde bedeuten, dass es an der Berufswahl liegt, dass Frauen in Teilzeit arbeiten und schlechter bezahlt werden. Es liegt aber daran, dass sie häufig keine ausreichenden Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder haben. Deswegen müssen sie in Teilzeit gehen.
Es liegt auch daran, dass Sie nicht bereit sind, dafür zu sorgen, dass in Deutschland vernünftige Löhne gezahlt werden. Deshalb werden Frauen in diese Bereiche gedrängt.
Wenn Sie sagen, dass es an der Wahl des falschen Berufs liegt, dann schauen Sie doch einmal typische Frauenberufe, in denen nur oder im Wesentlichen Frauen beschäftigt sind, an. Drei Viertel der Bürokaufleute sind Frauen; das ist also deutlich die Mehrheit. Bürokauffrauen verdienen trotzdem 15 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Oder schauen wir ins Bankgewerbe. Bankkauffrauen bekommen im Monat im Durchschnitt 700 Euro weniger als ihre männlichen Kollegen. Bemerkenswert ist auch ein Blick in die soziale Wirklichkeit der oberen Gehaltsgruppen. Die Zahlen zeigen, dass auch Frauen in Führungspositionen für die gleiche Tätigkeit deutlich weniger Geld bekommen. Auf der Ebene der Hauptabteilungsleiter verdienen Frauen ein Drittel weniger als ihre männlichen Kollegen. Da sagen Sie: Fangen wir mit der Bewusstseinsbildung an! Warten wir auf die Bewusstseinsbildung in den Unternehmen! - Nein, wir sagen ganz klar: Das ist eine Aufgabe, der sich die Politik stellen muss. Wir sind dafür verantwortlich, dass Recht und Gesetz in Deutschland eingehalten werden. Das ist keine Frage der Freiwilligkeit.
Immer wenn es konkret wird, ist von Ihren Schaufensterreden nichts mehr zu hören. Sie fallen den Frauen regelmäßig in den Rücken, wenn es konkret wird.
Das war übrigens auch bei den Hartz-IV-Verhandlungen der Fall. Als wir gefordert haben, die Beschäftigten in der Leih- und Zeitarbeit genauso zu behandeln wie die Stammbelegschaften, wussten wir doch, dass davon viele Frauen betroffen wären, die dann vernünftig bezahlt worden wären. Sie haben sich dagegen gewehrt.
Vielleicht haben auch noch nicht alle mitbekommen, wie Ihre Definition von Equal Pay ist. Sie haben zunächst einen Equal-Pay-Day ausgerufen. Nächtens hat dann die FDP mit Zustimmung der Union folgendes Modell erarbeitet: Equal Pay - gleicher Lohn für gleiche Arbeit - soll schon ab dem ersten Tag gelten, wenn der Betrieb, in den ein Leiharbeitnehmer verliehen wird, schlechter bezahlt, als es der Tarifvertrag in der Zeitarbeit vorsieht. Wenn der Betrieb besser bezahlt als in der Zeitarbeit vorgesehen, dann - so war Ihr Vorschlag - soll das Prinzip ?gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ erst nach neun Monaten gelten. Wissen Sie, wie ich das nenne? Solche Vorschläge nenne ich asozial, meine Damen und Herren.
- Nein. Beschämend ist, sich immer vor der Verantwortung zu drücken und immer nur von anderen zu fordern, sich zu kümmern.
- Ja, passen Sie auf. Dann gebe ich mir Mühe und zitiere die von Ihnen offensichtlich immer noch, jedenfalls zeitweise, geschätzte Kanzlerin.
Sie sagt: Über Frauenpolitik darf man nicht nur reden. Man muss handeln. -
Na, dann handeln Sie einmal, meine Damen und Herren!
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Der Kollege Beck erhält das Wort, und zwar, wie ich annehme, zu einer Kurzintervention.
Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Nein, ich möchte einen Geschäftsordnungsantrag stellen.
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich finde, in dieser Debatte zum Thema ?Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern“ geht es um eine zentrale Frage der Frauenpolitik.
Ich vermisse nicht nur viele Kolleginnen und Kollegen aufseiten der Koalition,
sondern vor allen Dingen auch die Bundesfrauenministerin.
Wir möchten sie zu dieser Debatte herbeizitieren, weil wir finden: Eigentlich müsste sie dem Haus in dieser Diskussion Rede und Antwort stehen.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Wir kommen zur Abstimmung über diesen Geschäftsordnungsantrag.
Wer dem Antrag auf Herbeizitierung zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Gibt es Enthaltungen? -
Wir sind uns nicht einig.
Deswegen können wir die Mehrheit nur auf andere Weise feststellen. Wir werden jetzt einen Hammelsprung durchführen.
Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, den Plenarsaal zu verlassen.
Wir würden auch noch ein paar Stühle herausstellen lassen für den Fall, dass Sie gern weiter sitzen wollen. Aber vielleicht begeben Sie sich nach und nach hinaus.
Es sind im Verhältnis zu allen anderen noch übermäßig viele FDP-Kolleginnen und -Kollegen im Saal.
Sind alle Türen mit Schriftführern besetzt? - Noch nicht. Es fehlen noch zwei Schriftführer von der Regierungskoalition. - Jetzt sind alle Türen besetzt. Dann eröffne ich die Abstimmung.
Gibt es immer noch Kolleginnen und Kollegen, die vor der Tür stehen und nicht hereinkommen können, weil das Gedränge so groß ist? Ich frage das in Richtung der Schriftführerinnen und Schriftführer. - Jetzt scheint außer den Besucherinnen und Besuchern niemand mehr vor der Tür zu sein.
Dann schließe ich jetzt die Abstimmung und bitte die Kolleginnen und Kollegen Schriftführer, uns das Ergebnis mitzuteilen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben zweierlei festgestellt: Erstens. Der Deutsche Bundestag ist - wie eigentlich immer - beschlussfähig, weil wir bei der Zählung das entsprechende Quorum erreicht haben.
Zweitens. Mit Ja zum Antrag auf Herbeizitierung haben 173 Kolleginnen und Kollegen gestimmt. Mit Nein haben 230 gestimmt. Enthalten hat sich niemand. Damit ist der Geschäftsordnungsantrag abgelehnt.
Wenn jetzt die Gespräche der CSU-Landesgruppe, der Geschäftsführung von Bündnis 90/Die Grünen und von Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion an anderer Stelle fortgesetzt werden - besonders die CSU-Landesgruppe ist hartnäckig; Frau Hasselfeldt identifiziert sich offenbar noch nicht ausreichend mit ihrer neuen Funktion; wenn ich CSU-Landesgruppe sage, hört sie noch nicht automatisch -, setzen wir die Debatte fort.
Erhöhter Aufmerksamkeit erfreut sich jetzt die Kollegin Gabriele Molitor für die FDP-Fraktion.
Gabriele Molitor (FDP):
Frau Präsidentin! Um der Legendenbildung keinen Vorschub zu leisten: Ich wollte nicht vor mehr Publikum sprechen und habe deswegen nicht diese sportliche Aktivität von Ihnen verlangt.
Ich möchte an das anknüpfen, was Sigmar Gabriel hier eben gesagt hat. Ich habe den Eindruck, dass die SPD den Gewerkschaften überhaupt nichts mehr zutraut. Nicht anders ist es zu verstehen, dass Gewerkschaften offensichtlich Tarifverträge abschließen, die nicht diskriminierungsfrei sind. Sie stellen damit der Tarifautonomie ein Armutszeugnis aus. Ich finde es erstaunlich, dass Sie das tun. Wer handelt denn die Tarifverträge aus? Das sind doch die Gewerkschaften. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Gewerkschaften von Ihnen nicht dauernd vorgehalten bekommen wollen, ihren Aufgaben nicht zu genügen. Auch beim Mindestlohn misstrauen Sie der Tarifautonomie und rufen immer nach dem Gesetzgeber.
Was Ihnen zum Erreichen des Ziels ?gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ bei Männern und Frauen einfällt, ist eigentlich sehr enttäuschend. Was Sie verlangen, führt zu zusätzlicher Bürokratie. Unternehmen sollen verpflichtet werden, Entgeltdaten zu melden. Sie wollen eine neue Superbehörde in Deutschland schaffen. Dabei müssen Sie doch sehen, dass das Bürokratiemonster ELENA überhaupt nicht funktioniert hat. Blinde Datensammelwut löst keine Probleme, sondern sorgt nur für mehr Verwaltungsaufwand.
Ich finde außerdem die Wortwahl in Ihrem Antrag unerhört. Sie sprechen von ?Verdachtsmomenten“ bei der Lohnfindung. Ich finde es schon allerhand, dass Sie hier Unternehmen kriminalisieren und von ?Verdachtsmomenten“ sprechen. Ich denke, das ist nicht der richtige Weg.
- In einer Welt, die auch darauf setzt, dass eben nicht pauschal verkürzt wird, wie Sie das auch mit Ihren Statistiken tun,
auf die Sie Bezug nehmen. Denn Sie sagen, angeblich besteht bei Frauen und Männern ein durchschnittlicher Gehaltsunterschied von 23 Prozent. Dabei hält diese Prozentzahl einer differenzierten Überprüfung nicht stand.
Viel interessanter ist in meinen Augen eine aktuelle Studie der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Hier werden erstaunliche Ergebnisse aufgezeigt: Bei jungen Frauen ohne Kinder oder mit kurzen Babypausen ist eine Lohnungleichheit statistisch nicht mehr nachweisbar.
So beträgt etwa die Entgeltlücke zwischen 25- bis 35-jährigen erwerbstätigen Männern ohne Kinder und der vergleichbaren Gruppe von Frauen nur knapp 2 Prozent und fällt damit in den Bereich der statistischen Unschärfe.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin, möchten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Höll zulassen?
Gabriele Molitor (FDP):
Bitte.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Bitte schön.
Dr. Barbara Höll (DIE LINKE):
Frau Kollegin, da Sie ja jetzt vertieft in Zahlen einsteigen, aber als Ausgangszahl auch die Zahl 23 Prozent Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern genannt haben - das ist bekanntlich die Zahl des Statistischen Bundesamts -, möchte ich Sie fragen: Stimmen Sie mir darin zu, dass bereits diese Zahl eindeutig von einem männerzentrierten Denken geprägt ist? Denn wenn man einfach einmal rechnet, eine Frau verdient in der Stunde 15 Euro, ein Mann verdient in einer Stunde 20 Euro, kann man sagen, die Frau verdient ein Viertel weniger, aber man kann natürlich auch sagen, der Mann verdient ein Drittel mehr als die Frau. Das heißt, da ist der reale Lohnunterschied 33 Prozent. Die Frau muss, um das Gleiche wie der Mann zu verdienen, nicht ein Vierteljahr arbeiten, sondern vier Monate. Das heißt also, diese allgemein verbreitete Zahl von 23 Prozent Lohnunterschied, im Durchschnitt gerechnet, verschleiert bereits die Unterschiede, die es in der Bundesrepublik Deutschland gibt, und verschleiert, dass Frauen in der Realität noch viel stärker benachteiligt werden.
Gabriele Molitor (FDP):
Ich gebe Ihnen vollkommen recht, Frau Kollegin, dass Zahlen verschleiern und dass Zahlen nicht immer unbedingt die Tatsachen widerspiegeln. Gerade an diesem Beispiel wird deutlich, dass wichtige Faktoren ausgeblendet sind, nämlich Teilzeitarbeit, unterschiedliche Qualifikation bei den Tätigkeiten, Ausbildungs- und Berufserfahrung. Für eine solche objektive Analyse - da müssen wir ansetzen - reicht der Blick auf die Zahlen nicht aus.
Ich denke, es geht der Antragstellerin, der SPD, im Wesentlichen darum, unter dem Deckmantel der Gleichberechtigung Mindestlöhne einzufordern
- ja -, und das hilft uns an dieser Stelle nicht weiter. Dass dadurch vor allem die durch Frauen ausgeübten Teilzeitbeschäftigungen
sowie die Arbeitsplätze für Geringqualifizierte eingeschränkt werden, scheint Sie nicht zu stören. Das finde ich sehr ignorant.
Hauptsache, man hat ein Gesetz auf den Weg gebracht. Sinn oder Unsinn interessiert an dieser Stelle nicht.
Die Koalitionsfraktionen hingegen wissen, dass wir nur auf der Basis einer vernünftigen Analyse eine sachgerechte Strategie entwickeln können. Diese Analyse muss dann eben auch den gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Beschäftigungsanteil von Frauen ständig erhöht. Auch die Gehälter von Frauen haben sich erhöht. Viele Frauen machen heute Karrieren, von denen ihre Mütter nur träumen konnten. Ich denke, der richtige Weg ist es, auf die qualifizierte Berufsausbildung zu schauen und dafür zu sorgen, dass Mädchen verstärkte Aufmerksamkeit in ihre Ausbildung lenken.
Gerade mir als Mutter ist es besonders wichtig, dass diese Dinge in den Vordergrund gerückt werden.
Auf diesem Weg werden wir weiterkommen. Denn mit gesetzlichen Keulen und Mindestlöhnen ist an dieser Stelle niemandem geholfen, zuallerletzt den Frauen.
Vielen Dank.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Dr. Rosemarie Hein hat jetzt das Wort für die Fraktion Die Linke.
Dr. Rosemarie Hein (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Bundesministerin Frau Schröder, die heute hier nicht anwesend ist,
hat aus Anlass des ersten Internationalen Frauentags vor 100 Jahren erklärt, dass die großen Mauern auf dem Weg zur Geschlechtergerechtigkeit nun eingerissen seien, auch wenn im Alltag noch viel Dickicht sei, das Frauen bremse. Wahrscheinlich hält sie das Dickicht für nicht so wichtig; deshalb ist sie heute nicht da.
Sie sagt, man brauche zur Beseitigung dieses Dickichts nicht den großen Hammer, sondern nur noch feinere Instrumente. Kollegin Schön hat sich vorhin ganz ähnlich geäußert. Ich möchte ein bisschen in dieses Dickicht eintauchen.
Im Durchschnitt ist jeweils ein Drittel der Frauen Vollzeit, Teilzeit oder gar nicht erwerbstätig. Aber schon bei den Frauen mit einem Kind steigt die Teilzeitquote auf fast 44 Prozent an. Bei Familien mit zwei Kindern arbeitet fast die Hälfte der Frauen nur noch Teilzeit. Je höher die Kinderzahl, desto mehr Frauen sind überhaupt nicht erwerbstätig. Nun sagt die Bundesministerin, der Ausbau der Kinderbetreuung helfe Frauen, einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können. Das stimmt. Seit 1996 hat die Zahl der nicht erwerbstätigen Frauen aus Familien mit Kindern tatsächlich deutlich abgenommen. Gleichzeitig ist die Zahl derer, die mit mehr als zwei Kindern Vollzeit arbeiten, deutlich gesunken. Das muss Ursachen haben. Dafür gibt es ein gängiges Erklärungsmuster: Frauen wollen sich in den ersten Jahren eben der Kindererziehung widmen, und das sei schließlich gut so. Aber so einfach ist es nicht. Ich frage Sie: Wieso eigentlich Frauen, wieso nicht Männer?
Die Männer dürfen das inzwischen. Ich frage Sie außerdem: Wie sollen Eltern Vollzeit arbeiten, wenn Ganztagsbetreuungsplätze überhaupt nicht zur Verfügung stehen?
In den östlichen Bundesländern, zumindest in drei der fünf, wollen weit mehr als 38 Prozent der Frauen mit Kindern unter drei Jahren erwerbstätig sein, die meisten Vollzeit. In Sachsen-Anhalt sind es über 50 Prozent. In Sachsen und Thüringen ist das nicht so. Gute Kinderbetreuung, denkt man, spricht für sich. Aber warum ist das in Sachsen und Thüringen anders? Die Antwort ist ganz einfach: Dort gibt es eine Prämie für das Zuhausebleiben. Das nutzen in ihrer Not vor allem Frauen. Familien denken da nämlich ganz praktisch: Derjenige oder diejenige bleibt zu Hause, der oder die am wenigsten zum Familieneinkommen beitragen kann. Nun soll diese ?Zuhausebleibeprämie“ auch noch bundesweit kommen. Frau Ministerin sollte dieses Dickicht wegräumen, wenn sie wirklich für eine Entgeltgleichheit sorgen will.
- Ich benutze hier Zahlen der Bundesregierung, keine anderen.
Ein weiterer Fakt: Bezüglich meines Bundeslandes, Sachsen-Anhalt, weist der Gleichstellungsatlas des Bundesministeriums einen sehr kleinen Einkommensunterschied aus; das ist hier schon erwähnt worden. Da scheint alles in Butter zu sein; die Richtung scheint zu stimmen. Da ich mich zu Hause ein bisschen auskenne, habe ich nachgeschaut. In Sachsen-Anhalt liegen die Lohnunterschiede im produzierenden Gewerbe sogar bei 25 Prozent. Wenn ich so rechne wie meine Kollegin Höll, heißt das: Männer verdienen ein Drittel mehr als Frauen. Wir haben allerdings nicht so viel produzierendes Gewerbe und darum auch nicht so viele hohe Einkommen. Was wir viel haben, ist Niedriglohn, und zwar für Frauen und Männer. Das heißt, weiter nach unten mit dem Lohn geht es kaum noch. Dagegen gäbe es allerdings ein Mittel: gesetzlicher Mindestlohn.
Diesen einzuführen, löst zwar noch nicht alle Probleme, würde aber unmöglich machen, dass man, etwa im Friseurhandwerk, für Stundenlöhne von 3,83 Euro arbeiten muss. Das wäre dann ausgeschlossen. Das wäre ein Beitrag zur Entgeltgleichheit und im Übrigen zur Verbesserung der Einkommen von Männern.
Gestrüpp zu beseitigen, gilt es auch an anderer Stelle. Mädchen und junge Frauen haben in der Bildung im letzten Jahrhundert deutlich aufgeholt. Sie haben mehr höhere Schulabschlüsse und studieren häufiger. In Sachsen-Anhalt erwerben fast 70 Prozent der 18- bis 21-jährigen jungen Frauen eine Studienberechtigung - da ist Sachsen-Anhalt Spitzenreiterin -; aber nur 17 Prozent der Professuren in diesem Land wurden an Frauen vergeben. Frauen finden wir dafür überproportional in Erziehungsberufen, besonders in der frühkindlichen Bildung und in der Grundschule, aber auch in der Pflege. Dort sind Männer eher die Ausnahme. Ich war neulich in einer Grundschule. Sie arbeitet inklusiv - ich hoffe, hier nicht mehr erklären zu müssen, was das bedeutet -; es wird also niemand an eine andere Schule geschickt. 40 Prozent der Kinder, die diese Grundschule besucht haben, setzen ihren Bildungsweg auf dem Gymnasium fort. Ihr Bildungsweg ist also erfolgreich. Die Stunde, die ich miterleben durfte, war beeindruckend. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel: Die Mehrzahl der Kolleginnen und Kollegen aus diesem Hause - ich schließe mich da ein -, die irgendwann schon einmal vor einer Klasse gestanden und unterrichtet haben, wären mit dieser Arbeit vollständig überfordert. Es ist eine Arbeit, die viel Wissen und Können, hohe Flexibilität und hohe Kreativität erfordert. Aber können Sie mir erklären, warum Grundschullehrerinnen so viel schlechter bezahlt werden als Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien, wo im Übrigen auch mehr Männer arbeiten?
Hier hat die Politik Handlungsmöglichkeit; denn hier geht es um die öffentliche Hand, die Arbeitgeberin ist. Sie könnte dieses Problem lösen.
In solchen aus Standesdünkel gewachsenen Einkommenshierarchien entstehen genau jene Ungerechtigkeiten der Bezahlung in dieser Gesellschaft. Das gilt auch für andere soziale Erziehungs- und Pflegeberufe. Das alles sind Frauendomänen. Darum geht unsere Forderung über das ?gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ hinaus. Wir fordern gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit; denn es kann doch niemand erklären, wieso Arbeit in einer Grundschule weniger wert sein soll als an einem Gymnasium. Das ist doch wohl nicht mehr zeitgemäß.
Ich glaube, die Frau Ministerin, die heute Wichtigeres zu tun hat, hat hier noch viel Dickicht hinwegzuräumen. Aber ich fürchte, Frau Schön, mit dem Schraubenzieherchen wird es nichts werden. Dann sind wir damit nämlich noch die nächsten hundert Jahre beschäftigt.
Ich danke schön.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Die Kollegin Rita Pawelski hat jetzt das Wort für die CDU/CSU-Fraktion.
Rita Pawelski (CDU/CSU):
Verehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kennen Sie den Film Und täglich grüßt das Murmeltier? Der TV-Wetteransager Phil Connors durchlebt alptraumhaft immer und immer wieder denselben Tag. Ähnlich geht es mir bei dem Thema ?Gleiche Löhne für Männer und Frauen“. Fast alptraumhaft steigt immer und immer wieder das gleiche Thema hoch.
- Hören Sie doch einfach zu! - Frauen demonstrieren für gleiche Löhne, der Lohnabstand bleibt. Die Fraktionen stellen Anträge, wollen etwas verändern, der Lohnabstand bleibt. Die Regierungen wechseln, der Lohnabstand bleibt. Geändert hat sich inzwischen die Bezeichnung. Es heißt oftmals nicht mehr ?Entgeltgleichheit“, sondern ?Equal Pay“; aber auch das hat das Problem nicht erledigt.
In Deutschland gibt es eine ungleiche Entlohnung zwischen Männern und Frauen, und das ist nicht akzeptabel. Die offiziellen Zahlen zeigen, dass bei uns die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen 23,2 Prozent beträgt. Im Laufe des Arbeitslebens steigt der Einkommensunterschied auf 30 Prozent. Wie ist das zu erklären? Wo liegt das Problem?
Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat dazu ein paar interessante Untersuchungen vorgelegt. Dabei kam heraus, dass ein entscheidender Faktor für die Verdienstlücke zwischen Männern und Frauen die Zeiten der Erwerbsunterbrechung, zum Beispiel die Babypause, sind. Denn die Lohnschere öffnet sich ab einem Alter von 30 Jahren, und das ist exakt die Zeit, in der viele Frauen ihr erstes Kind bekommen und für eine bestimmte Zeit aus ihrem Job heraus müssen.
Teilzeitarbeit - das haben wir heute schon oft gehört - nehmen Frauen oft nur deshalb in Anspruch, weil sie Familie und Beruf nicht anders vereinbaren können; aber Teilzeitarbeit führt karrieremäßig und finanziell in eine Sackgasse. Das gilt übrigens auch für Minijobs.
Deutschland ist ein Land mit einer dramatischen demografischen Entwicklung. Der Nachwuchs fehlt. Aber werden bei uns Frauen mit schlechteren Löhnen und schlechteren Aufstiegschancen bestraft, wenn sie wegen ihrer Kinder nicht berufstätig sind oder für eine bestimmte Zeit zu Hause bleiben wollen, um die Kinder zu erziehen? Denn klar ist: Bei einer schnellen Rückkehr in den Beruf nach der Babypause beträgt der Lohnabstand nur 4 Prozent. Wir müssen also unter anderem dafür sorgen, dass Frauen wieder frühzeitig in den Beruf zurückkehren können. Da sind wir bereits auf einem guten Weg.
Wie keine Regierung zuvor hat die Merkel-Regierung in den letzten fünf Jahren eine sehr gute Familienpolitik entwickelt und durchgesetzt.
Das hat kein anderer vorher geschafft.
Wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen, um eine Vorbildfunktion und ein Umdenken - für mehr Betriebskindergärten, vor allem für familienfreundliche Arbeitszeiten - zu erreichen. Wir müssen den Unternehmen sagen, dass sie etwas an ihrer Arbeitszeitphilosophie ändern müssen. Mehr Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung für Frauen und Männer! Das gilt besonders für junge Eltern; denn Mütter wollen länger arbeiten, und Väter wollen weniger arbeiten. Es muss doch möglich sein, dass man sich da entgegenkommt.
Zum großen Lohnunterschied trägt natürlich auch die Berufswahl entscheidend bei. Für die akademischen Berufe wurde das schon angesprochen. Für mich ist erschreckend, dass eine unglaublich große Zahl von Mädchen - das sage ich besonders in Richtung der Mädchen und jungen Frauen, die hier oben sitzen - sich immer noch für frauentypische Berufe entscheiden. Auch hier grüßt täglich das Murmeltier; denn schon vor 20 Jahren waren Einzelhandelskauffrau, Bürokauffrau, Verkäuferin, Friseurin, medizinische Fachangestellte und Hotelfachfrau die Lieblingsausbildungsberufe für Mädchen.
Bis heute hat sich so gut wie nichts geändert, leider. Hallo, Mädchen, wenn ihr weiterkommen wollt, ergreift andere Berufe!
Ihr könnt auch Mechatronikerin oder Ingenieurin werden.
Geht in diese Fächer! Ihr müsst es nur wollen.
Wir haben unglaublich viele Programme aufgestellt, um junge Frauen und Mädchen auch für geschlechtsatypische Berufszweige zu motivieren. Es gibt den Girls‘ Day, ?Komm, mach MINT“ und viele andere gute Programme.
Aber selbst wenn frau sich für einen typischen Frauenberuf entscheidet, bleibt eine Frage: Warum werden diese Berufszweige so schlecht bezahlt?
Ich frage die Gewerkschaften, ob der tarifliche Stundenlohn von 4,71 Euro brutto für eine ausgebildete Friseurin in Sachsen oder 6,63 Euro im Hotel- und Gaststättengewerbe in Hessen angemessen ist.
- Die Tarifautonomie steht im Grundgesetz, und das ist wohl auch für Sie immer noch die Grundlage aller Politik.
Liebe Tarifpartner, kommen Sie endlich Ihrer Pflicht nach! Anständige Löhne auszuhandeln, ist Ihre Sache und nicht unsere. Dafür sind Sie verantwortlich.
Den Unternehmen sei gesagt: Sie wollen keinen Zwang, keine weiteren gesetzlichen Regelungen. Dann verpflichten Sie sich doch bitte tatsächlich einmal selbst! Wir helfen Ihnen dabei, zum Beispiel mit dem Computerprogramm Logib-D.
Mit dieser kostenlosen Software können die Unternehmen aktiv die Ursachen erkennen, die zu unterschiedlicher Entlohnung führen, und sie können sie dann abschaffen.
Meine lieben Unternehmer, gleicher Lohn für gleiche Arbeit fördert die Motivation. Das macht sich letztendlich auch in der Bilanz bemerkbar, und es ist eine Imageförderung auch für das Unternehmen.
Lassen Sie mich noch einige Worte zum Antrag der SPD sagen. Erst einmal möchte ich daran erinnern, dass in der hier schon oft zitierten Vereinbarung, die 2001 zwischen Kanzler Schröder und der Wirtschaft geschlossen wurde, das Thema Entgeltgleichheit - man höre: das Thema Entgeltgleichheit - als eine von vier Zielgrößen verankert wurde. Aber auch hier, wie bei der Quote: Nichts als weiße Salbe!
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Pawelski, möchten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Fischbach zulassen? - Anscheinend ja. Bitte schön.
Rita Pawelski (CDU/CSU):
Ja, selbstverständlich.
Ingrid Fischbach (CDU/CSU):
Frau Kollegin, herzlichen Dank. - Sie sprachen gerade die Vereinbarung an, die seinerzeit unter Kanzler Schröder geschlossen wurde. Können Sie mir und den Kolleginnen und Kollegen vielleicht noch einmal sagen, wo da der Kollege Gabriel stand?
Er hat gerade sehr emotional reagiert und deutlich gemacht, wie er sich des Themas angenommen hat, vor allem in der Zeit danach, als er im Bundestag war. Wie ernsthaft und ehrlich waren seine Worte in der Rede gerade, wenn er es als Chef der SPD nicht schafft, seiner Generalsekretärin beim Eintritt in den Mutterschutz die Angst davor zu nehmen, nicht zurück in ihren Job zu kommen?
Wäre das nicht auch eine Form von Unterstützung der Frauen? Er war gerade der große Frauenversteher. Wie bewerten Sie das?
Rita Pawelski (CDU/CSU):
In der Tat, mich hat schon sehr gewundert, dass die Generalsekretärin einer großen Volkspartei in den letzten Schwangerschaftsmonaten Angst davor haben musste, dass andere ihr den Job wegnehmen.
Das war ein verdammt schlechtes Beispiel oder gibt einen tiefen Einblick in die Frage, wie es in der SPD wirklich zugeht. Wenn das die Personalpolitik der SPD ist, dann muss ich sagen: Sigmar, schämt euch, das war nicht in Ordnung!
Wo war Sigmar Gabriel 2001? Ich weiß es nicht mehr. War er Fraktionsvorsitzender? Oder war er schon Ministerpräsident? Das wechselte damals in Niedersachsen bei der SPD sehr häufig. Da gab es einen größeren Verschleiß. Zumindest hätte er das Thema über den Bundesrat einbringen können. Das ist nicht passiert.
Wie ging es mit dem Thema weiter? Hier wurde viel davon geredet, dass das Ganze asozial sei und dass man sich vor der Verantwortung drücke. Herr Gabriel hat noch einmal auf das Grundgesetz hingewiesen.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
?Herr Gabriel“ ist ein gutes Stichwort. Der möchte Ihnen nämlich gern eine Zwischenfrage stellen.
Rita Pawelski (CDU/CSU):
Wir wollen nicht an frühere Diskussionen im Landtag anknüpfen; lassen wir das lieber.
- Nein, Angst habe ich nicht.
Es gab während der Regierungszeit Schröder keinen Antrag von der Fraktion oder von den Frauen. Man hat sich auch da - wie bei der Quote - in den Senkel stellen lassen und schön die Klappe gehalten. Ich habe hier eine Pressemitteilung vom 16. Februar 2005. Da wird Christel Humme, SPD-Abgeordnete und schon damals, vermute ich einmal, frauenpolitische Sprecherin, mit dem Satz zitiert - 2005! -:
Wir setzen darauf, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer stärker mit dem Thema auseinander setzen …
Schon bisher hätten Frauen gegen Diskriminierung beim Gehalt klagen können, …
Das war 2005, aber die Zahlen waren schon im Jahr 2005 genauso wie heute. Hier gibt es kaum einen Unterschied.
Mit anderen Worten: Die SPD wird immer dann mutig, wenn sie in der Opposition ist. Ihr seid eine tolle Oppositionspartei, bleibt da, wo ihr seid.
- Entschuldigung, Sie haben den Mund ganz schön voll genommen. Die Wahlergebnisse sehen bei Ihnen wesentlich schlechter aus als bei uns. Man sollte sich ein bisschen in Bescheidenheit üben.
Jetzt komme ich noch einmal zu dem Antrag. Sie haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, sorgfältig zu recherchieren. Ich helfe kurz nach: Der Grundsatz des gleichen Entgelts bei gleicher Arbeit bzw. bei gleichwertiger Arbeit ist nicht mehr in Art. 141 des EG-Vertrags verankert, wie es in dem Antrag steht; denn den gibt es seit dem 1. Dezember 2009 nicht mehr. Seitdem gibt es nämlich den Vertrag von Lissabon. Sie meinen wohl Art. 157 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Da ist dies jetzt enthalten. Der Antrag muss also sowieso noch einmal umgeschrieben werden.
Dann sprechen Sie in Ihrem Antrag darüber, ?dass es der Respekt vor der Tarifautonomie gebietet, die gesetzlichen Eingriffe des Staates so gering wie möglich zu halten“. Trotzdem fordern Sie - das ist mir überhaupt nicht klar und ist für mich auch nicht nachvollziehbar -, dass zivilgesellschaftliche Akteure von außerhalb der Betriebe, also außerhalb der Betriebsräte, auf die wir großen Wert legen, mit Einflussmöglichkeiten ausgestattet werden, um staatliches Eingreifen auf ein Minimum zu reduzieren. Was das außerhalb der Betriebsräte soll, ist mir ein Rätsel.
Sie wollen eine behördliche Stelle, die Entgeltberichte von Unternehmen entgegennimmt und auswertet. Wollen Sie eine neue Behörde? Wollen Sie mehr Bürokratie und mehr Aufgaben? Ist es das, was Sie wollen? Nein, wir wollen das nicht. Sie fordern wieder einmal das Verbandsklagerecht und den gesetzlichen Mindestlohn.
Auch hier grüßt täglich das Murmeltier.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Pawelski, das Murmeltier hält jetzt auch Ihre Zeit an.
Rita Pawelski (CDU/CSU):
Danke, Frau Präsidentin.
Ich denke, es ist wichtig, dass sich hier etwas entwickelt. Dass sich etwas entwickelt hat, zeigt übrigens der Staat - es gibt hier ausnahmsweise einmal ein Lob an den Staat -: Im öffentlichen Dienst ist der Lohnunterschied auf unter 8 Prozent zurückgegangen.
Meine Damen und Herren, das ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, das weiß jeder von uns.
Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass sich die Murmeltierschleife entzerrt und dass wir auch für Frauen anständige Löhne haben.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin!
Rita Pawelski (CDU/CSU):
Wir machen das, aber Sie müssen erst einmal Ihren Antrag überarbeiten. Da stehen Forderungen drin, die mit uns so nicht zu machen sind.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Die Nächste ist die Kollegin Beate Müller-Gemmeke für Bündnis 90/Die Grünen.
Beate Müller-Gemmeke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Erwerbstätigkeit von Frauen ist eine Selbstverständlichkeit, und Frauen arbeiten natürlich in allen Branchen. Dass beispielsweise Pilotinnen sich nicht mehr lange so kluge Männersprüche anhören müssen wie: ?Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen fliegen, dann wäre der Himmel rosa geworden“, dafür werden wir auch noch sorgen.
Der Grundsatz ?Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit“ ist gesetzlich festgeschrieben. Grundsätzlich ist das ja auch gesellschaftlicher Konsens; aber leider sieht die Realität anders aus. Die Erklärungen für die ungleiche Entlohnung von Frauen sind natürlich vielfältig - wir haben ja auch heute schon viele gehört -, wie zum Beispiel unterschiedliche berufliche Präferenzen oder berufliche Unterbrechungen wegen Kindererziehung. Das sind aber nur Erklärungen. Eine zentrale Ursache ist die unterschiedliche und somit diskriminierende Behandlung von Frauen im Berufsleben. Wir sehen es also genauso wie die SPD: Das Verbot der Entgeltdiskriminierung ist vorhanden, was fehlt, ist ein Verfahren, wie die Entgeltgleichheit durchgesetzt werden kann, und vor allem der politische Wille, etwas zu verändern.
Freiwilligkeit und Selbstverpflichtung bringen keinen Erfolg, liebe FDP. Wir wollen zwar die Betriebsräte und Personalräte stärken, aber auch in die Pflicht nehmen; denn sie haben eine wichtige Schlüsselrolle inne. Vor allem aber brauchen wir gesetzliche Regelungen, damit endlich Schluss ist mit der Lohndiskriminierung von Frauen.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von den Koalitionsfraktionen, warum verdienen Teilzeitbeschäftigte weniger als ihre Kollegen in Vollzeit? Natürlich deswegen, weil dort häufig Frauen arbeiten. Bei wem fransen die Löhne im Niedriglohnbereich besonders nach unten aus? Natürlich bei den Frauen. In Ihrem Koalitionsvertrag steht, Sie wollen die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen abschaffen. Dann tun Sie doch etwas.
Machen Sie endlich den Weg frei für einen gesetzlichen Mindestlohn, für mehr branchenspezifische Mindestlöhne, für mehr allgemeinverbindlich erklärte Tariflöhne, und reformieren Sie insbesondere die Minijobs!
Das fordert auch der Gleichstellungsbericht ?Neue Wege - Gleiche Chancen“. Auch wenn die Ministerin das Gutachten nicht persönlich entgegengenommen hat: Lesen sollte sie die Handlungsempfehlungen schon, und vor allem sollte sie endlich tätig werden.
Die mittelbare Diskriminierung von Frauen ist kein einfaches Thema. Aber genau das geht die SPD zu Recht an. Auch wir Grünen arbeiten an einem Konzept. Es geht um gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit und um die Kriterien, wie Arbeit bewertet wird. Fakt ist, dass hinter vermeintlich geschlechtsneutralen Formulierungen viel zu häufig Kriterien stehen, die eindeutig zu Einkommensunterschieden und somit zu Benachteiligungen von Frauen führen.
So wird beispielsweise bei frauendominierten Tätigkeiten die Anforderung ?soziale Kompetenz“ nicht bewertet, in klassischen Männerberufen, zum Beispiel auf dem Bau, wird aber die notwendige Muskelkraft besonders hoch bewertet, hingegen werden die körperlichen und psychischen Belastungen der Pflege wiederum ignoriert.
Hier finden wir unsere Geschlechterrollen wieder, die direkt und indirekt in die Bewertung von Arbeit auf betrieblicher Ebene und ebenso in Tarifverträgen einfließen. Die schlecht bezahlten Berufe sind eindeutig noch immer Frauensache. Das muss endlich durch eine geschlechtsneutrale Arbeitsbewertung verändert werden.
Warum bekommen Männer, die Baumaterial tragen, mehr Lohn als Erzieherinnen, die quirlige Kinder tragen? Warum verdienen in Bayern Kraftfahrer, die Bier fahren, um die 2 600 Euro, Kellnerinnen aber, die Bier schleppen, nur 1 900 Euro? Warum werden Hochschulsekretärinnen, obwohl von ihnen häufig die Kenntnis von zwei Fremdsprachen verlangt wird, wie Schreibkräfte eingestuft? Ich frage also die Ministerin, die ja leider heute nicht da ist, wie sie den jungen Frauen erklären möchte, dass sie sich zwar um die Jungs in der Gesellschaft kümmern möchte, dass sie allerdings nichts, aber auch gar nichts macht, um diese Einkommenslücke zu verkleinern.
Stattdessen schiebt sie sogar den Frauen selbst die Schuld in die Schuhe, dass sie so wenig verdienen. Ich zitiere aus dem Spiegel-Interview vom 8. November 2010:
Viele Frauen studieren gern Germanistik und Geisteswissenschaften, Männer dagegen Elektrotechnik - und das hat dann eben auch Konsequenzen beim Gehalt.
So einfach ist das für die Ministerin.
Das ist aber blanker Hohn in den Ohren vieler gut ausgebildeter und motivierter Frauen. Nicht die Frauen entscheiden sich für die falschen Berufe, vielmehr muss der Grundsatz ?Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ durchgesetzt werden,
damit die sogenannten Frauenberufe endlich aufgewertet werden. So wird ein Schuh daraus, Frau Ministerin; denn Frauen verdienen mehr.
Vielen Dank.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Claudia Bögel hat das Wort für die FDP-Fraktion.
Claudia Bögel (FDP):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Verehrte Antragsteller der SPD!
Ja, es stimmt: Der Grundsatz des gleichen Entgelts bei gleicher Arbeit für Frauen und Männer ist seit 1957 in der Europäischen Union verankert. Meine Fraktion würde dieser Tatsache nie widersprechen. Unser Gesellschaftssystem steht hinter dieser Forderung, und sie ist Gesetz.
Ihr Antrag lässt zwischen den Zeilen vermuten, dass in Deutschland geltendes Recht verletzt wird. Das stimmt aber nicht.
So erkennt der werte Leser Ihres Manuskripts sehr schnell, worum es geht. Sie möchten nämlich durch die Hintertür einen flächendeckenden Mindestlohn ins Spiel bringen. Wir haben uns im Koalitionsvertrag zur Tarifautonomie bekannt. Sie ist ein hohes Gut und ein unverzichtbarer Ordnungsrahmen.
Wir werden davon nicht abrücken. Ein einheitlicher gesetzlicher Mindestlohn ist mit uns nicht zu machen.
Zurück zum vermeintlich eigentlichen Thema Ihres Antrags: die Entgeltgleichheit. Frauen arbeiten häufiger in Bereichen, in denen das Entgeltniveau niedriger ist.
Wir haben es heute schon häufiger gehört. Selbst bei gleicher Qualifikation - so ist es halt im Moment noch -
verdienen Frauen durchschnittlich 8 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen; das ist richtig. Aber man muss sagen: Frauen arbeiten häufiger in Bereichen, in denen das Entgeltniveau niedriger ist.
Man muss immer wieder feststellen, dass typische Frauenberufe schlechter bewertet und bezahlt werden.
Ich möchte hier alle Frauen aufrufen: Zeigen Sie mehr Selbstbewusstsein!
Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel! Verhandeln Sie geschickt, damit Sie für gleiche Arbeit auch gleichen Lohn erhalten!
Seien Sie nicht mit niedrigen Löhnen einverstanden, und orientieren Sie sich nicht an niedrigen Löhnen!
Gute Verdienstmöglichkeiten zeigen sich in den naturwissenschaftlich-technischen Bereichen. Genau das ist der Punkt. Schule, Wirtschaft und Verbände müssen für jungen Frauen Anreize schaffen, Berufe wie beispielsweise den des Ingenieurs zu erlernen. Gefordert sind hier vor allem die Unternehmen dieser Bereiche. Es ist an ihnen, ihre Vorzüge und Chancen richtig zu vermitteln und im wahrsten Sinne des Wortes an die Frau zu bringen.
Im Hinblick auf den demografischen Wandel geht es dabei nicht um Sympathiepunkte. Hier zählen knallharte ökonomische Gründe. Die Wirtschaft muss durch flexible Arbeitszeitmodelle und Möglichkeiten der betrieblichen Kinderbetreuung ihren Beitrag dazu leisten, damit Beruf und Familie zu vereinbaren sind. Dies wird zu einem echten Faktor im Wettbewerb, dem sich die Unternehmen in Deutschland stellen müssen - aber freiwillig.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, was Sie fordern, ist nichts weiter als die Schaffung einer neuen bürokratischen Hürde.
Ich darf aus Ihrem Antrag zitieren:
... die Unternehmen werden aufgefordert, einer behördlichen Stelle anonymisierte, geschlechtsspezifisch aufgeschlüsselte betriebliche Entgeltdaten in Form eines betrieblichen Entgeltberichts ... vorzulegen ...
Na bravo!
Sie fordern eine detaillierte expertengestützte Prüfung mittels eines Lohnmessverfahrens. Sie wollen außerdem eine Prüfung auf Verdachtsmomente.
Allein das Wort ?Verdacht“ sagt alles. Dies wäre ein weiteres bürokratisches Monster. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen würden darunter leiden.
Zu unrühmlicher Popularität in 2011 könnte Ihre Wortkreation ?Entgeltgleichheitskommission“ werden. Sie hätte große Chancen, zum Unwort des Jahres 2011 gekürt zu werden.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin.
Claudia Bögel (FDP):
Ich bin sofort fertig. - Was sich aber dahinter verbirgt, ist nur wieder eine weitere Kontrollstelle, die die Unternehmen Unmengen an Geld kostet, frei nach dem Motto ?Kontrollieren und Abkassieren“. Das machen wir nicht mit.
Vielen Dank.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Christel Hummel hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion.
Christel Humme (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kollegen! Liebe Kolleginnen! Liebe Frau Pawelski, in den letzten Jahren haben wir leider feststellen müssen, dass die Lohnlücke in Deutschland größer geworden ist, dass sie in Westdeutschland sogar auf 25 Prozent angewachsen ist. Ich gebe zu: Auch ich habe einmal geglaubt - so auch im Jahre 2001 -, wir könnten mit den Unternehmen eine freiwillige Vereinbarung für mehr Lohngleichheit schließen. Sie können auch gerne meine Äußerungen aus dem Jahr 2005 zitieren. Ich war immer davon überzeugt: Ja, wenn wir mit denen eine Vereinbarung treffen, dann bewegen die sich. - Aber genau das Gegenteil ist eingetreten. Von daher bin ich froh, dass wir jetzt den Beweis dafür haben, dass Freiwilligkeit eigentlich nichts bringt. Wir brauchen ein Gesetz.
Frau Pawelski, Sie haben gesagt, Entgeltgleichheit ja; das Murmeltier, das Sie jeden Tag grüßt, seien Sie schon leid. Erschlagen wir es doch endlich. Sie haben gesagt, Sie machen das.
Aber ich bezweifle, dass Sie wirklich einen Gestaltungswillen haben. Ich bezweifle das allen Ernstes; denn wer zulässt, dass Frauen mit Niedriglöhnen abgespeist werden, und noch nicht einmal einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn hinbekommt, dem fehlt doch jeder Mut für weitere Regelungen und Veränderungen in dieser Gesellschaft.
Wir wollen uns mit den Ungerechtigkeiten, die es gibt, nicht mehr abfinden. Sie haben in epischer Breite in verschiedenen Reden immer wieder erklärt, warum es diese Ungerechtigkeiten geben müsse. Sie haben dabei auch die Teilzeitarbeit angeführt. Sagen Sie einmal: Finden Sie es wirklich gerecht, wenn der Unterschied beim Stundenlohn von Frauen und Männern in Teilzeitarbeit knapp 4,40 Euro beträgt?
Das hat mit Teilzeit und Vollzeit gar nichts zu tun, sondern das ist echte Diskriminierung von Frauen.
Finden Sie es gerecht, dass eine Buchhalterin durchschnittlich 816 Euro weniger verdient als ein Buchhalter?
Und - was viel schlimmer ist -: Finden Sie es gerecht, dass Frauen im Laufe ihres Lebens 58 Prozent weniger Einkommen haben als Männer und dass die Frauen es sind, die das Armutsrisiko im Alter tragen? Finden Sie das wirklich gerecht?
- Sie sagen Nein, aber Sie sagen nicht, was Sie dagegen tun wollen.
Wenn ich mir anschaue, was die Frauenministerin anbietet, dann stelle ich fest: Sie hat tatsächlich 4,5 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt. 4,5 Millionen Euro - wofür? Für eine Homepage, von der man sich freiwillig ein Lohnmessverfahren herunterladen kann, das man freiwillig anwenden kann, und für ein Programm für den ländlichen Raum, das vielleicht gar nicht so schlecht ist; denn da sind die Lohnunterschiede in der Tat größer.
Aber warum hat sie ein solches Programm nicht auch für andere Branchen aufgelegt, in denen die Lohnunterschiede größer als 23 Prozent sind? Schauen Sie sich die gesamte Kreativwirtschaft an. Da gibt es Lohnunterschiede von bis zu 38 Prozent. Ich denke, das können wir letztlich nicht zulassen.
Wir können auch nicht zulassen, dass die Frauenministerin sagt, sie möchte in den nächsten zehn Jahren - man höre genau zu: in den nächsten zehn Jahren - die Lohnlücke von 23 Prozent auf 10 Prozent senken. Die freiwillige Vereinbarung ist zehn Jahre alt. Wir haben gerade gehört, wozu sie geführt hat.
Ich glaube, wenn wir solch ein zögerliches Ziel formulieren, Absenkung der Lohnlücke, dann kann daraus nichts werden. Wir wollen die Abschaffung der Lohnlücke und gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit.
Mit der Unverbindlichkeit, die Sie da an den Tag legen, schaffen Sie es noch nicht einmal, die Lohnlücke in den nächsten 100 Jahren um 1 Prozent zu senken.
Frau Schön, Sie haben von der Staatsgläubigkeit der SPD gesprochen. Das ist ja immer schnell ein Argument gegen uns Sozialdemokraten: Sie wollen mehr Staat, und damit ist das alles schlecht. - Gleichzeitig sprechen Sie von Bürokratieaufbau. Ich wundere mich immer, gerade was die FDP angeht. Ich möchte Sie an Ihre Gesundheitsreform erinnern, an das Bürokratiemonster, was den Sozialausgleich und die Berechnung der Zusatzbeiträge betrifft.
Da haben Sie alle zugestimmt. Wenn es um die Gleichstellung von Frauen und Männern geht, dann bemühen Sie das Argument der Bürokratie. Ich verstehe das nicht mehr.
Frau Schön, noch einmal ein Hinweis zur Staatsgläubigkeit: Lesen Sie unseren Antrag sehr genau. Dann werden Sie feststellen, dass wir eine Vorstellung haben von einem Gesetz, das nicht den Staat in den Vordergrund stellt, sondern die Akteure selbst, sprich: die Unternehmen und Tarifvertragsparteien.
Wir wollen, dass mehr Transparenz herrscht. Wie kann denn eine Frau etwas ändern wollen, wenn sie noch nicht einmal weiß, wie die Bezahlung und die Entgeltstruktur ist? Und wie kann man das beseitigen? Man kann das doch nur über Mitbestimmung, über die Beteiligung von Betriebsrat, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen machen. Anders wird es nicht gehen. Das hat doch mit Bürokratie und Staatsgläubigkeit nichts zu tun. Wenn auf diesem Gebiet nichts passiert, wenn dieser Prozess nicht stattfindet, dann müssen die Frauen ein Recht haben, zu klagen, und zwar als Verbandsklage, nicht als Individualklage.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Frau Kollegin.
Christel Humme (SPD):
Denn das würde sie vielleicht den Arbeitsplatz kosten. Ich denke, wir legen Ihnen ein Gesetz vor, mit dem wir, Frau Pawelski, vielleicht das Murmeltier erschlagen bekommen.
Danke schön.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Der nächste Redner ist der Kollege Norbert Geis für die CDU/CSU-Fraktion.
Norbert Geis (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Dass ich der letzte Redner bin, hat nichts mit der Diskriminierung der Männer zu tun, sondern bedeutet die besondere Ehre, diese Debatte abschließen zu dürfen. Ich bedauere allerdings, dass Herr Beck nicht mehr da ist, der es für notwendig hielt, die Frau Ministerin herbeizuzitieren. Unmittelbar nach dem Hammelsprung ist er offenbar gegangen. So wichtig kann es ihm also nicht gewesen sein.
Auch Herr Gabriel fehlt. Hieran kann man eine Gewichtung erkennen.
Da meine Redezeit um zwei Minuten gekürzt worden ist, möchte ich mich auf einen Punkt konzentrieren, den ich jetzt anführe: Ich glaube, dass ein wesentlicher Anteil daran, dass wir einen Unterschied von 23 Prozent zwischen dem durchschnittlichen Erwerbseinkommen der Frau und dem des Mannes haben, in der Tatsache begründet ist, dass die Frauen, wenn sie Kinder bekommen, in die Familienphase gehen und dass sie in dieser Familienphase einen Erwerbsnachteil erleiden.
Gleichzeitig nehmen sie in Kauf, dass ihr berufliches Fortkommen nicht mehr wettgemacht werden kann. Das halte ich im Grunde für einen Skandal; denn das darf doch wohl nicht sein. Eine Frau, die daheim bleibt, um ihre Kinder zu erziehen, erbringt eine große Leistung, nicht nur für die eigene Familie, sondern für die gesamte Gesellschaft. Trotzdem wird sie benachteiligt. Die Leistung der Mutter wird von unserer Gesellschaft nicht gebührend anerkannt.
- Wissen Sie, das ist mir einfach zu billig. Entschuldigung, Frau Kollegin, das ist ein dummer Spruch. Dümmer kann man es nicht mehr machen, tut mir leid.
Das ist nämlich ein Allerweltsurteil, ein Totschlagargument. Damit wollen Sie Vorteile erzielen. Das können Sie aber nicht, weil die Menschen die Dummheit dieses Arguments erkennen. Sie haben noch nicht begriffen, dass eine Frau, die daheim bleibt und Kinder erzieht, eine große Leistung nicht nur für die Familie, sondern für die Gesellschaft erzielt,
weil die Gesellschaft einen großen Nutzen daraus zieht. Die Gesellschaft hat einen großen Nutzen davon, dass die Frau die Kinder daheim erzieht. Sie muss sich zum einen nicht um die Kinderbetreuung kümmern, es kostet weniger Geld, und zum anderen dürfen wir davon ausgehen - -
- Lassen Sie mich doch einmal in Ruhe ausreden. Sie lassen mir ja gar keinen Platz für meine Darlegungen. Ich wollte eigentlich am Ende dieser Debatte gar nicht mehr zu einem solch lauten Disput aufrufen. Es muss doch möglich sein, sich dieses Argument einmal anzuhören.
Ich glaube wirklich, dass die Leistung der Mutter von unserer gesamten Gesellschaft - nicht nur von einer Partei - nicht richtig gewürdigt wird. In Wirklichkeit ist es nämlich eine große Leistung. Deshalb müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir die Nachteile ausgleichen können, die die Frau hat, die in die Familienphase geht und dadurch Nachteile im Erwerbseinkommen und auch im Beruf hat.
In diesem Zusammenhang ist das Elterngeld sicherlich eine große Hilfe. Wenn eine Frau aber länger in der Familienphase bleibt und während dieser Familienphase ein zweites Kind bekommt, dann bezieht sie Elterngeld auf dem Niveau der untersten Stufe, dann bekommt sie, um in Ihrem ?Wortgehege“ zu bleiben, einen Mindestlohn von 300 Euro. Das ist zu wenig. Trotzdem haben Sie sich dagegen gesperrt, dass die Frau das bekommt. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Dieser Ausgleich für die Familienphase erscheint mir zu gering.
Außerdem möchte ich betonen, dass beim Wiedereinstieg nach der Familienphase viel zu hohe Hürden zu überwinden sind. Die Kita ist in diesem Zusammenhang sicher eine gute Einrichtung. Die Frau kann das Kind, wenn es ein Jahr alt ist, in die Kita geben und kann ihrem Beruf nachgehen.
- Darauf komme ich noch zu sprechen.
Wir haben es aber noch nicht geschafft, dass Beruf und Familie in Deutschland besser vereinbart werden können, was in anderen Ländern der Fall ist.
Ein Grund dafür ist, dass wir eine im internationalen Vergleich niedrige Geburtenrate haben. Da nehme ich durchaus Ihren Vorwurf auf: Ich bin der Meinung, dass die Frau, die einen Beruf erlernt hat, das gute Recht haben muss, ihrem Beruf mit Familie nachzugehen.
Ich bin auch der Meinung, dass sich die Männer dann partnerschaftlich verhalten müssen, was in einer guten Ehe sicherlich der Fall ist.
Sie müssen ihren Anteil dazu beitragen, dass Beruf und Familie auch für die Frau möglich sind. Das kann nicht nur für den Mann gelten, sondern muss auch für die Frau gelten.
Viele Frauen, die Kinder haben, arbeiten nicht Vollzeit, weil sie Angst haben, dann keine Zeit mehr für die Kinder zu haben. Das behindert den Wiedereinstieg. Das kann es nicht sein. Meiner Meinung nach müssen wir uns hierzu einiges einfallen lassen. Es muss möglich sein, dass die Frau trotz Beruf genug Zeit hat, sich ihren Kindern zu widmen.
In diesem Zusammenhang müssen wir uns überlegen - darauf kommt es an, auch wenn Ihnen das nicht gefallen mag -, ob die haushaltsnahen Dienstleistungen nicht in größerem Maße absetzbar sein sollten. Warum soll eine Familie nicht einem kleinen Betrieb gleichgestellt werden? Der Betrieb kann die Kosten absetzen, die Familie aber nicht. Ich meine, dass dazu eine steuerrechtliche Regelung gefunden werden muss.
Wenn Frauen in den Beruf zurückkehren - auch das ist zu sagen -, werden sie oft schlecht behandelt, weil man ihnen vorwirft, dass sie nicht mehr das gleiche Wissen wie ihre Kolleginnen und Kollegen haben, die nicht in der Familienphase waren. Das kann es aber nicht sein.
Ich meine, an dieser Stelle muss man ein Benachteiligungsverbot vorsehen.
Wir haben ein solches Benachteiligungsverbot zum Beispiel im Betriebsverfassungsgesetz. Die Betriebsräte dürfen, wenn sie in ihren normalen Beruf zurückkehren, nicht benachteiligt werden. Das steht in § 78 des Betriebsverfassungsgesetzes. Eine ähnliche Regelung könnte ich mir für die Mütter vorstellen.
Darüber sollte man nachdenken.
Danke schön.
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:
Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 17/5038 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. - Dazu sehe und höre ich keinen Widerspruch. Dann ist die Überweisung so beschlossen.
[Der folgende Berichtsteil - und damit der gesamte Stenografische Bericht der 102. Sitzung - wird am
Freitag, den 8. März 2011,
auf der Website des Bundestages unter ?Dokumente & Recherche“, ?Protokolle“, ?Endgültige Plenarprotokolle“ veröffentlicht.]