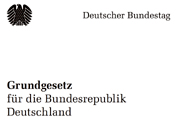Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Web- und Textarchiv > 2013
Wie Umwelt- und Tierschutz ins Grundgesetz kamen
Ob die Förderung erneuerbarer Energien, die Sicherung wertvoller Biotope oder eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft – staatliche Politik zum Schutz von Umwelt und Klima ist heute in Deutschland eine Selbstverständlichkeit. Kaum vorstellbar, dass trotz diverser gesetzlicher Regelungen noch vor zwei Jahrzehnten Natur- und Tierschutz nicht verfassungsrechtlich verankert waren. Es brauchte etliche, teils heftige wissenschaftliche und parteipolitische Diskussionen bis 45 Jahre nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes am 27. Oktober 1994 mit dem neugeschaffenen Artikel 20a auch der Umweltschutz als Staatsziel in die Verfassung aufgenommen wurde.
Es war eine der umfangreichsten Änderungen seit Bestehen des Grundgesetzes. Der Tierschutz fand acht Jahre später, am 1. August 2002, seinen Weg in die Verfassung – vorangegangen war auch hier eine jahrelange gesellschaftspolitische Debatte.
Schutz für natürliche Lebensgrundlagen und Tiere
Seither lautet Artikel 20a des Grundgesetzes: "Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung."
Doch wie kam es dazu? Was bedeutet so eine Staatszielbestimmung? Und: Welche Wirkung hat sie?
Ein Grundrecht auf Umweltschutz?
Ursprünglich enthielt das Grundgesetz kaum umweltbezogene Inhalte. Doch mit der fortschreitenden technischen und industriellen Entwicklung traten zunehmend Umweltprobleme zutage: So wuchs in den siebziger Jahren mit der Verschmutzung von Luft, Boden und Gewässern in der Bevölkerung auch das Bewusstsein für Umweltschutz.
Bereits 1971 hatte die SPD ein Grundrecht auf Umweltschutz in ihr Umweltprogramm aufgenommen. Doch es waren vor allem die Grünen, die in den frühen 1980er-Jahren für ein solches Grundrecht eintraten. Ihr Ziel: Bürgerinitiativen oder Verbände sollte bei Umweltverschmutzungen klagen können. Durchsetzen konnte sich die Partei mit dieser Forderung aber nicht: Im Dezember 1983 lehnte eine Sachverständigenkommission des Innenministeriums die Einführung eines Grundrechts ab – und schlug stattdessen die Einführung eines Staatsziels Umweltschutz vor.
Staatsziele als Richtlinie des staatlichen Handelns
Was aber lässt sich darunter verstehen? Staatsziele sind, laut einer Definition der Sachverständigenkommission "Staatsziele – Gesetzgebungsaufträge" Verfassungsnormen mit rechtlich bindender Wirkung.
Als "Richtlinie und Direktive des staatlichen Handelns" bezeichnete sie einmal der Jurist Werner Hoppe in der 2000 erschienenen Publikation "Umweltrecht". Einklagbar sind Staatsziele, anders als Grundrechte, allerdings nicht.
Kontroverse um die Formulierung
Trotzdem entbrannte um die Einführung eines Staatsziels Umweltschutz eine parteipolitische Kontroverse im Bundestag: 1986 lehnte die CDU/CSU-Fraktion die Verankerung eines solchen Staatsziels komplett ab, während die SPD dies befürwortete.
Später lenkte die Union zwar ein, doch die konkrete Ausgestaltung und Formulierung führte erneut zu Streit unter den Fraktionen. Ein Konsens konnte über Jahre nicht gefunden werden.
Kompromiss ebnet den Weg
Erst nach der Wiedervereinigung kam Bewegung in die Verhandlungen: Eine von Bundestag und Bundesrat eingesetzte gemeinsame Verfassungskommission einigte sich – zwar ebenfalls erst nach mehr als zwei Jahren Beratung – 1993 auf eine Kompromissformulierung. Diesen Kommissionsvorschlag nahmen Bundestag und Bundesrat schließlich an. Der Weg für die Grundgesetzänderung und die Aufnahme des Artikels 20 a in die Verfassung war frei.
Keine Berücksichtigung fand jedoch der Vorschlag, auch den Tierschutz zu einem eigenständigen Staatsziel zu erheben und in der Verfassung zu verankern: Vergeblich hatten sich Bündnis 90/Die Grünen 1994 mit einem Gesetzentwurf dafür stark gemacht. Ihre Initiative scheiterte, ebenso ein weiterer Anlauf 1997.
Vom Schächturteil zum Staatsziel Tierschutz
Unter Rot-Grün wendete sich das Blatt. Stein des Anstoßes war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das all jenen Rückenwind gab, die forderten, den Tierschutz als Staatziel in der Verfassung festzuschreiben. Was war geschehen? Im Januar 2002 hatten die Karlsruher Richter entschieden, Muslimen das bislang verbotene Schächten zu erlauben – und damit einen Sturm der Entrüstung erzeugt.
Das betäubungslose Schlachten von Vieh sei Tierquälerei, empörten sich nicht nur Tierschutzorganisationen. Doch für die Verfassungshüter war der Fall klar: Sie stellten die Religionsfreiheit des muslimischen Metzgers, der die Klage eingereicht hatte, über den Tierschutz. Verfassungsrechtlich korrekt, schließlich waren Tiere nicht grundgesetzlich geschützt – anders als die Religionsfreiheit.
Nicht nur "Verfassungslyrik"
Das ist längst Geschichte: Die Fraktionen einigten sich 2002 auf einen gemeinsamen Gesetzentwurf. Schon wenige Monate später konnte Artikel 20a mit Wirkung zum 1. August 2002 um drei Worte erweitert werden. Der Staat verpflichtet sich seitdem, die natürliche Lebensgrundlagen zu schützen – "und die Tiere", wie es nun heißt.
"Damit ist zwar nicht das Mensch-Tier-Verhältnis revolutioniert worden", urteilte der Deutsche Tierschutzbund später. Tierversuche und Massentierhaltung seien schließlich noch nicht verboten. Dennoch sei das Staatsziel Tierschutz nicht nur "Verfassungslyrik".
Debatte über das Für und Wider von Staatszielen
Über die Wirkung von Staatszielen wird bis heute immer wieder diskutiert. Als sich 2007 die Enquete-Kommission "Kultur in Deutschland" in ihrem Abschlussbericht dafür aussprach, die Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz aufzunehmen, entbrannte erneut eine grundsätzliche Debatte über das Für und Wider einer Staatszielbestimmung. Befürworter betonten, so werde das zu schützende Gut gegenüber nur "gesetzlich" geschützten Anliegen aufgewertet und erhalte den gleichen Rang wie Grundrechte.
Der damalige Bundestagsvizepräsident Dr. h.c. Wolfgang Thierse (SPD) sprach sich so etwa über das Staatsziel Kultur hinaus auch für die Verankerung der deutschen Sprache im Grundgesetz aus. In einem Beitrag in der Zeitschrift "Neue Gesellschaft" argumentierte er 2009, ein solcher Verfassungsartikel würde "Politik, Staat, Verwaltung, Wirtschaft und Medien" stärker in die Pflicht nehmen, das "wichtigste Integrations- und Aufstiegsinstrument, nämlich die Beherrschung der deutschen Sprache" mehr zu fördern und schützen.
Grundgesetz ist kein "Warenhauskatalog"
Kritiker hingegen bemängelten, mit weiteren Staatszielen – neben der Kultur wurde zuletzt 2012 über ein Staatsziel Sport debattiert – werde das eher knapp formulierte Grundgesetz "überladen".
"Unsere Verfassung ist kein Warenhauskatalog", sagte zum Beispiel der frühere Bundesverteidigungsminister Dr. Franz-Josef Jung (CDU) am 28. September 2012 in einer Bundestagsdebatte. Staatsziele würden Erwartungen wecken, die nicht erfüllbar seien.
"Unübersichtlichkeit und Unsicherheit"
Auch unter Juristen werden Staatziele skeptisch gesehen: Der Staatsrechtler Prof. Dr. Guy Beaucomp etwa warnte in einem 2009 erschienenen Aufsatz, eine wachsende Anzahl und Konkurrenz von Staatszielen könne zu "Unsicherheit und Unübersichtlichkeit" führen. Staatsziele verschöben die Macht von den Parlamenten zu den Gerichten, gibt er darin zu bedenken: "Der Bundestag bindet sich durch weitere Staatszielbestimmungen selbst", so der Hamburger Rechtswissenschaftler.
Ein weiteres Gegenargument, das der etwa der frühere Landesverfassungsrichter Prof. Dr. Michael Kilian anführt: Ein Staatsziel sei wenig sinnvoll, wenn dem Gesetzgeber die Regelungskompetenz für die darin formulierte Aufgabe fehle. Und das sei beim Bund im Bereich der Kultur und des Sports größtenteils der Fall.
Fünf neue Staatsziele seit Bestehen des Grundgesetzes
Würde die Kultur ungeachtet solcher Kritik doch eines Tages verfassungsrechtlich verankert, wäre es das sechste Staatsziel.
Bislang hat der Bundestag seit 1949 hat neben dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und dem Tierschutz noch drei weitere Staatsziele ins Grundgesetz aufgenommen: 1967 das "gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht" in Artikel 109 Absatz 2, 1992 die "Verwirklichung eines geeinten Europas" in Artikel 23 Absatz 1 sowie 1994 die "tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung" in Artikel 3 Absatz 2. (sas/02.12.2013)