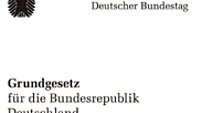Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Ausschüsse > Untersuchungsausschüsse
Rechtsgrundlagen der NSA-Kooperation erörtert
Der 1. Untersuchungsausschuss (NSA) unter Vorsitz von Prof. Dr. Patrick Sensburg (CDU/CSU) hat am Donnerstag, 25. Februar 2016, mit einer ehemaligen Referatsleiterin im Kanzleramt erneut die Rechtsgrundlagen erörtert, auf denen der Bundesnachrichtendienst (BND) der amerikanischen National Security Agency (NSA) Metadaten aus der gemeinsam in Bad Aibling betriebenen Abhöranlage übermittelt hat. Dabei bekräftigte die Zeugin Christina Polzin ihre Auffassung, dass das BND-Gesetz dafür eine hinreichende Handhabe geboten hätte. Die heute 43-jährige Juristin leitete zwischen Juli 2011 und Dezember 2014 im Kanzleramt das Referat 601, zuständig unter anderem für Personal und Recht der Nachrichtendienste. Sie ist seither im Innenministerium tätig.
"Monatlich 500 Millionen Metadaten an die NSA geflossen"
Bei ihrer ersten Vernehmung am 12. November 2015 hatte sie dem Ausschuss von einer Kontroverse berichtet, die sie im August 2013 mit ihrem Vorgesetzten im Kanzleramt, Geheimdienstkoordinator Günter Heiß, und BND-Präsident Gerhard Schindler ausgetragen hatte.
Nach den Enthüllungen Edward Snowdens im Sommer 2013, aus denen unter anderem hervorgegangen war, dass aus Bad Aibling Monat für Monat 500 Millionen Metadaten an die NSA geflossen waren, hatte sich Polzin mit der Frage an den BND gewandt, auf welcher Rechtsgrundlage dies geschehen sei.
"BND-Gesetz sichere Rechtsgrundlage"
Die Antwort lautete, in Bad Aibling werde satellitengestützter Datenverkehr aus Ländern des Nahen und Mittleren Osten überwacht. Da die Satelliten, wo die Daten erfasst würden, im Weltraum, also außerhalb Deutschlands, unterwegs seien, seien die Aktivitäten durch den allgemeinen Auftrag an den BND gedeckt, Informationen im Ausland zu sammeln. Restriktionen, die sich aus dem deutschen BND-Gesetz ergeben könnten, seien deshalb nicht einschlägig.
Gegenüber Geheimdienstkoordinator Heiß machte Polzin deutlich, dass sie diese sogenannte "Weltraumtheorie" rechtlich nicht überzeugend finde. In einer Unterredung mit Heiß und Schindler konnte sie sich indes nicht durchsetzen. Erneut betonte sie, dass das BND-Gesetz ihrer Meinung nach eine sicherere Rechtsgrundlage geboten hätte.
"Übermittlung muss aktenkundig gemacht werden"
Polzin bezog sich auf Paragraf 19 Absatz 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes, der sich wortgleich im BND-Gesetz findet. Demnach ist der BND unter bestimmten Voraussetzungen berechtigt, Daten an "öffentliche" Stellen im Ausland zu übermitteln. Die Übermittlung müsse allerdings "aktenkundig" gemacht werden.
Zwar habe der Gesetzgeber dabei die Übermittlung einzelner Daten und nicht einen massenhaften Datenabfluss vor Augen gehabt. Die Anforderungen an die Dokumentation von Übermittlungen an eine "öffentliche" Stelle im Ausland seien aber nicht so hoch, dass sie nicht auch auf die automatisierte Weitergabe großer Datensätze anwendbar wäre. Dies ergebe sich aus einem Vergleich mit Absatz 4 desselben Paragrafen, der die Übermittlung an nichtöffentliche Stellen im Ausland regele und wesentlich strenger gefasst sei.
"Der Weltraumtheorie den Vorzug gegeben"
Für eine Weitergabe an die NSA reiche es aus, Art, Herkunft und Umfang der übermittelten Daten sowie den Zweck der Übermittlung festzuhalten. Dazu sei der BND auch in Bad Aibling in der Lage: "Ich gehe davon aus, dass es Darstellungen gibt, was dort passiert."
Auf die Frage, warum Heiß und Schindler dennoch der Weltraumtheorie den Vorzug gegeben hatten, antwortete die Zeugin, sie hätten sich vermutlich genau diese komplexen juristischen Erörterungen ersparen wollen, zumal in der politisch brisanten Debattenlage nach den Snowden-Enthüllungen. Sie hätten die Weltraumtheorie für tragfähig gehalten und gemeint, auf diese Weise eine diffizile Diskussion um die Reichweite der gesetzlichen Dokumentationspflicht "umschiffen" zu können.
„Die Zügel angezogen“
Unter dem Eindruck der Snowden-Affäre habe das Auswärtige Amt im Herbst 2013 in der Kooperation mit US-Dienststellen in Deutschland „die Zügel angezogen“, hatte zuvor der heutige deutsche Botschafter in Indien, Dr. Martin Ney, als Zeuge ausgesagt.
Die Enthüllungen über NSA-Schnüffelaktivitäten auch gegen deutsche Interessen seien als „Einschnitt“ empfunden worden: „Das Vertrauen in die Zusage der Einhaltung deutschen Rechts war doch erschüttert.“ Der 59-jährige Jurist Ney war seit 2010 stellvertretender Leiter, zwischen 2012 und 2015 Leiter der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amtes und Völkerrechtsberater der Bundesregierung.
„Lediglich Kriterien der Plausibilität angelegt“
Über seinen Schreibtisch gingen in dieser Zeit jährlich 50 bis 100 Anträge auf Genehmigung der Tätigkeit amerikanischer Vertragsfirmen der in Deutschland stationierten US-Streitkräfte. Laut Nato-Truppenstatut gelten für diese Unternehmen, die entweder Versorgung und Betreuung der Truppen oder „analytische“ Dienstleistungen anbieten, Ausnahmen von deutschen handels- und gewerberechtlichen Vorschriften.
Ihre Beschäftigten sind in Deutschland aufenthaltsberechtigt. Im übrigen haben sie sich laut Artikel 2 des Truppenstatuts an deutsches Recht zu halten. Die Genehmigung ihrer Tätigkeit im sogenannten „Docper-Verfahren“ erfolgt durch Austausch von Verbalnoten zwischen dem Auswärtigen Amt und der US-Botschaft, die im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden.
Bis zum Sommer 2013 sei das Auswärtige Amt dabei nach dem Grundsatz verfahren, dass der „engste Verbündete“ Anspruch auf Vertrauen in die Rechtlichkeit seines Verhaltens habe. Bei der Überprüfung der US-Firmen seien daher lediglich Kriterien der Plausibilität angelegt worden, ob das Tätigkeitsprofil der betroffenen Firma dem Bedarf entsprach, den die US-Streitkräfte angemeldet hatten.
„Sicherstellen, dass deutsches Recht eingehalten wird“
Als dann Anfang August 2013 die US-Botschaft mit neuen Docper-Anträgen gekommen sei, wobei der zuständige Geschäftsträger ausdrücklich versichert habe, die betroffenen Firmen würden sich selbstverständlich an deutsches Recht halten, sei im Auswärtigen Amt die Frage aufgekommen: Können wir so weitermachen wie bisher? Die Antwort sei ein klares Nein gewesen.
Im Februar 2014 habe die Rechtsabteilung daher ein neues Genehmigungsverfahren entwickelt und sechs Punkte fixiert. Die Verpflichtung auf die Einhaltung deutschen Rechts wurde fortan nicht mehr als gegeben vorausgesetzt, sondern in jeder einzelnen Verbalnote nochmals ausdrücklich festgehalten. Über die Regelung im Truppenstatut hinaus musste die US-Seite zusagen, „alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass deutsches Recht eingehalten wird“.
„Ein ausgesprochen intensiver Dialog“
An der Überprüfung wurden künftig außer dem Auswärtigen Amt auch das Kanzleramt, das Verteidigungsministerium und das Innenministerium beteiligt. Die im Rahmenabkommen von 2001 vorgesehene „Beratende Kommission“ zur Klärung von Streitfragen wurde „reaktiviert“. Jedes betroffene Unternehmen musste einen Maßnahmenplan vorlegen, um zu garantieren, dass seine Mitarbeiter deutsches Recht beachteten. Die bisherige Praxis rückwirkender Genehmigungen hatte ab sofort ein Ende.
Die US-Botschaft habe „lange mit uns um die Formulierungen gerungen“, jedoch offenbar zunächst ohne Rücksprache mit Washington, berichtete Ney. Denn einige Zeit später seien die amerikanischen Verhandlungspartner nochmals mit dem Wunsch an das Auswärtige Amt herangetreten, die neuen Klauseln nachträglich zu ändern: „Wir haben gesagt, das geht auf keinen Fall.“ Daraus habe sich dann ein „ausgesprochen intensiver Dialog“ entwickelt „bis dahin, dass wir angedroht haben, Mitarbeiter von US-Firmen des Landes zu verweisen“. (wid/26.02.2016)
Liste der geladenen Zeugen
- Dr. Martin Ney, Auswärtiges Amt
- Christina Polzin, Bundesinnenministerium
- Monika Genkova, Bundesamt für Verfassungsschutz