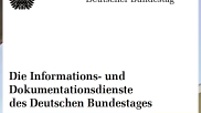Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Web- und Textarchiv > Textarchiv
Avineri erwartet neue Ordnung im Nahen Osten
Als die Umstürze autoritärer Regime durch Massenproteste in gleich mehreren arabischen Staaten 2011 die Welt überraschten, hofften viele auf eine Demokratisierung des Nahen Ostens und Nordafrikas. Vier Jahre nach dem „Arabischen Frühling“ ist die Euphorie allgemeiner Ernüchterung gewichen: In Syrien tobt ein heftiger Bürgerkrieg, in Ägypten herrscht wieder das Militär und der Vormarsch der Terrororganisation „Islamischer Staat“ droht den Nahen Osten weiter zu destabilisieren.
Einen Blick auf diese „Region in Aufruhr“ warf der israelische Historiker und Politikwissenschaftler Prof. Dr. Shlomo Avineri von der Hebräischen Universität Jerusalem in seinem Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe W-Forum der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages am Dienstag, 2. Dezember 2014.
Nüchterne Analyse des Wissenschaftlers
Avineri analysierte nüchtern, „was geschah, und was nicht geschah“. Nur in einer Handvoll arabischer Staaten seien autoritäre Regimes gestürzt worden, sagte er. Davon seien vor allem Länder betroffen gewesen, in denen sich wie beispielsweise in Ägypten das Militär an die Macht geputscht hatte.
Anders als die dynastischen Monarchien der Region, die nicht weniger oppressiv seien, besäßen diese keine historische Legitimität. In Saudi-Arabien etwa speise sich diese Legitimität aus dem Status der Herrscherfamilie als Hüterin der heiligen Stätten in Mekka und Medina.
Avineri: Tunesien gibt Grund zur verhaltenen Hoffnung
Der Politikwissenschaftler stellte zudem klar, dass Massendemonstrationen nicht direkt zu einem demokratischen System führten. Regime seien vergleichsweise schnell abgesetzt, eine pluralistische Gesellschaft folge daraus jedoch nicht. Anders als beispielsweise 1989 in Polen sei die Zivilgesellschaft in den meisten arabischen Ländern nur sehr schwach ausgeprägt.
In Ägypten beispielsweise habe sich daher zunächst die über Jahrzehnte organisierte Muslimbruderschaft als stärkste politische Kraft durchsetzen können. Die jugendlichen Demonstranten des Tahrir-Platzes, die in den westlichen Medien den demokratischen Aufbruch verkörpert hätten, seien nur eine verschwindend geringe Minderheit der ägyptischen Gesellschaft. Einzig in Tunesien sah Avineri Grund zur verhaltenen Hoffnung.
Zerfall des Sykes-Picot-Staatengefüges
Jenseits der Frage, welche Regierungsformen sich infolge des „Arabischen Frühlings“ herausbilden, stellten die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten eine tektonische Veränderung des regionalen Staatensystems dar, betonte Avineri. Es handle sich um den Zerfall des 1916 mit dem Sykes-Picot-Abkommen von den Kolonialmächten aufgezwungenen Staatengefüges.
Mit dem Irak, dem Libanon und Syrien seien damals statt Nationalstaaten „Vielvölkerstaaten“ mit religiösen und ethnischen Minderheiten entstanden, deren Grenzen willkürlich entlang kolonialer Interessengebiete festgelegt wurden.
„Westen kann Entscheidungen wenig beeinflussen“
Angesichts der Spannungen im Zuge des Irakkrieges 2003 und des „Arabischen Frühlings“ 2011 seien religiöse oder ethnische Zugehörigkeiten der Menschen im Nahen Osten wieder in den Vordergrund getreten. Staaten wie der Irak, Libyen oder Syrien seien praktisch zerfallen. Daher habe auch der „Islamische Staat“ so großen Zulauf – gerade von jungen Menschen, die ihr Schicksal selbst bestimmen und nicht innerhalb des Systems von Sykes-Picot leben wollten.
In den kommenden Jahren werde eine neue Ordnung im Nahen Osten entstehen. Wie diese aussehen werde, wusste auch Avineri nicht. Er warnte den Westen: Dieser müsse sich darüber im Klaren sein, wie wenig er diese Entwicklungen beeinflussen könne. „Die Entscheidungen müssen ex oriente kommen und nicht ex occidente“, sagte er. (fri/02.12.2014)