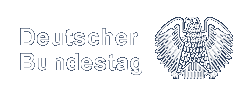155. Sitzung
Berlin, Freitag, den 28. Januar 2005
Beginn: 9.00 Uhr
* * * * * * * * V O R A B - V E R Ö F F E N T L I C H U N G * * * * * * * *
* * * * * DER NACH § 117 GOBT A
UTORISIERTEN FASSUNG * * * * *
* * * * * * * * VOR DER ENDGÜLTIGEN DRUCKLEGUNG * * * * * * * *
Präsident Wolfgang Thierse:
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Sitzung ist eröffnet.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 14 auf:
Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend(12. Ausschuss) zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung
Vierter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland: Risiken, Lebensqualität und Versorgung Hochaltriger – unter besonderer Berücksichtigung demenzieller Erkrankungen und Stellungnahme der Bundesregierung
– Drucksachen 14/8822, 15/345 Nr. 62, 15/4192 –
Berichterstattung:Abgeordnete Angelika Graf (Rosenheim)Walter Link (Diepholz)Irmingard Schewe-Gerigk Klaus Haupt
Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die Aussprache eine Stunde vorgesehen. – Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.
Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Parlamentarische Staatssekretärin Riemann-Hanewinckel.
Christel Riemann-Hanewinckel, Parl. Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:
Herr Präsident! Sehr verehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir debattieren heute den 4. Altenbericht, einen Bericht, den die Bundesregierung Anfang 2002 vorgelegt hat. Dieser Bericht ist jetzt zwar schon ein paar Jahre alt; aber sein Thema ist nach wie vor hochaktuell. An dieser Stelle möchte ich der Expertenkommission herzlich für die Arbeit danken, die sie geleistet hat, um diesen Bericht vorlegen zu können. Er ist in sehr kurzer Zeit entstanden. Nichtsdestotrotz ist er sehr detailliert, sehr umfangreich sowie sehr fundiert und vor allem für unsere politische Arbeit nützlich.
Ich habe schon gesagt: Dieser Bericht ist zwar schon etwas älter; aber er ist überhaupt nicht von gestern. Im Gegenteil, aufgrund des voranschreitenden demographischen Wandels hat dieser Bericht immer noch allerhöchste Aktualität. Der zentrale Leitgedanke des Berichtes ist, dass Menschen in allen Lebensabschnitten – ob sie jung sind, im Arbeitsleben stehen oder ob sie alt bzw. sogar hochaltrig sind – ein selbstbestimmtes, selbstständiges und würdevolles Leben führen wollen. Das gilt insbesondere für die Menschen, die mit Behinderungen oder Krankheiten alt werden, und für demenziell erkrankte Menschen. Deshalb will ich in meinen Ausführungen hier einen Schwerpunkt setzen.
Der Kommission war es sehr wichtig, festzustellen, dass es kein einheitliches Bild des Menschen im hohen Alter gibt. Weder gibt es den hochaltrigen Menschen noch haben sie alle gleiche Bedürfnisse und Möglichkeiten. So verschieden die Menschen ihr Leben gelebt haben, so verschieden ihre Ansichten, Bedürfnisse und Wünsche sind, so verschieden sind sie auch im Alter. Individuelle Unterschiede nehmen im Alter sogar eher zu. Es gibt sie hinsichtlich der Befindlichkeit und der psychischen und körperlichen Gesundheit. Daher muss die Unterstützung, die vor allem hochaltrige und an Demenz erkrankte Menschen erfahren müssen, individuell sehr verschieden sein. Die Unterstützung und die Hilfen, die sowohl vonseiten der Politik als auch vonseiten der Gesellschaft angeboten werden müssen, müssen dem Rechnung tragen.
Meine Damen und Herren, um entsprechend handeln zu können, braucht man verlässliche Daten. Deshalb sind genaue Analysen durch die Forschung unumgänglich. Sie wissen, dass das Ministerium für Seniorinnen und Senioren für die Grundlagenforschung nicht zuständig ist. Die Grundlagenforschung wird im Bundesministerium für Bildung und Forschung und im Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung betrieben.
Diese beiden Ministerien haben die relevanten Altersthemen im Rahmen des Gesundheitsforschungsprogramms bearbeitet. In diesem Zusammenhang nenne ich vor allem das Kompetenznetz Demenzen, in dem einheitliche Richtlinien für Diagnostik und Therapie entwickelt werden. Das ist erforderlich, weil Teile dieses Forschungsgebietes noch relativ neu sind. Wir müssen über neue Erkenntnisse über die Entstehung und den Verlauf von demenziellen Erkrankungen genauestens informiert sein, um dementsprechend handeln zu können.
Dieses Kompetenznetz hatte eine Projektlaufzeit von gut vier Jahren. Sie wissen vielleicht, dass 14 klinische oder universitäre Zentren, 120 Hausarztpraxen und 3 000 Patientinnen und Patienten daran beteiligt waren. Auch Industrieunternehmen und Einzelprojekte haben zur Forschung beigetragen. Wichtig an diesem Kompetenznetz Demenzen ist, dass hier sowohl vertikal als auch horizontal gearbeitet worden ist. Wissenschaftliche Erkenntnisse können auf diese Art und Weise sehr schnell umgesetzt werden und denen zugute kommen, die vor Ort arbeiten, zum Beispiel Selbsthilfegruppen oder auch der Deutschen Alzheimer Gesellschaft.
Ich möchte noch auf ein paar andere Projekte unseres Hauses eingehen, so auf das Aktionsprogramm „Demenz“. Wir wissen inzwischen, dass sich viele in der Bevölkerung gar nicht klar machen, dass fast alle in unserer Gesellschaft vom Phänomen Demenz betroffen sind. Wer in Gruppen darüber redet, dem wird sehr schnell klar, dass jeder und jede entweder in der Familie einen betroffenen Angehörigen hat oder aber im näheren Bekanntenkreis jemanden kennt und erlebt hat, der von Demenz betroffen ist. Trotzdem steht diese Erkrankung nach wie vor unter einem bestimmten Tabu. Angehörige schämen sich oft dafür und haben große Probleme, die Hilfen, die es jetzt schon gibt, in Anspruch zu nehmen. Deshalb ist dieser Bericht wichtig, um deutlich zu machen, welche Bedürfnisse die Menschen haben, die erkrankt sind, und welche Bedürfnisse die Menschen haben, die Demenzerkrankte pflegen, unabhängig davon, ob es im häuslichen Bereich geschieht oder in einer stationären Unterkunft.
Meine Damen und Herren, unser Haus hat verschiedene Modellprogramme durchgeführt. Ich nenne nur beispielhaft das Modellprogramm „Altenhilfestrukturen der Zukunft“. Beispielsweise ist in Daaden/Herdorf in Rheinland-Pfalz von 2000 bis 2003 ein Projekt durchgeführt worden, das sich vor allen Dingen an so genannte ehrenamtliche Tagesmütter gerichtet hat. Dabei ist deutlich geworden, dass in diesem Bereich häusliche Versorgung ein wichtiger Punkt ist, dass aber diejenigen, die diese häusliche Versorgung anbieten, auch Ausbildung und Begleitung brauchen. Dieses Projekt wird wie alle anderen Projekte so aufgearbeitet, dass die gewonnenen Erfahrungen anderen Betroffenen oder Interessierten zur Verfügung stehen.
Ich nenne ein zweites Projekt in Stuttgart, wo ein Heim während des Betriebes umgebaut worden ist.
Die Betroffenen sollen in Zukunft in Wohngruppen nicht nur leben und wohnen, sondern auch betreut und versorgt werden Die Fachkräfte wurden während der Arbeit geschult und schon während des Umbaus auf die neue Situation eingestellt. Das ist von ihnen als besonders notwendig, angenehm und hilfreich empfunden worden. Auch dieses Projekt wird in einem Handbuch zusammengefasst, damit andere Heime, die in Zukunft oder jetzt schon umbauen, die gewonnenen Erfahrungen nutzen können.
Meine Damen und Herren, wir wissen, dass die pflegenden Angehörigen auf eine zum Teil sehr mühevolle Art und Weise mit betroffen sind. Deshalb ist es notwendig, auch das zu untersuchen und Projekte zu fördern, die den Angehörigen und damit letztlich auch wieder den demenziell Erkrankten zugute kommen. Wir fördern das Projekt „Leander“, das bis zum 31. Juli 2005 laufen wird. Das ist eine Längsschnittstudie zur Belastung pflegender Angehöriger von demenziell Erkrankten, durchgeführt von der Freien Universität Berlin.
Es gibt im stationären Bereich ein Projekt, die Deutsche Expertengruppe Dementenbetreuung, die praktische Empfehlungen für die stationäre Betreuung geben wird. Dabei geht es nicht nur um die Ansprache und die persönliche Begleitung der betroffenen Patientinnen und Patienten, sondern auch um solche Dinge wie Brandschutz, Küchenhygiene, Ernährung und Mobilität der Betroffenen.
Ein besonders wichtiges Kapitel gerade in der Begleitung Hochaltriger oder demenziell Erkrankter ist die Qualitätssicherung. Nirgendwo ist es so notwendig, Qualitätsstandards zu entwickeln und diese dann auch zu sichern, wie bei den Menschen, die auf andere besonders angewiesen und somit in einer besonderen Art und Weise von denen abhängig sind, die sie begleiten und pflegen.
Deshalb sind die Messung und Sicherung der Qualität der Pflege dementer Menschen besonders wichtig. Sie können sprachlich oft nicht mehr reagieren und nicht mehr sagen, was für sie mühevoll oder auch sehr gut ist. Aus diesem Grund gibt es das wissenschaftlich evaluierte Praxisprojekt „HILDE“, das „Heidelberger Instrument zur Lebensqualität Demenzerkrankter“, das in Fachkreisen große Zustimmung erfährt. Es geht um die Erfassung des subjektiven Erlebens der Betroffenen über ihre Mimik und um das Umsetzen von beobachtbarem Verhalten und Erleben in Begleitung, Beratung und Betreuung.
Die Zivilgesellschaft spielt bei der Begleitung von Demenzerkrankten eine ganz besondere Rolle. Hier kommt es darauf an, dass diejenigen in der Zivilgesellschaft, die sich ehrenamtlich engagieren, eng mit der Politik zusammenarbeiten. Eine solche sehr intensive und sehr gute Zusammenarbeit gibt es zum Beispiel mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Neben zahlreichen anderen Projektträgern ist sie die wichtigste Partnerin im Aktionsprogramm.
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft leistet Aufklärung, Beratung und den Aufbau von Netzwerken. Als Beispiel möchte ich hier das Alzheimer-Telefon nennen, wodurch seit drei Jahren ganz besonders betroffenen Angehörigen geholfen wird. Diese Beratung soll weiter ausgebaut werden. In Zukunft soll sie auch online möglich sein. Damit wird die Zielgruppe derer, die angesprochen werden sollen, vergrößert. Hier geht es vor allen Dingen um diejenigen, bei denen sehr frühzeitig eine mögliche Alzheimererkrankung diagnostiziert wurde. Die Betroffenen sollen sich selbst online beraten lassen können, wodurch sie Hilfe für sich und in Zukunft auch für ihre Angehörigen erhalten können.
Das Bundesministerium hat einen Leistungsvertrag mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft abgeschlossen. Die Dauer dieses Leistungsvertrages ist jetzt bis zum Jahre 2007 verlängert worden. Die Förderung beträgt insgesamt über 1,9 Millionen Euro.
An dieser Stelle möchte ich der Deutschen Alzheimer Gesellschaft und vor allen Dingen der Vorsitzenden, Frau von Lützau-Hohlbein, ganz herzlich für ihr Engagement – unter anderem durch die Durchführung der jährlichen Fachtagungen – nicht nur für sich und ihre Familie, sondern vor allen Dingen auch für die Gesellschaft und die Politik danken. Es ist notwendig, in diesem Bereich eine intensive Mitarbeit der gesamten Zivilgesellschaft zu erfahren.
Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss und möchte nur noch einige Stichworte nennen, die Sie bei den verschiedenen Projekten nachlesen können. Sie wissen, dass es inzwischen eine Weiterentwicklung der Wohnprojekte gibt, die durch den 2. Altenbericht „Wohnen im Alter“ angestoßen wurde. Vor allen Dingen für Menschen mit Demenz haben wir innovative Wohnformen – sowohl beim betreuten Wohnen als auch bei der stationären Versorgung – entwickelt. Insgesamt gibt es hier 22 Beispiel gebende Heime quer durch die Republik. Sie können sich auf der Homepage des Ministeriums darüber informieren. Diese Beispiele wurden deshalb eingestellt, weil sie für die Zukunft wirklich wegweisend sind und zur Nachahmung dringend empfohlen werden.
Sie wissen, dass sich auch der „Runde Tisch Pflege“ dieses Themas intensiv annimmt. Wir hoffen sehr, dass wir durch die Infokampagne „Demenz“, die die Deutsche Alzheimer Gesellschaft intensiv mit vorbereitet, dazu beitragen können, dass dieses Thema in Zukunft nicht mehr tabuisiert wird, dass die Menschen begreifen und erleben können, dass das Leben im Alter nicht nur für gesunde Menschen Zukunft hat, weil wir immer älter werden, sondern auch für die Menschen, die mit besonderen Schwierigkeiten oder Einschränkungen belastet sind, und dass deshalb das Engagement von Politik und Zivilgesellschaft notwendig ist.
Auch im Antidiskriminierungsgesetz, das wir hier demnächst beraten werden, wird dieser Punkt noch einmal besonders hervorgehoben, wenn es darum geht, dass niemand wegen seines Alters und der Einschränkungen, die er oder sie im Alter erlebt, ausgegrenzt, isoliert oder diskriminiert werden darf.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Präsident Wolfgang Thierse:
Ich erteile das Wort Kollegen Walter Link, CDU/CSU-Fraktion.
Walter Link (Diepholz) (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem von der Bundesregierung vorgelegten Vierten Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland ist ein Spezialbericht verfasst worden, den der Ausschuss einvernehmlich gewürdigt hat.
Allen Fraktionen des Deutschen Bundestages ist es gelungen, dazu einen gemeinsamen Entschließungsantrag zu formulieren. Ich bedanke mich heute Morgen besonders bei dem Kollegen Haupt von der FDP-Fraktion – er kann leider nicht hier sein; Frau Lenke, bitte übermitteln Sie ihm den Dank –, der sich sehr engagiert hat, der Kollegin Graf von der SPD, der Kollegin Schewe-Gerigk von Bündnis 90/Die Grünen und meiner Kollegin Antje Blumenfeld,
die mehrfach zusammengesessen haben, um diesen gemeinsamen Entschließungsantrag zu formulieren. Ich sage dies, weil das bei uns im Hause in einer Frage, bei der es um beinahe ein Viertel der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland geht, die 60 Jahre und älter sind, gar nicht so selbstverständlich ist.
Der Vierte Altenbericht – erlauben Sie mir die Kurzform – befasst sich mit der Lebensqualität und den spezifischen Risiken sowie der sozialen, medizinischen und pflegerischen Versorgung alter und hochaltriger Menschen in Deutschland. Ein besonderer Schwerpunkt des Vierten Berichts sind die Auswirkungen von Hochaltrigkeit und Demenz. Aufgrund der höheren Lebenserwartung ist leider mit einer Zunahme von Demenzerkrankungen zu rechnen. Hierzu wird meine Kollegin Antje Blumenthal die Schwerpunkte setzen.
Es ist erfreulich, dass die Menschen bei uns in Deutschland immer älter werden. Die Lebenserwartung der Männer steigt von jetzt 74,4 Jahren auf 81,1 Jahre im Jahre 2050 und für Frauen von heute 80,5 Jahren auf 86,6 Jahre. An dieser Stelle möchte ich feststellen, dass es in Zukunft nur schön sein kann, immer älter zu werden, wenn man gesund alt wird. Mit dem Begriff der Hochaltrigkeit, der in der Forschung bei 80 bis 85 Jahren angesetzt wird, verbindet sich der Beginn eines deutlichen Anstiegs des Auftretens von Krankheiten, die die Lebensqualität der Betroffenen einschränken können. Es entspricht den Vorstellungen meiner Fraktion, der CDU/CSU, dass Menschen in allen Lebensabschnitten, also auch die Hochaltrigen, ein selbstständiges, selbstbestimmtes und würdevolles Leben führen können.
Allerdings gibt es für Hochaltrige kein einheitliches Bild. Die individuellen Unterschiede nehmen in hohem Alter stark zu. Es gibt die große Gruppe der rüstigen und die der pflegebedürftigen Menschen. Risikofaktoren können bei hochaltrigen Menschen depressive Störungen, beginnende Demenzprozesse, schwere Erkrankungen oder negative wirtschaftliche Verhältnisse sein. In Zukunft müssen wir viel deutlicher sagen, dass es in hohem Maß ein so genanntes normales Altern gibt. 70 Prozent der über 85-Jährigen können ihren Alltag selbstständig bewältigen. Aus diesem Grund müssen wir uns bei Beurteilungen des Alterns davor hüten, alles über einen Leisten zu schlagen.
Von großer Bedeutung sind im Alltag die Familienangehörigen, die Ärzte und die Pflegekräfte. Hier haben gute Generationenbeziehungen eine herausragende Bedeutung. Mehr als die Hälfte der 90-jährigen Pflegebedürftigen leben in privaten Haushalten. Sie werden von Frauen, Töchtern oder Enkeln versorgt und gepflegt. An dieser Stelle muss in unserer Gesellschaft die Frage erlaubt sein:
Ist die Pflege für unsere ältere Generation weiblich? Frau Kollegin Schewe-Gerigk, ich nehme Ihren Zwischenruf gerne auf: Wann werden hier Männer verstärkt mitarbeiten?
Den großartigen Einsatz, den die Menschen in der Familie für ihre älteren Angehörigen leisten, kann man also gar nicht hoch genug einschätzen. Deshalb setzt meine Fraktion, die CDU/CSU, nach wie vor auf generationenübergreifende familiäre Unterstützung und auch auf die häusliche Pflege.
Der CDU/CSU erscheint es wichtig, dass das Deutsche Zentrum für Alternsforschung in Heidelberg, das seit Jahrzehnten international anerkannte Alternsforschung leistet, in der jetzigen Form erhalten bleibt. Hier erinnere ich an die großartige Arbeit unserer ehemaligen Bundesministerin Frau Professor Ursula Lehr.
Bei einer Delegationsreise unseres seniorenpolitischen Ausschusses nach Japan haben wir erkannt, dass Forscher dort bereits große Fortschritte in der Alzheimerforschung gemacht haben. Man rechnet damit, dass in wenigen Jahren Erkennungsmethoden, Therapieansätze und Impfstoffe gegen Alzheimer einsatzbereit sein werden – ein großartiger Erfolg, der vielen Menschen und ihren Angehörigen das Leben erleichtern und auch die Pflegekassen entlasten wird. Herr Präsident, hier hat sich wirklich eine Auslandsreise unseres Ausschusses gelohnt; denn das, was wir dort gelernt haben, war großartig.
Um auch trotz Hilfe- und Pflegebedürftigkeit ein selbstständiges Leben im Alter zu führen, ist eine intensive Wohnberatung notwendig. Es bedarf eindeutiger, klarer Konzepte für Wohnanlagen des betreuten Wohnens. Neben professioneller Begleitung kommt auch der ehrenamtlichen Hilfe im Alltag eine große Bedeutung zu. Unsere Zukunftsplanung muss ein individueller Maßanzug werden, der für die Älteren und Hochaltrigen alle Lebenssituationen berücksichtigt. In diesem Zusammenhang gebe ich schon heute der Bundesregierung, Frau Bundesministerin, die Empfehlung und den Wunsch unserer Fraktion, bei der Reform der Pflegeversicherung den Pflegebegriff dahin gehend zu erweitern, dass auch ein allgemeiner Zeitraum für Betreuung stärker als bisher berücksichtigt wird.
Ich fasse zusammen: Meine Fraktion, die CDU/CSU, will, dass wir neue Wohnformen verwirklichen, die Selbstständigkeit, gegenseitige Hilfe, nachbarschaftsbezogenes, generationenübergreifendes Zusammenleben und professionelle Hilfe besser miteinander verbinden. Eine verstärkte Förderung von ehrenamtlichen Initiativen kann pflegende Familienangehörige entlasten. Ebenso hilft ihnen der Ausbau von Tagespflegeeinrichtungen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen und ambulanten Diensten.
Vergessen wir nicht: Familien in Deutschland leisten den Großteil der Pflege.
Fast 90 Prozent aller Pflegebedürftigen und chronisch Kranken in Privathaushalten werden von ihren Angehörigen betreut und gepflegt. Es gilt in Zukunft die Prozesse des Alterns noch mehr zu erforschen, um zu erfahren, was zum gesunden und kompetenten Altern beiträgt. Gerade im Bereich der Prävention fehlen noch vertiefte Kenntnisse. Wir wollen wissen, wie man im körperlichen, geistig-seelischen und sozialen Bereich die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Menschen bis ins hohe Alter erhalten kann. Es gilt die Forschungsergebnisse mit der praktischen Arbeit besser zu vernetzen.
Für meine Fraktion, die CDU/CSU, schlage ich deshalb vor, dass wir im Fünften Altenbericht das Thema „Alter und Kompetenz“, Frau Bundesministerin, stärker herausstellen
– ich glaube, darin sind wir uns einig –, damit wir die Zahlen, die ich gerade genannt habe, untermauern können.
Ich habe deutlich gemacht: Alter ist nicht von vornherein Leistungsabbau oder der Abbau körperlicher, geistiger und sozialer Fähigkeiten; Alter ist vor allem Kompetenz und Erfahrung.
Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ältere Ehrenamtliche sind für unsere Wirtschaft und Gesellschaft notwendig. Wir wollen helfen, den Menschen Wege zu zeigen, wie man noch besser aktiv altern kann.
Zum Abschluss danke ich den Millionen Menschen in unserem Land, die in der Wissenschaft, in der praktischen Arbeit und im Ehrenamt Großartiges für unsere ältere Generation leisten, insbesondere denen, die bis ins hohe Alter im Ehrenamt tätig sind.
Wir müssen uns darüber Gedanken machen, liebe Kolleginnen und Kollegen aus allen Fraktionen, wie wir insbesondere die Arbeit unserer Altenpflegerinnen und Altenpfleger besser bewerten.
Denn solange wir die Arbeit an den Menschen schlechter bezahlen als die Arbeit an der Maschine, läuft etwas falsch.
Nochmals herzlichen Dank für den gemeinsamen Entschließungsantrag. Lassen Sie uns gemeinsam an die Arbeit gehen. Die alten Menschen in Deutschland haben es verdient.
Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Präsident Wolfgang Thierse:
Ich erteile Kollegin Irmingard Schewe-Gerigk, Bündnis 90/Die Grünen, das Wort.
Irmingard Schewe-Gerigk (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Ja, Herr Kollege Kauder, jetzt kommt eine junge Alte – das ist ja ein guter Start.
Guten Morgen, Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Mit dem 4. Altenbericht hat die Sachverständigenkommission eine umfangreiche Bestandsaufnahme der Risiken, Lebensqualität und Versorgung hochaltriger Menschen vorgelegt. Die Kommission hat deutlich gemacht, dass die Möglichkeiten, sehr alt zu werden, in den industrialisierten Ländern erst in allerjüngster Zeit Wirklichkeit geworden sind. Somit ist– ich zitiere– „die Kultur der Integration alter und sehr alter Menschen in den Diskurs der Generationen“ eine noch neue Aufgabe, der wir uns künftig dauerhaft stellen müssen und– das sage ich für meine Fraktion– auch stellen wollen.
Selbstbestimmtes Leben ist für uns Grüne ein hohes Gut. Darum können wir uns mit dem Menschenbild der Kommission– nämlich der Realisierung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens in Würde auch im hohen Alter – nachdrücklich identifizieren. Im Zentrum meiner Rede stehen daher folgende Fragen: Was hindert Hochbetagte daran, ihre letzten Lebensjahre autonom, selbstbestimmt und in Würde leben zu können? Sind es ausschließlich krankheitsbedingte Einschränkungen oder haben wir ähnlich wie bei den „jungen Alten“ ein verzerrtes Bild von der Realität Hochbetagter? Wer weiß schon, dass 70 Prozent der über 85-Jährigen noch allein im Alltag zurechtkommen? Auch Herr Link hat das eben schon angesprochen.
Die Kehrseite der Medaille ist allerdings, dass 20 Prozent der über 80-Jährigen an Depressionen leiden, von denen 15 Prozent an einem Suizid sterben. Dass sich Menschen im Alter so allein und verlassen fühlen, muss uns ebenfalls zu denken geben.
Aber– das bestätigt die Sachverständigenkommission eindrücklich– wir wissen zu wenig über die Gesundheit, die Ressourcen und die Lebenszusammenhänge von Menschen über 85. Darum brauchen wir Forschungsstrategien, die zu einem besseren Verständnis des so genannten normalen und auch des pathologischen Alterns führen. Erst dann können wir Strategien erfolgreicher einsetzen.
In Deutschland ist die Versorgungsforschung im Gegensatz zur Medikamentenforschung leider noch sehr stark unterbelichtet. Dabei liegt es doch in unser aller Interesse, mehr darüber zu erfahren, welche Programme für die häufigsten Alterserkrankungen am erfolgreichsten sind. In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen: Welche Programme zur Frührehabilitation helfen Schlaganfallpatienten am besten dabei, wieder auf die Beine zu kommen? Welche Therapieformen helfen Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind, am besten? Wie kann durch eine fördernde Umgebung und durch Maßnahmen, die die Angehörigen einbeziehen, die Entwicklung einer schweren Form von Demenz hinausgezögert werden? Welche Sturzprophylaxen verhindern, dass hochbetagte Menschen dauerhaft gebrechlich werden?
Obwohl die Bundesregierung in den letzten Jahren bereits einige Forschungsprojekte zur Hochaltrigkeit auf den Weg gebracht hat, sind in den nächsten Jahrzehnten weitere Forschungsressourcen auf die genannten Bereiche zu konzentrieren. Um den Einsatz der Mittel zu optimieren, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Wissenschaftsdisziplinen in Netzwerken dringend geboten.
Schließlich müssen wir dafür sorgen, dass neue Erkenntnisse möglichst schnell bei den Berufsgruppen ankommen, die am häufigsten mit alten Menschen in Kontakt stehen. Sie werden es ahnen: Es geht hier um die Schlüsselrolle der Hausärzte und Hausärztinnen. Sie müssen in der Lage sein, frühe Hinweise auf eine Demenzerkrankung bei ihren alten Patienten und Patientinnen zu erkennen. Sie müssen diagnostische und therapeutische Maßnahmen in die Wege leiten und die Patienten und ihre Angehörigen beraten und begleiten. Denn wir wissen: Zwei Drittel der über 900 000 Demenzerkrankten werden zu Hause gepflegt.
Nicht nur die hohen volkswirtschaftlichen Kosten, sondern auch die psychischen und die physischen Belastungen für die Familienangehörigen, die Patientinnen und Patienten sowie die Professionellen müssen uns dazu veranlassen, die Ressourcen in diesem Bereich zu bündeln. Das heißt aber auch, dass bei der anstehenden Reform der Pflegeversicherung die Situation der Demenzerkrankten, die einen hohen Betreuungs- und Beaufsichtigungsaufwand haben, sehr dringlich berücksichtigt werden muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU/CSU, Sie wissen, dass wir dafür die Zustimmung des Bundesrates brauchen. Sie sollten sich nicht länger unseren Vorschlägen zum Subventionsabbau verweigern; denn dadurch frei werdende Gelder dienen auch dazu, die Situation dieser alten Menschen endlich zu verbessern.
Ich kehre nun zu meiner Ausgangsfrage zurück, welches die förderlichen Bedingungen sind, unter denen wir nicht nur älter werden, sondern die gewonnene Lebenszeit auch so selbstbestimmt und autonom wie möglich verbringen können. Aufgrund des Verhaltens der Älteren wissen wir, dass die Mehrheit ein Leben in der selbst gewählten Häuslichkeit anderen institutionellen Lösungen vorzieht. 90 Prozent aller alten Menschen möchten nicht in ein Heim, so das Ergebnis einer Befragung. Auch deshalb liegt das Durchschnittsalter beim Einzug in ein Heim bei 84 Jahren. Die in den letzten Jahren entstandene bunte Landschaft verschiedener Wohnprojekte, die sich als Alternative zum traditionellen Heim verstehen, bewerten wir als Indiz für diese erfreuliche Entwicklung.
Wir erleben vermehrt, dass sich junge Menschen und junge Alte – Herr Kauder, so haben Sie mich ja gerade genannt – ab 50 engagieren, um ihre Wohnsituation ihren Wünschen und Anforderungen an das Leben in hohem Alter anzupassen. Bei einigen Projekten spielen der gezielte Aufbau von sozialen Netzwerken und die Suche nach Wahlverwandten eine große Rolle, um Vereinsamung und Angewiesensein auf Fremdhilfe zu vermeiden. Zu der vielfältigen Landschaft neuer Wohnformen zählen Mehrgenerationenwohnen – hier leben also Jung und Alt zusammen –, Wohngemeinschaften für ältere Menschen, Haus- und Wohngemeinschaften für Demenzerkrankte – diese gibt es ansatzweise schon in Berlin – sowie Pflegewohnungen für sechs bis acht Personen in einem Stadtteil.
Bündnis 90/Die Grünen tritt entschieden für eine Verbesserung der Wahlmöglichkeiten von Älteren ein. Wir wollen, dass jeder und jede selbst entscheiden kann, ob er oder sie im Heim oder in einer anderen Wohnform leben will. Erfreulicherweise gibt es mittlerweile auch eine Reihe von Heimträgern, die sich mit der Frage befassen, wie sie diesem Trend folgen können, und die bereit sind, ihr Dienstleistungsangebot zu verändern. Experten gehen mittlerweile davon aus, dass eine Wohnumwelt, die an die Bedürfnisse älterer Menschen angepasst ist und eigenständiges Wohnen ermöglicht, das Risiko der Pflegebedürftigkeit vermindert. Wir ziehen daraus die Schlussfolgerung, dass überprüft werden muss, wie der Staat diese Entwicklungen fördern kann.
Oberste Priorität hat für uns die Förderung von Hilfe zur Selbsthilfe. Darüber hinaus ist zu überlegen, welche Maßnahmen geeignet sind, um Alternativen zum Heim auch für die Bevölkerungsgruppen zu erschließen, die nicht in der Lage sind, die entsprechenden Schritte zur Projektentwicklung selbst durchzuführen. Der Koalitionsantrag zur Stärkung des genossenschaftlichen Wohnens ermöglicht die Förderung von Modellvorhaben und Pilotprojekten unter ausdrücklicher Einbeziehung älterer Menschen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Die neuen Angebotsformen des betreuten Wohnens professioneller Anbieter bedürfen flankierender Maßnahmen zur Sicherung der Qualität solcher Angebote. Die Erfahrungen mit dem Qualitätssiegel „Betreutes Wohnen für ältere Menschen“ in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Bayern und beispielsweise die Aktivitäten des Vereins für Selbstbestimmtes Wohnen im Alter in Berlin sind in solche Überlegungen einzubeziehen. Ergänzend zur Förderung von selbstbestimmten Wohnformen im Alter benötigen wir aber weiterhin ein ausreichendes Angebot neuer und alter Dienstleistungen in den Bereichen Hauswirtschaft, Handwerk, ambulante Pflege, Gesundheitsförderung sowie spezielle Reiseangebote für ältere Menschen und die sie begleitenden Personen.
Angesichts der Vielfalt von Wahlmöglichkeiten für ältere Menschen haben wir in dem fraktionsübergreifenden Antrag zu diesem Thema – ich begrüße es ausdrücklich, dass wir es geschafft haben, einen solchen Antrag vorzulegen – bewusst auf integrierte Beratungsangebote gesetzt, um die Übersichtlichkeit der vorhandenen Hilfsangebote im Pflege- und Gesundheitsbereich zu erhöhen.
Aus unserer Sicht zählt zu diesen Beratungsangeboten auch der weitere Ausbau der Wohnberatung. Sie wird besonders bei Wohnungsanpassungen – die ja notwendig sind, wenn ältere Menschen in ihrer Wohnung bleiben wollen – tätig und kann nachweislich Heimeinweisungen vermeiden oder zumindest hinauszögern. Hier müssen wir tätig werden.
Angesichts der Reichweite dieses Themas begrüße ich noch einmal das Zustandekommen dieser Beschlussempfehlung. Wir haben noch viel zu tun. Lassen Sie uns das gemeinsam anpacken! Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen von der CDU/CSU wirklich darum, ihre Blockade aufzugeben, damit wir für die alten Menschen bald etwas tun können.
Vielen Dank.
Präsident Wolfgang Thierse:
Ich erteile das Wort Kollegin Ina Lenke, FDP-Fraktion.
Ina Lenke (FDP):
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Erlauben Sie mir zu Anfang ein Lob. Wir haben es gemeinsam geschafft, dafür zu sorgen, dass der 4. Altenbericht heute Morgen in der Kernzeit diskutiert wird. Das war nicht immer so. Wenn wir uns hier so ansehen, die jungen Alten und die etwas älteren Alten, dann stellen wir fest: Auch wir persönlich haben es nötig, hier darüber zu diskutieren.
Ich möchte an dieser Stelle natürlich ganz besonders Herrn Haupt danken.
Durch seine Anregungen wurde das, was heute Morgen vorliegt, überhaupt erst möglich.
Wir haben in der Diskussion schon deutlich gemacht, dass sich der 4. Altenbericht dem Thema Hochaltrigkeit – das ist das Alter jenseits des 80. Lebensjahres – widmet. Das Alter und das Altern gewinnen angesichts der demographischen Entwicklung ständig mehr Bedeutung. Wir reden zwar immer darüber, aber wir ziehen meines Erachtens nicht die richtigen Schlussfolgerungen. Da müssen wir noch besser werden. Wir müssen uns mit den Chancen und den Anforderungen einer älter werdenden Gesellschaft intensiv auseinander setzen. Das erfordert Umdenken in der Wirtschaft, in der Politik und natürlich auch in der Gesellschaft.
Wir alle wissen: Senioren und Seniorinnen verfügen über vielfältige Kompetenzen und Erfahrungen und wollen sich einbringen. Schauen Sie einmal vor Ort, wo das möglich ist: Wohin soll ein 55- oder 60-Jähriger gehen, wenn er etwas machen will? Wir wissen ebenfalls: Auch Männer wollen ehrenamtlich tätig sein. Aber in unserer Gesellschaft muss der Zugang zu ehrenamtlicher Tätigkeit für Männer wirklich verbessert werden. Da muss uns auf der kommunalen Ebene, auf der Landesebene und auf der Bundesebene noch etwas einfallen.
Der medizinische Fortschritt ist unaufhaltsam. Deshalb werden wir alle unser Alter aktiv und selbstbestimmt leben können. Gleichzeitig steigt natürlich die Zahl der Menschen über 80 und die der Krankheiten. Folgende Zahlen müssen wir uns vielleicht einmal genauer ansehen: Deutschland hat heute 82 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen. In 50 Jahren werden es, wenn die Zahl der Zuwanderer in unser Land nicht steigt und wenn nicht mehr Kinder geboren werden, statt 82 Millionen Einwohnern nur noch 65 Millionen sein. Wenn Sie nur an die Infrastruktur vor Ort denken, dann werden Sie sehen, wie dramatisch die Folgen auf allen Ebenen sind:
Im Jahre 2050 werden auf 100 Personen im Erwerbsalter circa 80 Rentnerinnen und Rentner kommen. Heute sind es nur die Hälfte, nämlich 40.
Also: Die Lebenserwartung steigt. Das hat auf unser tägliches Leben enorme Auswirkungen. Wie Frau Schewe-Gerigk gesagt hat, geht es dabei auch um Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und im persönlichen Umfeld. Beispielsweise wird der eigenen Wohnung bei häuslicher Pflege natürlich ein wesentlich höherer Stellenwert als heute zukommen.
Wir haben uns in unserer Beschlussempfehlung vier Themenschwerpunkte gesetzt:
Erstens. Stärkung der Alternsforschung. Ich meine, die Alternsforschung besitzt in Deutschland derzeit noch nicht den Stellenwert, den sie eigentlich haben sollte. Mit dem demographischen Wandel gehen gesellschaftspolitische, pflegerische, ökonomische und medizinische Herausforderungen einher. Da müssen wir wirklich etwas tun. Diese Probleme kann nicht allein der Bundestag bewältigen; dazu gehört eine verbesserte Alternsforschung.
Das Anliegen der FDP ist es, die Forschung in diesem Bereich zu fördern und die Datenbasis zu verbessern, damit wir hier die richtigen Beschlüsse fassen. Genau wie Frau Schewe-Gerigk und andere will ich darauf hinweisen, dass die Hausärzte natürlich die Ersten sind, die die besonderen, nicht gleich erkennbaren Symptome von Demenz und Depression erkennen könnten. Herr Parr hat mir eben noch den Tipp gegeben – Herr Parr, ich möchte das gerne weitergeben –, auf Folgendes hinzuweisen: Die FDP hat als erste Fraktion im Deutschen Bundestag dafür gesorgt, dass eine Anhörung über diese Schwierigkeiten und diese Probleme stattfindet.
Zweitens. Wohnen und Leben im Alter. Genau wie für die SPD, für die CDU/CSU und für die Grünen ist es für uns Liberale eine Selbstverständlichkeit, dass die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit für jeden Einzelnen in jedem Lebensalter besonders wichtig sind. Ich habe vorhin schon davon gesprochen, dass wegen der eingeschränkten Mobilität die Wohnungen anders gestaltet werden müssen.
Drittens. Pflegerische und medizinische Betreuung. Wir möchten gern eine integrierte Beratung schaffen. Diese Beratung soll den Bürgern ermöglichen, im Irrgarten der künftig zahlenmäßig immer mehr werdenden Hilfsangebote im Pflege- und Gesundheitsbereich den roten Faden nicht zu verlieren. Die Beratung sollte systemübergreifend sein und eine enge Verknüpfung von Altenhilfe und Rehabilitation gewährleisten.
Ich will noch darauf hinweisen – das ist für die FDP ganz wichtig –, dass Pflege, Betreuung und Beratung wesentlich individueller gestaltet werden müssen. Außerdem müssen wir auf sprachliche und kulturelle Besonderheiten Rücksicht nehmen. Wir haben Menschen in unser Land geholt, für die wir natürlich auch im Alter da sein müssen. Dafür haben wir noch keine Konzepte.
Viertens. Demenzrisiko und Leben mit Demenz. Die Zahl der Demenzkranken wächst. Bei den über 80-Jährigen ist heute jeder Dritte betroffen; das sind 900 000. Im Jahr 2020 werden es statt 900 000 dann 1,4 Millionen sein. Im Jahr 2050 – ich hoffe, dass viele von uns das Jahr noch erleben werden – werden es über 2 Millionen sein. Diese gesellschaftliche Herausforderung ist groß. Liebe Freunde, liebe Kollegen und Kolleginnen, lassen Sie das bitte nicht die letzte Diskussion sein! Die nächste Diskussion muss mit klaren und guten Konzepten verbunden sein.
Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass für die FDP eine Neuorientierung der Gesellschaftspolitik unumgänglich ist. Wir brauchen eine neue Generationensolidarität. Damit meine ich nicht, dass zum Beispiel auf dem Rücken der Zivildienstleistenden die Pflege der älteren Bevölkerung gesichert wird. Dafür müssen wir ganz andere Formen finden. Das Internationale Jahr der Senioren war schon 1999. Es hat viele Erkenntnisse gebracht. Aber leider ist danach Ruhe eingekehrt. Die FDP, ganz besonders Herr Haupt, wollte mit diesem Anstoß die Diskussion wieder beleben
und mit der heutigen Debatte im Bundestag erreichen, dass die Seniorenpolitik wieder ins Blickfeld gerückt wird.
Vielen Dank.
Präsident Wolfgang Thierse:
Ich erteile Kollegin Angelika Graf, SPD-Fraktion, das Wort.
Angelika Graf (Rosenheim) (SPD):
Herr Präsident! Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr alt, biblisch alt zu werden war schon immer der Traum der Menschheit, nicht nur wegen der angeblich damit verbundenen Weisheit. Der britische Schriftsteller und Gelehrte Tolkien, der Verfasser von „Herr der Ringe“, formuliert das so:
Und schließlich gibt es das älteste und tiefste Verlangen, die große Flucht: Dem Tod zu entrinnen.
Unsterblich ist freilich auch heute noch niemand. Trotzdem: Johannes Heesters tritt mit über 100 Jahren noch auf die Bühne. Berichte über ernst zu nehmende Forschungen erwecken den Eindruck, es sei künftig möglich, dem Menschen weit über sein 100. Lebensjahr hinaus ein Leben mit hoher Qualität zu ermöglichen.
Wie hochaltrige Menschen, also Menschen, die das 80. oder 85. Lebensjahr überschritten haben, heute in Deutschland leben, wie sich ihre Situation in den letzten Jahrzehnten verändert hat, was die Gründe dafür sind, wo aber auch die Probleme dieser Altersgruppe liegen, beschreibt der vorliegende Altenbericht. Wir können diesen Bericht aus dem Jahre 2002 heute hier behandeln, weil – Herr Link und alle anderen Vorredner haben das schon angesprochen – es in einer gemeinsamen Anstrengung aller Fraktionen gelungen ist, ihn aus der letzten Legislaturperiode sozusagen herüberzuholen. Ich bedanke mich ausdrücklich bei all denen, die daran mitgewirkt haben.
Das ist, meine ich, ein gutes Beispiel dafür, dass allen Medienberichten zum Trotz in diesem Parlament eine konstruktive und sachorientierte Zusammenarbeit möglich ist und dass wir die Chance dazu auch nutzen.
Der Bericht umfasst über 400 Seiten und ist ein gutes Kompendium für alle, die sich mit der gestiegenen Lebenserwartung, dem kollektiven und dem individuellen Altern der Menschen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten sowie den Folgen und Chancen dieser Entwicklung auseinander setzen wollen.
Ein weiteres plakatives Zahlenbeispiel dazu: 1965 wurden im Gebiet der alten Bundesrepublik 158 Menschen 100 Jahre und älter; 1998 waren es hier bereits 16-mal so viele, nämlich 2 501. Insgesamt feierten in ganz Deutschland 1998 fast 3 000 Personen ihren 100. Geburtstag, und das, obwohl zwei Weltkriege Unglück und Vernichtung über diese Generation gebracht haben, abzulesen etwa auch am Familienstand derer, über die wir sprechen.
Unter anderem wegen der in den letzten 60 Jahren verbesserten Lebenssituation wird die Zahl der Hoch- und Höchstaltrigen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten deutlich zunehmen. Professor Andreas Kruse, einer der profiliertesten Altersforscher der Bundesrepublik, geht von einem Anteil Über-60-Jähriger an der Gesamtbevölkerung im Jahre 2030 von 70,9 Prozent aus. Heute machen sie 43,9 Prozent aus. Der Prozentsatz der Hochaltrigen wird dann von heute 3,9 Prozent auf 7,3 Prozent der Gesamtbevölkerung angestiegen sein. Im Jahre 2050 wird jeder neunte Deutsche über 80 Jahre alt sein.
Dabei muss uns bewusst sein und bewusst werden: Wie jede Altersgruppe stellen auch Hochaltrige eine Gruppe dar, die weder bezüglich ihrer materiellen Ressourcen noch bezüglich ihrer Ansprüche und ihrer sozialen Integration oder ihrer geistigen, physischen und psychischen Lage homogen ist. Um menschenwürdiges Altern zu ermöglichen, müssen wir deshalb künftig individuelle Angebote für Pflege und gesellschaftliche Partizipation entwickeln.
Die Kollegin Riemann-Hanewinckel hat bereits auf die Modellprojekte der Bundesregierung hingewiesen, die in diese Richtung gehen.
Wer darüber nachdenkt, dem wird das Paradoxe an unserem Umgang mit dem Aspekt des hohen Alters klar werden. Während gesellschaftliche Rahmenbedingungen, eine verbesserte Ernährung und der medizinische Fortschritt auf komplexe Weise Langlebigkeit und demographischen Wandel vorantreiben, werden das Alter und insbesondere das hohe Alter in den Diskussionen nicht selten nur als Last und Bedrohung interpretiert. Ich erinnere an die vielfältigen Diskussionen um die zukünftige Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme und an die unselige „Hüftgelenkdebatte“ in den Reihen der Jungen Union, die deutlich gemacht hat, wie sehr der gesellschaftliche Umgang mit Menschen hohen Alters auf dem Prüfstand steht.
Für die Kommission, die den 4. Altenbericht verfasst hat, stand die Legitimität der Solidarleistungen für Menschen hohen Alters übrigens völlig außer Frage. Dem schließe ich mich für die SPD-Bundestagsfraktion ausdrücklich an.
Trotz der in dieser Debatte vorherrschenden Harmonie sei die Bemerkung erlaubt, dass das SPD-Konzept einer Bürgerversicherung dafür wohl mehr Gewähr bietet als das Unionskonzept einer Kopfpauschale.
Eine umfassende Aufarbeitung des Themas Hochaltrigkeit, wie sie der 4. Altenbericht vornimmt, in wenigen Minuten zu würdigen und alle Details zu beleuchten ist schier unmöglich. Das zeigen auch die Redebeiträge der Vorredner. Deshalb einige kurze Ausblicke auf wesentliche Themen, die uns neben der angesprochenen Versicherungsproblematik, welche sicher auch einen wichtigen Aspekt darstellt, in den nächsten Jahren stark beschäftigen müssen.
Da ist einerseits die Wohnsituation, die schon angesprochen wurde. Mindestens 85 Prozent der Menschen aus der Altersgruppe jenseits der 80 leben im eigenen Haushalt oder in Privathaushalten ihnen nahe stehender Personen. Die Anzahl der allein lebenden hochaltrigen Personen nimmt deutlich zu. Insbesondere alte Frauen wollen, solange es irgend geht, in den eigenen vier Wänden leben. Ich kann das gut verstehen. Wir sollten alle unsere Ressourcen in Forschung und Entwicklung – Stichwort Gerontotechnik – nutzen, um ihnen dieses selbstbestimmte Leben so lange wie möglich zu ermöglichen.
Dazu gehört auch eine Wohnung, die ihren Bedürfnissen entgegenkommt, eine Wohnung zum Beispiel, in der Türschwellen nicht zu Stolperfallen werden, wo das Bad auch für bewegungseingeschränkte Menschen nutzbar ist, eine Wohnung, die es schon allein von ihrer Lage zulässt, dass soziale Kontakte weiterhin gepflegt werden können. Eine Wohnung im vierten Stock ohne Lift macht das in vielen Fällen unmöglich. Das sind Kriterien, die übrigens nicht erst für Hochaltrige, sondern auch schon für Familien wichtig sein können. In dieser Hinsicht fehlt – ich denke, da sind auch die Bundesländer gefragt – ein entsprechendes Beratungsnetz, Stichwort: Networking. Beispielhaft sei in diesem Zusammenhang die verstärkte Zusammenarbeit von Pflegekasse, Kommune und Koordinierungsstelle im Kreis Ennepetal in Nordrhein-Westfalen erwähnt.
Verbessert werden muss generell auch die Integration von familiärer, professioneller und ehrenamtlicher Arbeit im Bereich der Betreuung und Pflege. Wir sind da auf einem guten Weg. Ich verweise auf die von der Staatssekretärin angesprochenen ausgezeichneten Modellprojekte des Bundes für neue Altenhilfestrukturen.
Moderne Pflegestrukturen werden auch bei der künftigen Ausgestaltung der Pflegeversicherung zu beachten sein. Ebenso muss der im hohen Alter beobachtete starke Anstieg demenzieller Erkrankungen berücksichtigt werden. Insbesondere die Alzheimerdemenz, gegen deren Ausbruch trotz weltweiter Forschung im pharmakologischen Bereich – der Kollege Link hat es hier schon angesprochen – noch kein klinisch einsetzbares Mittel gefunden wurde, wird uns vor immer größere Herausforderungen stellen. Ist doch inzwischen erwiesen, dass für den Verlauf dieser Erkrankungen neben der rechtzeitigen Erkennung der Symptome – die Schulung der Hausärzte sei hier angesprochen – zum Beispiel auch die räumliche Umgebung, sprich: die Wohnsituation, eine große Bedeutung hat. In Japan und Italien gibt es inzwischen Wohnprojekte mit dörflichem Charakter für demente Seniorinnen und Senioren, durch die die Lebenssituation der Betroffenen sehr positiv beeinflusst werden kann. Aus den skandinavischen Ländern erwähne ich die „heilenden Gärten“ für Demenzerkrankte. Dieser Beitrag der Landschaftsarchitektur zeigt, dass auch die Versorgung der Hochaltrigen den Einbezug vielfältiger gesellschaftlicher Gruppen erfordert.
So wie in Altenheimen Frauen den Großteil der Bewohner stellen – es ist schon gesagt worden, dass das Alter weiblich ist –, sind Frauen über 80 Jahre auch prozentual doppelt so häufig von Demenz betroffen wie Männer. In der leider etwas männerdominierten Alternsforschung kommt dieser Gesichtspunkt bislang eher zu kurz. In dem Entschließungsantrag wird deshalb zu Recht die Förderung der Alternsforschung unter besonderer Berücksichtigung frauenspezifischer Lebensläufe gefordert, die eben auch ein frauenspezifisches Altern beinhalten.
Hier wird in Zukunft mehr und mehr die Tatsache eine Rolle spielen, dass sich die Lebens- und Familiensituation von Frauen in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert hat. Ich halte es deshalb für dringend notwendig, wissenschaftliche Forschungsinitiativen zu dieser Thematik auch im Hinblick auf die Hochaltrigkeit stärker einzufordern. Nicht unerwähnt möchte ich lassen – auch das ist schon angesprochen worden –, dass auch im Bereich der Pflege das Alter vorwiegend weiblich ist. Viele Frauen sind oft unter Hintanstellung eigener Bedürfnisse und bis an die Grenze ihrer Kraft für ihre pflegebedürftigen Angehörigen da. Ihnen gebührt Dank.
Wir haben neulich das Einsteinjahr ausgerufen. Als Vertreterin einer Generation, die sozusagen an der Schwelle des Alters ist, möchte ich deshalb ein Zitat dieses großen Deutschen bemühen. Einstein sagte:
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft. Denn in ihr gedenke ich zu leben.
Die Altenberichte der Bundesregierung beschreiben, auf welcher Grundlage ich und wir alle dies tun können und wo die politischen Handlungsfelder sind. Sie geben Anleitung, wie wir ganz persönlich Vorsorge treffen können und müssen. Geistige Beweglichkeit und Lebensqualität können zum Beispiel trotz altersbedingter Beschwerden erhalten werden durch Lesen, Begegnung mit Gleichaltrigen oder der Jugend und die Teilnahme am öffentlichen Leben.
Lebenslanges Lernen wird ein Stichwort sein, mit dem wir uns im nächsten, also im 5., Altenbericht beschäftigen. Er hat das aktive Altern zum Thema und zeigt die Potenziale auf, die die „geschenkten Jahre“, wie unsere Bundesministerin Renate Schmidt die Zeit zwischen Beendigung des Arbeitslebens und Hochaltrigkeit nennt, in sich bergen.
Wir müssen – davon bin ich fest überzeugt – wegkommen von der pessimistischen Diskussion über die Last des Alterns und wir müssen, ohne Altern, Pflege und Tod zu verharmlosen, hinkommen zu einer optimistischeren Wahrnehmung der Chancen, die dieser Lebensabschnitt in sich birgt. Denn Menschen – auch das bestätigt der Altenbericht zur Hochaltrigkeit –, die das Leben positiv sehen, werden älter – biblisch alt.
Präsident Wolfgang Thierse:
Ich erteile das Wort Kollegin Antje Blumenthal, CDU/CSU-Fraktion.
Antje Blumenthal (CDU/CSU):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Präsident, gestatten Sie mir eine Bemerkung vor Beginn meines Debattenbeitrages. Lieber Walter Link, es ehrt mich, dass der Name meines Hamburger Kollegen Erik Blumenfeld hier noch so lange nachwirkt. Aber ich bin mit einem Mann namens Blumenthal verheiratet; darauf lege ich Wert.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, in dem 4. Altenbericht aus dem Jahre 2002 wird erstmals der Schwerpunkt auf eine umfassende Analyse der Situation hochaltriger Menschen unter besonderer Berücksichtigung von Demenzerkrankungen gesetzt; das ist hier schon mehrfach erwähnt worden. Diesen Bericht haben wir im Ausschuss einstimmig gewürdigt. Die Analyse wurde von allen nachdrücklich begrüßt. In dem bereits mehrfach erwähnten gemeinsamen Entschließungsantrag haben wir die notwendigen Konsequenzen dargelegt: die Stärkung der Altersforschung, die Erarbeitung neuer Konzepte zum Wohnen und Leben im Alter, die Verbesserung der pflegerischen und medizinischen Betreuung und die Verbesserung der Früherkennung.
Der Bericht widmet sich dem zentralen demographischen Problem, das unser Land in den kommenden Jahrzehnten zu meistern hat: der Zunahme des Bevölkerungsanteils hochaltriger Menschen, also derjenigen Menschen, die das 80. Lebensjahr überschritten haben. Sehr alte Menschen sind schon heute sehr zahlreich in unserer Gesellschaft vertreten. Es werden in Zukunft noch mehr sein.
Es ist natürlich höchsterfreulich, dass uns allen der medizinische Fortschritt ein immer längeres Leben beschert. Deshalb müssen wir als die Verantwortlichen in der Politik die Herausforderung annehmen, die eine zunehmende Alterung der Gesellschaft mit sich bringt. Inwieweit der demographische Wandel unsere Gesellschaft vor neue Herausforderungen stellt, hat uns die Enquete-Kommission „Demographischer Wandel“ eindringlich vor Augen geführt. Ich denke, die in der Enquete-Kommission erarbeiteten Zahlen und Berechnungen dürften uns allen noch hinlänglich bekannt sein.
„Umgedrehte Alterspyramide“, „Kinderlosigkeit“, „Überalterung der Gesellschaft“ oder auch „kinderfeindliche Gesellschaft“ sind zu mahnenden Begriffen geworden, wenn es darum geht, die Zukunft unter sich wandelnden demographischen Vorzeichen zu gestalten. Die dramatische Veränderung der Altersstruktur in Deutschland muss daher unbedingt aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet werden.
Heute hat Deutschland 82 Millionen Einwohner. Schätzungen zufolge wird die Bevölkerung in 50 Jahren nur noch 65 Millionen stark sein.
Die Gründe liegen wie bereits in den vergangenen drei Jahrzehnten in einer höheren Sterbe- als Geburtenrate – und das nicht etwa deswegen, weil die Sterberate in Deutschland so unglaublich hoch wäre. Nein, die Brisanz der Zahlen liegt vielmehr darin begründet, dass wir eine erschreckend niedrige Geburtenrate bei gleichzeitig abnehmenden Sterberaten haben.
Aber heute sind nicht die niedrigen Geburtenraten das Thema; heute sollen uns vielmehr die Konsequenzen der gleichzeitig abnehmenden Sterberaten interessieren, die nachhaltig zu einer Zunahme des Anteils alter Menschen an der Gesamtgesellschaft und insbesondere zu einer Zunahme des Anteils der Hochaltrigen führen. Dieser Anteil wird sogar überproportional zunehmen und entsprechende Umstrukturierungen in Gesellschaft und Wirtschaft unumgänglich machen. Genau diese Umstände werden in dem 4. Altenbericht unter dem Leitbild dokumentiert, dass Menschen in allen Lebensabschnitten, das heißt auch in der Hochaltrigkeit und bei Demenzerkrankungen, ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben führen können.
In dem 4. Altenbericht wird insbesondere festgehalten, dass die rasch anwachsende Gesellschaft der Hochaltrigen keineswegs homogen ist. Hochaltrige Menschen bilden weder eine Gruppe der Rüstigen noch sind sie in der Gesamtheit als stark pflegebedürftig einzustufen. Im Gegenteil: Individuelle Unterschiede nehmen mit dem Alter zu.
Allerdings ist ein Problem immer wieder mit dem hohen Alter in Verbindung zu bringen: das Problem demenzieller Erkrankungen. Mit steigendem Alter nimmt das Risiko einer solchen Erkrankung deutlich zu. Der 4. Altenbericht befasst sich also aus gutem Grund mit diesem zentralen Problem. Es wird ein erheblicher Handlungsbedarf in den Bereichen Forschung, Früherkennung, Behandlung und Pflege festgestellt.
Vor allem im Hinblick auf den Bereich der Pflege demenzkranker Menschen zeichnet die Kommission der Sachverständigen ein erschreckendes Bild. Zwei Drittel der Menschen mit Demenzerkrankungen werden zu Hause von ihren Angehörigen versorgt, für die die Betreuung und Pflege nicht nur eine große Herausforderung, sondern auch eine Belastung darstellt. Wenn nun aber die ehrenamtliche Hilfe durch professionelle Hilfe ersetzt werden muss, das familiennahe Pflegepotenzial wegen sinkender Geburtenrate, erhöhter Mobilität und zunehmender Berufstätigkeit der Frauen zurückgeht, die familiäre Solidarität durch hohe Scheidungsraten abnimmt und auch die Bereitschaft und die Fähigkeit der Angehörigen, Demenzkranke zu pflegen, abnimmt, dann rollt eine ganz gewaltige Kostenlawine auf uns zu, die im Grunde genommen nur eine Option zulässt, nämlich jetzt zu handeln und nicht erst, wenn es zu spät ist.
Dabei sollten wir auch die Erfahrungen anderer Länder berücksichtigen, zum Beispiel Japans, das weltweit eine der höchsten Lebenserwartungen ausweist. Die Japanreise von sechs Mitgliedern unseres Ausschusses hat uns gezeigt, dass dort große Fortschritte in der Demenzforschung gemacht werden, etwa bei der Früherkennung und der Entwicklung eines Impfstoffes. Der Blick über den Tellerrand kann uns allen hier nur nützlich sein. Ich denke, das sind wir den älteren Menschen schuldig.
Ich möchte auf zwei Bereiche unseres gemeinsamen Entschließungsantrags ganz besonders hinweisen: die pflegerische und medizinische Betreuung sowie das Demenzrisiko bzw. das Leben mit Demenz. Die zunehmende Alterung der Gesellschaft bedingt automatisch einen Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen. Nach den Schätzungen des Statistischen Bundesamtes dürfte die Zahl der Frauen und Männer, die ambulante häusliche oder stationäre Pflege benötigen, von 2 Millionen Bedürftigen im Jahre 2001 auf 2,8 Millionen Bedürftige im Jahre 2020 steigen. Schon jetzt hat sich die Situation der Einrichtungen der stationären Altenhilfe bundesweit grundlegend geändert. Altenwohnheime bzw. Altenheimplätze wurden in Pflegeheimplätze umgewandelt. Bei neuen Einrichtungen dominiert ganz eindeutig die Zahl der Pflegeplätze. Das durchschnittliche Einzugsalter liegt bei über 80 Jahren. Nicht zuletzt ist die Altersdemenz mehr und mehr Ursache für den Umzug in eine stationäre Pflegeeinrichtung. Allein aufgrund dieser Veränderungen wird von der Altenpflege eine deutlich höhere Leistungsqualität gefordert.
Angesichts der veränderten Familien- und Haushaltsstrukturen wird die Nachfrage nach professionellen Pflegekräften und einer teilstationären Betreuung künftig weiter ansteigen. Die in Deutschland zu erwartenden demographischen Herausforderungen sind jedoch nicht allein mit einer Verschiebung zur stationären Versorgung zu lösen. Daher muss die einseitige Orientierung an den Vorschriften für die traditionelle Versorgungsform eines herkömmlichen Alten- und Pflegeheimes durch alternative Wohnkonzepte ergänzt werden, die den Betrieb von ambulanten und teilstationären Hausgemeinschaften fördern. Meine Heimatstadt Hamburg geht hier mit gutem Beispiel voran: Zusammen mit den Pflegekassen werden dort jährlich etwa 250 000 Euro für Modellprojekte und Angebote zur Weiterentwicklung der ambulanten Betreuung insbesondere von demenzkranken Menschen zur Verfügung gestellt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Deutschland ist im stationären und im ambulanten Bereich in naher Zukunft flächendeckend ein Pflegepersonalmangel zu erwarten, der die pflegerische Versorgung der Menschen gefährlich infrage stellt. Das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung benennt hier drei zentrale Problemfelder: personelle Engpässe, eine steigende Arbeitsbelastung und die abnehmende Eignung der Bewerber. Schon jetzt führt dieser Mangel dazu, dass zum Teil ethisch bedenkliche Entscheidungen getroffen werden. Die Früherkennung und die Frühbehandlung von Demenzkrankheiten können helfen, diese Probleme zu vermindern. Wenn die betroffenen Menschen länger in ihren Familien oder auch allein leben können, zum Beispiel in den eben angesprochenen Wohnmodellen, ist das mit einem deutlichen Zuwachs an Lebensqualität bei möglicherweise gleichzeitiger Reduzierung der Pflegekosten verbunden. Die Demenzfrüherkennung muss daher dringend optimiert werden, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, über eine frühzeitige Behandlung möglichst lange ein eigenständiges Leben zu führen und die Lebensqualität zu verbessern bzw. zu erhalten.
Wir reden hier heute über einen gemeinsamen Antrag unseres Ausschusses. Es gibt jedoch einige Unstimmigkeiten. So sprechen Sie, Frau Schewe-Gerigk, hier von einer Blockadehaltung unserer Fraktion.
Nennen Sie lieber Ihre Einschätzungen der Verbesserung der Pflegesituation! Meines Wissens werden die Entscheidungen von der SPD-Fraktion hinausgeschoben. Es wird ausgesessen. In dieser Legislaturperiode soll es hier zu keinen Entscheidungen mehr kommen.
Ich weiß jetzt nicht, wo hier bei uns eine Blockadehaltung vorliegt.
– Von der hat sie hier nicht gesprochen, Herr Winkler. Ich glaube, Sie waren zu diesem Zeitpunkt nicht hier.
Schauen Sie nachher einmal im Protokoll nach!
Leider haben Sie, meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, auch eine weitere wichtige Chance vertan: die Frühbehandlung von Demenz zu verbessern. Sie haben im Mai vergangenen Jahres einen Antrag zur Demenz eingebracht. Darin heißt es lediglich, dass die bereits ergriffenen Initiativen zur Verbesserung der Früherkennung und zur Therapie von Demenzerkrankungen zügig weiterzuführen sind. Wenn Sie genau nachlesen, stellen Sie jedoch fest: Der Vierte Altenbericht rügt gerade diese Initiativen als nicht ausreichend. Diese nicht ausreichenden Initiativen wollen Sie also weiterentwickeln.
Deshalb hat meine Fraktion bereits in einem Entschließungsantrag vom Januar des vergangenen Jahres unter anderem den Ausbau der Gerontologie gefordert. Der Ausbau der Alters- und Demenzforschung allein wird nicht ausreichen, um den genannten Problemen entgegenzutreten. Die Herausforderung durch die wachsende Zahl demenzkranker Menschen erfordert eine gesellschaftlich breit angelegte Informations-, Qualifizierungs- und Präventionskampagne. Auch in diesen Bereichen können wir von den Erfahrungen in anderen Ländern profitieren.
Zum Abschluss insbesondere wieder an die Regierungskoalitionen gerichtet: Der Vierte Altenbericht endet mit 77 konkreten Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Lage Demenzkranker. Wenn wir mit unserem Entschließungsantrag, der Ihnen heute vorliegt, diese 77 Handlungsempfehlungen gemeinsam auf den Weg bringen können, tun wir eine ganze Menge zur Verbesserung der Situation demenzkranker Menschen. Wir sollten uns hier nicht gegenseitig Vorwürfe machen, sondern uns gemeinsam im Interesse der älteren und demenzkranken Menschen einsetzen.
Vielen Dank.
Präsident Wolfgang Thierse:
Ich schließe die Aussprache.
Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Vierten Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland und zur Stellungnahme der Bundesregierung, Drucksache 15/4192. Der Ausschuss empfiehlt, in Kenntnis des Berichts auf Drucksache 14/8822 eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Gegenprobe! – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung ist einstimmig angenommen.
[Der folgende Berichtsteil – und damit der gesamte Stenografische Bericht der 155. Sitzung – wird am
Montag, den 31. Januar 2005,
an dieser Stelle veröffentlicht.]