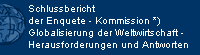3.8.1.3 Amerikanische Hegemonie
und Freihandel
Es ist bekannt, dass die Vereinigten Staaten
Japan immer wieder wegen seiner Verstöße gegen
Freihandelsprinzipien kritisieren. Anfang der 90er Jahre, als die
japanische Konkurrenz geradezu bedrohlich schien, gab es in den USA
zugleich eine intensive wissenschaftliche Debatte darüber,
worauf denn diese illiberalen Züge des japanischen
Wirtschaftssystems zurückzuführen seien. In dieser
Debatte wurde bezweifelt, dass das System seine Wurzeln in der
eigenen kulturellen und politischen Tradition habe und auf die
außerordentliche Lern- und Anpassungsfähigkeit der
Japaner gegenüber der westlichen Zivilisation hingewiesen. So
sei es in Bezug auf die außenwirtschaftliche Strategie der
deutsche Volkswirtschaftler Friedrich List gewesen, an dem sie sich
orientiert habe.
Wir erinnern uns: Friedrich List war insofern
der bedeutendste Kritiker der Freihandelsdoktrin, als er sie mit
der Entwicklungsproblematik (wie sie im 20. Jahrhundert erst
genannt wurde) konfrontierte. Wie wir sahen, lag die Pointe von
Ricardos Theorie gerade darin, sogar extreme
Entwicklungsunterschiede zwischen Ländern nicht infrage zu
stellen, sondern als gegeben hinzunehmen und zu zeigen, wie sie
fruchtbar gemacht werden können für das „Wohl der
Menschheit“.
Zu diesem Akzeptieren der Unterschiede war
List nicht bereit, denn er sah, dass die so verstandene
internationale Arbeitsteilung allzu viel mit dem „Teile und
herrsche“ Großbritanniens zu tun hatte. Zum Wohl der
Menschheit gehörte für ihn, dass möglichst viele
Nationen „eine möglichst gleiche Stufe der Industrie und
Zivilisation“ erreichen mussten, und dazu war seiner Meinung
nach ein befristeter Protektionismus („Erziehungszoll“)
gegenüber der Exportmacht Englands unumgänglich. List
lehnte also den Freihandel nicht pauschal ab, sondern hielt seine
Durchsetzung ohne Entwicklungspolitik für verfrüht und
kontraproduktiv. „Dem System der Schule liegt also eine wahre
Idee zugrunde – eine Idee, welche die Praxis nicht verkennen
darf, ohne auf Abwege zu geraten. Nur hat die Schule unterlassen,
die Natur der Nationalitäten und ihre besonderen Interessen
und Zustände zu berücksichtigen und sie mit der Idee der
Universalunion und des ewigen Friedens in Übereinstimmung zu
bringen. Die Schule hat einen Zustand, der erst werden soll, als
wirklich bestehend angenommen. Sie setzt die Existenz einer
Universalunion und des ewigen Friedens voraus und folgert daraus
die großen Vorteile der Handelsfreiheit. Auf diese Weise
verwechselt sie die Wirkung mit der Ursache. Dass aber unter den
bestehenden Weltverhältnissen aus allgemeiner Handelsfreiheit
nicht die Universalrepublik, sondern die
Universaluntertänigkeit der minder vorgerückten Nationen
unter die Suprematie der herrschenden Manufaktur-, Handels- und
Seemacht erwachsen müsste, dafür sind die Gründe
sehr stark und nach unserer Ansicht unumstößlich. Ein
Verein der Nationen der Erde, wodurch sie den Rechtszustand unter
sich anerkennen und auf die Selbsthilfe Verzicht leisten, kann nur
realisiert werden, wenn viele Nationalitäten sich auf eine
möglichst gleiche Stufe der Industrie und Zivilisation, der
politischen Bildung und Macht emporschwingen“ (List 1982:
142). Entsprechend wollte er auch keineswegs zum Merkantilismus
zurück: Die Entwicklung der eigenen Industrie dient in seinem
„System“ nicht dazu, um durch Importsubstitution oder
Exportsteigerung die finanzielle Macht der Nation zu stärken,
sondern ist in gewisser Hinsicht Selbstzweck, nämlich
wesentlicher Teil der Entwicklung der „produktiven
Kräfte“. Auf sie kommt es nach List an, weshalb er sich
konsequenterweise auch gegen die Reduktion von
„Reichtum“ auf Tauschwert wendet und z. B. Bildung und
Forschung in den Begriff einbezieht. Was er meint, berührt
sich sehr stark mit dem heutigen Begriff „systemische
Wettbewerbsfähigkeit“, wie die folgende, zugleich
unterhaltsame Polemik gegen den Vulgärliberalismus („die
Schule“) zeigt: „Wer Schweine erzieht, ist nach ihr ein
produktives, wer Menschen erzieht, ein unproduktives Mitglied der
Gesellschaft. Wer Dudelsäcke oder Maultrommeln zum Verkauf
fertigt, produziert; die größten Virtuosen, da man das
von ihnen Gespielte nicht zu Markte bringen kann, sind nicht
produktiv. Der Arzt, welcher seine Patienten rettet, gehört
nicht in die produktive Klasse, aber der Apothekerjunge, obgleich
die Tauschwerte oder die Pillen, die er produziert, nur wenige
Minuten existieren mögen, bevor sie ins Wertlose
übergehen. Ein Newton, ein Watt, ein Kepler sind nicht so
produktiv als ein Esel, ein Pferd oder ein Pflugstier, welche
Arbeiter in neuerer Zeit von Herrn McCulloch in die Reihe der
produktiven Mitglieder der menschlichen Gesellschaft
eingeführt worden sind“ (List 1982: 158).
 Nun wird in jener
amerikanischen Debatte immerhin erwähnt, dass List wiederum
durch Erfahrungen beeinflusst sei, die er in den USA gemacht habe,
wohin er 1825 auswandern musste. In der Tat schreibt er selber im
Vorwort zu seinem Hauptwerk, dass ihm das Leben in den USA den
Gedanken der stufenweisen Entwicklung der Volkswirtschaft gelehrt
habe. Aber das ist nicht alles. Schon zwei Jahre nach seiner
Einwanderung wurde er berühmt durch die Veröffentlichung
von „Zwölf offenen Briefen“ an den
Präsidenten einer einflussreichen Gesellschaft in
Philadelphia, in denen er die liberale Ökonomie kritisierte
und die Grundzüge seiner eigenen Theorie darstellte (List
1982: XVIIf.). Wieso wurde er dadurch sofort berühmt? Weil die
Vereinigten Staaten selber gerade zu dieser Zeit sehr hohe
Zollmauern aufrichteten, die unter dem Namen „American System
of Political Economy“ in die Geschichte eingingen! Die
Parallele zum Titel des Listschen Hauptwerkes dürfte
auffallen. Aber das war so neu nicht in der amerikanischen Politik.
Schon zu Beginn des 19.Jahrhunderts bestand die wichtigste
Maßnahme zur Überwindung der Rückständigkeit
gegenüber Großbritannien in der Einführung von
Schutzzöllen. Und sie wurden noch erhöht, als nach dem
Krieg von 1812 bis 1815 eine Flut billiger britischer Textilien die
junge Texti l indus trie in Massachusetts zu
erdrücken drohte (Adams 1977 171). Die theoretischen
Grundlagen für diesen massiven Protektionismus aber waren
schon 1790 von Alexander
Hamilton, dem ersten amerikanischen Finanzminister, gelegt worden.
In seinem „Report on Manufactures“ stellte er
nämlich klar, dass von einer wirklichen Unabhängigkeit
der Neuenglandstaaten erst dann die Rede sein kann, wenn sie nicht
mehr von Importen aus dem ehemaligen Mutterland abhängen,
sondern ihre eigenen Manufakturwaren herstellen würden.
Hier taucht zum ersten Mal das Listsche Argument des
Erziehungszolls auf (Menzel 1992: 81). Symbolischen Ausdruck gab
George Washington selber dieser Einsicht, indem er am Tag seiner
Inauguration 1789 bewusst Kleidung von inländischem Tuch trug,
„um“ – wie eine New Yorker Zeitung schrieb
– „in der einfachen und ausdrucksvollen Weise, die
diesem großen Manne eigen ist, allen seinen Nachfolgern im
Amte und allen künftigen Gesetzgebern eine unvergess
liche Lehre zu geben, auf welche Weise die Wohlfahrt des Landes zu
befördern sei“ (List 1982: 115). Nun wird in jener
amerikanischen Debatte immerhin erwähnt, dass List wiederum
durch Erfahrungen beeinflusst sei, die er in den USA gemacht habe,
wohin er 1825 auswandern musste. In der Tat schreibt er selber im
Vorwort zu seinem Hauptwerk, dass ihm das Leben in den USA den
Gedanken der stufenweisen Entwicklung der Volkswirtschaft gelehrt
habe. Aber das ist nicht alles. Schon zwei Jahre nach seiner
Einwanderung wurde er berühmt durch die Veröffentlichung
von „Zwölf offenen Briefen“ an den
Präsidenten einer einflussreichen Gesellschaft in
Philadelphia, in denen er die liberale Ökonomie kritisierte
und die Grundzüge seiner eigenen Theorie darstellte (List
1982: XVIIf.). Wieso wurde er dadurch sofort berühmt? Weil die
Vereinigten Staaten selber gerade zu dieser Zeit sehr hohe
Zollmauern aufrichteten, die unter dem Namen „American System
of Political Economy“ in die Geschichte eingingen! Die
Parallele zum Titel des Listschen Hauptwerkes dürfte
auffallen. Aber das war so neu nicht in der amerikanischen Politik.
Schon zu Beginn des 19.Jahrhunderts bestand die wichtigste
Maßnahme zur Überwindung der Rückständigkeit
gegenüber Großbritannien in der Einführung von
Schutzzöllen. Und sie wurden noch erhöht, als nach dem
Krieg von 1812 bis 1815 eine Flut billiger britischer Textilien die
junge Texti l indus trie in Massachusetts zu
erdrücken drohte (Adams 1977 171). Die theoretischen
Grundlagen für diesen massiven Protektionismus aber waren
schon 1790 von Alexander
Hamilton, dem ersten amerikanischen Finanzminister, gelegt worden.
In seinem „Report on Manufactures“ stellte er
nämlich klar, dass von einer wirklichen Unabhängigkeit
der Neuenglandstaaten erst dann die Rede sein kann, wenn sie nicht
mehr von Importen aus dem ehemaligen Mutterland abhängen,
sondern ihre eigenen Manufakturwaren herstellen würden.
Hier taucht zum ersten Mal das Listsche Argument des
Erziehungszolls auf (Menzel 1992: 81). Symbolischen Ausdruck gab
George Washington selber dieser Einsicht, indem er am Tag seiner
Inauguration 1789 bewusst Kleidung von inländischem Tuch trug,
„um“ – wie eine New Yorker Zeitung schrieb
– „in der einfachen und ausdrucksvollen Weise, die
diesem großen Manne eigen ist, allen seinen Nachfolgern im
Amte und allen künftigen Gesetzgebern eine unvergess
liche Lehre zu geben, auf welche Weise die Wohlfahrt des Landes zu
befördern sei“ (List 1982: 115).
Wenn also die
Vereinigten Staaten heute Japan wegen seiner Unzuverlässigkeit
in Freihandelsfragen kritisieren, so kritisieren sie zugleich ihre
eigene Vergangenheit, und da ihre Gegenwart auf ihrer Vergangenheit
beruht, so kritisieren sie eigentlich sich selbst. Warum tun sie
das jedoch faktisch nicht? Hier spielt zunächst wieder das
unwillkürliche Vergessen der Sieger eine Rolle, das wir oben
schon bemerkt haben: Auch wenn ich gestern noch dasselbe getan
habe, was der andere heute tut, und davon auch heute noch lebe, so
kann es doch nicht dasselbe gewesen sein – sonst wäre
ich ja nicht der Sieger. Hinzu kommt natürlich, dass der
andere, indem er heute das tut, was ich gestern tat, mir den
Spiegel vorhält, mich an meine eigene dunkle Herkunft peinlich
erinnert. Und wenn er mit seiner Imitation auch noch Erfolg hat,
wird er sogar zum gefährlichen Konkurrenten. Die Härte
der Konkurrenz erlaubt es aber nicht, sich selbst zu kritisieren,
denn das hieße ja, sich selbst zu schwächen.
So ist nicht nur die Ungleichzeitigkeit in
der Entwicklung der Nationen, sondern zumal die Tatsache, dass sie
in der Freihandelstheorie und -politik so wenig berücksichtigt
wird (eben im Prinzip Gleichzeitigkeit vorausgesetzt wird), eine
wesentliche Ursache politischer Konflikte.
Als in Europa der Freihandel die
öffentliche Debatte zunehmend bestimmte und sich ab Mitte des
19. Jahrhunderts schließlich durchsetzte, blieben die USA
ungerührt „Mutterland und Bastion des modernen
Protektionismus“ (Bairoch). Das ist zunächst schwer zu
begreifen, weil der Liberalismus im wirtschaftlichen und
politischen Leben der Vereinigten Staaten selber ja noch
ausgeprägter war als im viktorianischen England. Es findet
aber seine Pa rallele in der starken Tradition des
Isolationismus. Offiziell wurde dieser Widerspruch zwischen Innen-
und Außenverhältnis damit gerechtfertigt, dass die USA
groß und reich genug seien, um innerhalb ihrer Grenzen die
Vorteile des freien Handels genießen zu können und einen
umfangreichen Außenhandel gar nicht brauchten (Adams 1977:
174).
Der Hauptgrund war aber natürlich das
gegenüber Großbritannien genau umgekehrte Interesse des
Nachzüglers. Es trat im Bürgerkrieg (1861–65) noch
einmal klar zutage: Während es in England die Industrie
gewesen war, die für den Freihandel, d. h. die Abschaffung der
Zölle auf landwirtschaftliche Produkte und Rohstoffe eintrat,
war in den USA gerade der im industriellen Aufbau begriffene Norden
an Schutzzöllen interessiert und der landwirtschaftliche
Süden am Freihandel, d.h. am Export von Baumwolle und Getreide
nach England. Der Bürgerkrieg war also nicht nur ein Kampf um
die nationale Einheit und die Sklavenbefreiung, sondern zumal eine
Auseinandersetzung um die künftige Stellung der Vereinigten
Staaten in der Weltwirtschaft.
Da die Schutzzollpolitik des Nordens gesiegt
hatte, waren die USA in der Lage, ihren Rückstand
gegenüber Großbritannien zügig aufzuholen und sich
nach dem Ende der Freihandelsperiode in Europa an der
imperialistischen Politik der Großmächte zu beteiligen.
Dabei ging es ihnen gewiss nicht zuerst um Krieg und Kolonialbesitz
(was beides allerdings nicht ausblieb), sondern um die
Erschließung neuer Märkte und eine indirekte, finanzielle
Kontrolle über andere Länder. Der ehemalige
Außenminister Foster 1900 im „Independent“:
„Welche Meinungsverschiedenheiten unter den Bürgern
Amerikas hinsichtlich der Politik der territorialen Expansion auch
bestehen mögen, alle scheinen darin übereinzustimmen,
dass eine kommerzielle Expansion wünschenswert ist.
Tatsächlich ist es für uns zu einer Notwendigkeit
geworden, neue und größere Märkte für unsere
landwirtschaftlichen und industriellen Produkte zu finden. Ohne sie
können wir nicht unsere gegenwärtige indus trielle
Prosperität aufrechterhalten“ (Williams 1973: 55). Es
ging also nicht um die Freiheit des Handels, sondern um dessen
Erzwingung bei anderen.
Ein Beispiel ist die Politik der
„Offenen Tür“ in Südost asien. Hier
erzwangen die USA schon 1853 mit der Drohung eines Bombardements
die Öffnung Japans für amerikanische Exporte –
allerdings mit dem ungewollten Nebeneffekt, dass sich Japan nun
seiner ökonomischen  Situation bewusst wurde und mit den Meiji-Reformen
die Modernisierung nach Hamilton-Listschem Rezept begann, die es ab
dem Ersten Weltkrieg allmählich zum gefährlichen
Konkurrenten machte. Erfolgreicher im Sinne des Imperialismus waren
die USA, als sie 1899/1900 die Zustimmung aller
Großmächte (außer Russland) zu ihren Open-Door Notes
in Bezug auf China gewinnen konnten. Nun durften auch sie sich an
der Ausplünderung dieses politisch ohnmächtigen Riesen
beteiligen und dies mit Truppen absichern, die 30 Jahre dort
blieben. Die Politik der Offenen Tür erhielt über Asien
hinaus grundsätzliche Bedeutung im 20. Jahrhundert. Situation bewusst wurde und mit den Meiji-Reformen
die Modernisierung nach Hamilton-Listschem Rezept begann, die es ab
dem Ersten Weltkrieg allmählich zum gefährlichen
Konkurrenten machte. Erfolgreicher im Sinne des Imperialismus waren
die USA, als sie 1899/1900 die Zustimmung aller
Großmächte (außer Russland) zu ihren Open-Door Notes
in Bezug auf China gewinnen konnten. Nun durften auch sie sich an
der Ausplünderung dieses politisch ohnmächtigen Riesen
beteiligen und dies mit Truppen absichern, die 30 Jahre dort
blieben. Die Politik der Offenen Tür erhielt über Asien
hinaus grundsätzliche Bedeutung im 20. Jahrhundert.
Ein anderes Beispiel ist die Wandlung, die
die sogenannte Monroe-Doktrin erfahren hat. 1823 hatten die jungen
Vereinigten Staaten mit ihr den Versuch der Hl. Allianz abwehren
wollen, sich auf Seiten der spanischen Krone in den
Unabhängigkeitskrieg der Kolonien in Lateinamerika
einzumischen („Amerika den Amerikanern!“). 1904 wurde
sie unter dem Druck der Geschäftswelt uminterpretiert in eine
Proklamation des Rechts der USA, den lateinamerikanischen Markt
allein zu beherrschen (Williams 1973: 277). Und diese Politik des
„Closed Door“ wurde auch schrittweise umgesetzt:
zunächst in der Karibik und Mittelamerika, nach der
Schwächung Englands durch den 1. Weltkrieg dann in
Südamerika („Dollar-Diplomatie“), nach dem 2.
Weltkrieg schließlich institutionalisiert in der Organization
of American States (OAS).
Wie wurde sie umgesetzt? Sowohl
wirtschaftlich als auch militärisch. So musste England nach
dem 1. Weltkrieg mit einem Großteil seines Auslandskapitals
die amerikanischen Waffenlieferungen bezahlen. In den 20er Jahren
stand Lateinamerika weltweit an der Spitze der Importeure von
US-Kapital. Zudem wurde über die Hälfte der Stahl- und
Baumwollexporte der USA von Lateinamerika abgenommen. Zwischen 1900
und 1933 kam es aber auch zu zahlreichen militärischen
Interventionen: viermal auf Kuba, zweimal in Nicaragua, sechsmal in
Panama, siebenmal in Honduras, zweimal in Mexiko und einmal in
Guatemala (Biermann 2000: 11).
Das einscheidendste Ereignis der Geschichte
des Freihandels war zweifellos die Weltwirtschaftskrise 1929 und in
den Folgejahren, die zu einem Schrumpfen des Welthandels um fast 70
Prozent und damit weit hinter den Stand vor dem 1. Weltkrieg
führte. Sie interessiert uns hier aber nur in zweierlei
Hinsicht: Da sie von den Vereinigten Staaten ausging, war sie
erstens der indirekte Beweis, dass das Zentrum der Weltwirtschaft
sich endgültig dorthin verlagert hatte. Da dieses Zentrum sich
jedoch als nicht tragfähig erwies, offenbarte die Krise
zweitens ein gravierendes Versagen der herrschenden klassischen
Außenhandelstheorie. Denn diese behauptete ja eine
Selbstregulierung des Weltmarkts, wo offensichtlich enormer
Regulierungsbedarf bestand. Gerade in dieser Phase, als England zur
Regulierung nicht mehr und die USA dazu noch nicht in der Lage
waren, hätte sich doch die Fähigkeit des Marktes zur
Selbstregulierung bewähren müssen! Der Grund des
Versagens war, dass die Theorie die Regulierung durch
Großbritannien stillschweigend vorausgesetzt hatte.
Andererseits hatte aber auch List die Frage nicht beantwortet, was
denn zu geschehen habe, wenn die Nachzügler ihren
Rückstand aufgeholt haben und eine gewisse Gleichheit des
Entwicklungstandes erreicht ist.
Diese
unentschiedene Situation trieb die Mächte in den 30er Jahren
zur Bildung von exklusiven Wirtschaftsblöcken: der
panamerikanischen Freihandelszone der USA, dem britischen
Sterling-Block, der ostasiatischen
„Wohlstandsphäre“ Japans, der
südosteuropäischen Großraumwirtschaft des Deutschen
Reiches. Und sie trieb sie schließlich dazu, am friedlichen
Handel überhaupt zu verzweifeln und die Entscheidung im Krieg
zu suchen. (Von der völkerrechtlichen Frage der Kriegsschuld
ist hier natürlich abstrahiert.) Niemand glaubte mehr an die
Freiheit des Handels – bis auf die Vereinigten Staaten, die
sie bis zu diesem Zeitpunkt nie praktiziert hatten, aber nun
zuversichtlich sein konnten, als Sieger aus dem Weltkrieg
hervorzugehen. In der Atlantik-Charta, in der sie sich mit
Großbritannien über die Kriegsziele verständigten,
tauchte der freie Welthandel zum ersten Mal als wesentliches
Element der Nachkriegsordnung auf, und zwar eingebracht von den
USA, um den britischen Sterling-Block aufzubrechen! Das war also
gleichsam der Zeugungsakt der zweiten, bis heute anhaltenden
Freihandelsperiode. Dass innerhalb des Bündnisses der lange
währende Kampf zwischen beiden Mächten zu Ende
geführt wurde, bestätigte sich 1944, als
Großbritannien sich weigerte, dem Bretton-Woods-System
beizutreten, weil es seine Sterlingzone erhalten wollte. Daraufhin
kündigten die USA 1945 sofort nach der Kapitulation Japans das
Land-Lease-Abkommen mit England und zwangen es mit einem neuen
Kreditvertrag zum Beitritt (Biermann, 117 f.).
Nach rund 150
Jahren hatten die USA mit fast 50 Prozent Anteil an der
Weltindustrieproduktion die Monopolstellung erlangt, die es ihnen
erlaubte, der Welt die freie Konkurrenz zu verkünden.
„Es waren nicht die intellektuellen Vorzüge der
Freihandelslehre, die alle Beteiligten schließlich zum
Einlenken bewegten. Tatsächlich ist der gegenwärtige
Weltmarkt ein von Menschen – man darf sagen: von Amerikanern
– geschaffenes Gebilde, das Ergebnis von über 50 Jahren
amerikanischer Diplomatie, amerikanischen Druck und amerikanischer
Bereitschaft, den US-Markt zuerst und am weitesten zu
öffnen“ (Luttwak 1999: 236). Denn Großbritannien
und andere europäische Länder neigten in der
Nachkriegszeit wegen ihrer Devisenknappheit und Arbeitslosigkeit
begreiflicherweise zu mehr Marktintervention. Der weit härtere
Widerstand, der den USA erwachsen war, kam aber jetzt von der
Sowjetunion mit ihrem ganz anderen System einer nachholenden
Entwicklung! So war es sicher kein Zufall, dass das Allgemeine
Zoll- und Handelsabkommen (GATT) genau zu Beginn des Kalten Krieges
1948 in Kraft trat und dass die größten Fortschritte im
Abbau von Handelshemmnissen genau auf dem Höhepunkt des Kalten
Krieges erreicht wurden („Kennedy-Runde“ 1964 bis
1967). „Das stärkste Motiv für die Liberalisierung
des Welthandels, stärker noch als die wirtschaftlichen
Vorteile, die immer gegen die Nachteile abgewogen werden mussten,
war stets politischer und strategischer Natur. So war GATT immer
als wirtschaftliches Pendant zur gegen die Sowjetunion gerichteten
westlichen Allianz gemeint“ (Luttwak 1999: 237).
 Als die USA unter Reagan zum „letzten
Gefecht“ gegen die Sowjetunion antraten, taten sie dies
bekanntlich unter lautstarker Berufung auf die liberale Tradition.
Ein eher komisches, aber sehr sprechendes Symbol dafür war es,
dass viele Angehörige der Administration damals Krawatten mit
dem Bild von Adam Smith trugen. Dass sie allerdings mit ihren
ungeheuren kreditfinanzierten Rüs tungsanstrengungen
zugleich eindeutig gegen diese Tradition verstießen, mag noch
aus der Situation des Kalten Krieges zu erklären sein. Wie ist
es aber zu erklären, dass unter Reagan, dem
Nachkriegspräsidenten mit der leidenschaftlichsten Liebe zum
Laissez faire, der größte Umschwung zugunsten des
Protektionismus stattfand, den es seit den dreißiger Jahren
gegeben hat? Der Grund war natürlich die schon erwähnte
überlegene japanische Konkurrenz, die die amerikanische
Stahl-, Auto-, Werkzeugmaschinen- und Halbleiterindustrie bedrohte.
Aber gelten die Gebote des freien Handels nur für die anderen,
nicht für den, der sie propagiert und durchsetzen will?
Offensichtlich bricht im Ernstfall der Protektionismus, auf dem der
Freihandel historisch beruht, wieder unverhüllt hervor. Ein
wissenschaftlicher Mitarbeiter des GATT-Sekretariats schätzt,
dass die Auswirkungen der unter Reagan beschlossenen
Handelsbeschränkungen dreimal so hoch waren wie die anderer
führender Industrieländer (Greider 1998: 245, Chomsky
2001: 83). Als die USA unter Reagan zum „letzten
Gefecht“ gegen die Sowjetunion antraten, taten sie dies
bekanntlich unter lautstarker Berufung auf die liberale Tradition.
Ein eher komisches, aber sehr sprechendes Symbol dafür war es,
dass viele Angehörige der Administration damals Krawatten mit
dem Bild von Adam Smith trugen. Dass sie allerdings mit ihren
ungeheuren kreditfinanzierten Rüs tungsanstrengungen
zugleich eindeutig gegen diese Tradition verstießen, mag noch
aus der Situation des Kalten Krieges zu erklären sein. Wie ist
es aber zu erklären, dass unter Reagan, dem
Nachkriegspräsidenten mit der leidenschaftlichsten Liebe zum
Laissez faire, der größte Umschwung zugunsten des
Protektionismus stattfand, den es seit den dreißiger Jahren
gegeben hat? Der Grund war natürlich die schon erwähnte
überlegene japanische Konkurrenz, die die amerikanische
Stahl-, Auto-, Werkzeugmaschinen- und Halbleiterindustrie bedrohte.
Aber gelten die Gebote des freien Handels nur für die anderen,
nicht für den, der sie propagiert und durchsetzen will?
Offensichtlich bricht im Ernstfall der Protektionismus, auf dem der
Freihandel historisch beruht, wieder unverhüllt hervor. Ein
wissenschaftlicher Mitarbeiter des GATT-Sekretariats schätzt,
dass die Auswirkungen der unter Reagan beschlossenen
Handelsbeschränkungen dreimal so hoch waren wie die anderer
führender Industrieländer (Greider 1998: 245, Chomsky
2001: 83).
Die harte Lehre der Weltwirtschaftskrise war,
dass der Markt wesensmäßig einer politisch-rechtlichen
Rahmensetzung bedarf. Der Weltmarkt, der eines solchen festen
Rahmens bis heute entbehrt, trägt daher seinen Namen
eigentlich zu unrecht. Die Lösung, die nach dem Weltkrieg
– und in gewissem Sinne sogar durch ihn – zunächst
gefunden wurde, bestand darin, dass einer, nämlich der nunmehr
mächtigste der Marktteilnehmer die Aufgabe der Rahmensetzung
übernahm. Aber das war deshalb nur eine provisorische
Lösung, weil es diesem Mächtigsten ja überlassen
blieb, zwischen seinem nationalen Interesse als Marktteilnehmer und
dem übernationalen Interesse an einer gerechten Ordnung zu
unterscheiden, und weil es von vornherein unwahrscheinlich war,
dass er dazu in der Lage sein würde. Wahrscheinlich würde
er sein nationales Interesse immer wieder mit dem der
Völkergemeinschaft verwechseln, ja seine übernationale
Aufgabe nur dazu benutzen, sein eigenes Interesse besser
durchzusetzen. So ist es, wie wir am Beispiel Reagans gesehen
haben, auch gekommen. Außerdem war aber aller geschichtlichen
Erfahrung nach zu erwarten, dass der betreffende Marktteilnehmer
seine herausragende Stellung gar nicht dauerhaft würde
erhalten können, sondern eher Nachholanstrengungen bei anderen
provozieren würde. Denn es ist für die anderen
Länder ja nicht hinnehmbar, um des lieben Friedens willen
Wettbewerbsnachteile zu erleiden und auf eigene Entwicklung zu
verzichten. Auch unter diesem Listschen Gesichtspunkt der
Chancengleichheit drängt sich somit die Frage nach einer
unabhängigen übernationalen Instanz zur Regulierung des
Welthandels auf.
Die seit Anfang
1995 bestehende Welthandelsorganisation (WTO) ist der Versuch, eine
solche Instanz einzurichten. Sie geht auf eine gemeinsame
Initiative der EU und Kanadas zurück, die sich gegen die eben
charakterisierte Doppelrolle der USA als Marktteilnehmer und
zugleich Regulator richtete. Zum Beispiel hatten die Vereinigten
Staaten immer wieder versucht, durch die Drohung mit Importverboten
und anderen Handelsbegrenzungen das Wohlverhalten anderer Staaten
(Südkorea, Brasilien, EU) zu erzwingen. Die WTO sieht nun ein
gegenüber dem GATT sozusagen umgekehrtes
Streitschlichtungsverfahren vor: Während früher ein Land
nur verurteilt werden konnte, wenn alle Mitglieder –
einschließlich des betroffenen Landes – zustimmten, ist
jetzt der Schiedsspruch immer gültig, es sei denn, er wird von
allen Ländern einstimmig abgelehnt. Und die Verurteilung ist
mit der Verhängung von Sanktionen verbunden.
Wie reagierten
die USA auf diesen Ausbau der internationalen Ordnung? Mit der
allerdings naheliegenden Kritik, er laufe auf eine Verletzung ihrer
nationalen Souveränität hinaus. Clinton konnte die
Ratifizierung des WTO-Beitritts im Kongress nur dadurch erreichen,
dass er den Wiederaustritt zusicherte, falls die Vereinigten
Staaten dreimal vor dem Schiedsgericht angeklagt würden. Der
Austritt der USA wäre aber das Ende der Organisation.


|