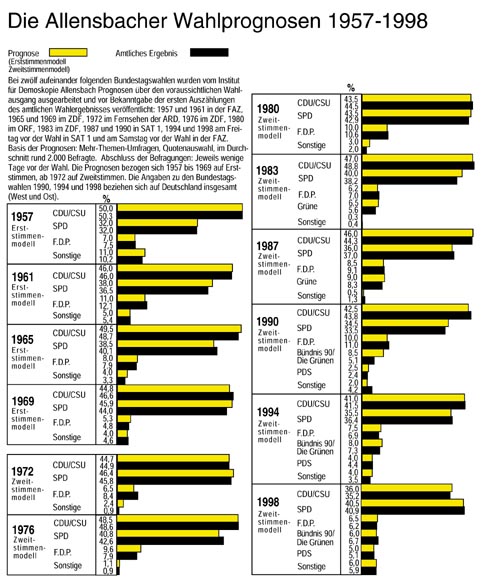50 Jahre Wahlforschung
Der Deutsche Bundestag in der Demoskopie
VON ELISABETH NOELLENEUMANN
|
|||||||||
Die wichtigste Information über die Verankerung der Demokratie ab 1949 in Westdeutschland und ab 1990 auch in den neuen Bundesländern und in Deutschland insgesamt liefert die Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen zwischen 1949 und 1998. Es ist die Dokumentation eines großen historischen Erfolges. An der Vitalität der deutschen Demokratie ist nach der letzten Bundestagswahl dieses Jahrhunderts nicht zu zweifeln.
Die Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen seit 1949 als Indikator einer lebendigen Demokratie:
Zum ersten Mal lässt sich nun auch der Rahmen von 50 Jahren, der durch die Fakten der Wahlbeteiligung gebildet wird, ausfüllen. Wir besitzen heute ein bewegtes Bild, wie sich die Einstellungen der deutschen Bevölkerung zur Demokratie entwickelten. Dabei gilt in dem folgenden Beitrag die Aufmerksamkeit vor allem jener Institution, mit der die Demokratie konkret, also anschaulich wird, dem Bundestag, und denjenigen, die für die Bevölkerung die Demokratie personifizieren, den Bundestagsabgeordneten.
Die frühesten Allensbacher Untersuchungen zur Verankerung der Demokratie fanden ab März 1949 sowie in den Jahren 1951, 1952, 1953 und 1957 statt. Die Schlüsselfragen betrafen die Entscheidung zwischen einem MehrParteienSystem und einer autoritären Staatsform: "Glauben Sie, dass es für ein Land besser ist, mehrere Parteien zu haben, damit die verschiedenen Meinungen frei vertreten werden können, oder nur eine Partei, damit möglichst große Einheit herrscht?" Im März 1951 entschieden 61 Prozent, im Mai 1954 70 Prozent, mehrere Parteien seien besser. 1951 dachten 22 Prozent, es sei besser, wenn es nur eine Partei gäbe, und 5 Prozent lehnten den Gedanken an Parteien überhaupt ab. 1954 waren noch 18 Prozent für den EinParteienStaat und 4 Prozent wollten überhaupt keine Partei. 1955 und 1956 wurde die SchlüsselFrage zum ersten Mal in einen Dialog gekleidet; es entwickelte sich die bis heute typische Allensbacher FragebogenTechnik, nicht abstrakt, sondern möglichst konkret zu fragen.
|
Zwei Männer unterhalten sich darüber, wie man ein Land regieren soll. Der eine sagt: 'Mir gefällt es am besten, wenn das Volk den besten Politiker an die Spitze stellt und ihm die ganze Regierungsgewalt überträgt. Der kann dann mit ein paar ausgesuchten Fachleuten klar und schnell entscheiden. Es wird nicht viel geredet und es geschieht wirklich was.' Der andere sagt: 'Mir ist es lieber, wenn mehrere Leute im Staat zu bestimmen haben. Da geht es zwar manchmal hin und her, bis was getan wird, aber es kann nicht so leicht vorkommen, dass die Regierungsgewalt missbraucht wird.'
Welche der beiden Meinungen kommt Ihrer eigenen Ansicht am nächsten – die erste oder die zweite?" Diese Frage wurde seit 1955 bis heute elfmal in Westdeutschland gestellt und ab 1990 auch in den neuen Bundesländern. Die demoskopische Beobachtung zeigt für die letzten 50 Jahre eine durchaus unerwartete Entwicklung.
In Westdeutschland verminderte sich der Anteil der Bevölkerung, der empfiehlt, den besten Politiker an die Spitze zu stellen und ihm die ganze Regierungsgewalt zu übertragen, von 31 Prozent 1955 auf 13 Prozent 1985 und 8 Prozent 1991. Für die Position der parlamentarischen Demokratie traten 1955, also zehn Jahre nach Kriegsende, 55 Prozent ein, der Anteil stieg bis 1991 auf 83 Prozent.
Nach der Wiedervereinigung drehte sich der Trend um. Für das Regiment eines starken Mannes an der Spitze sprachen sich 1992 12 Prozent aus, im Dezember 1997 21 Prozent. Das entsprach weitgehend dem Stand vom Juli 1960. Die Anhänger der Idee, dass mehrere Leute im Staat bestimmen sollten, verminderte sich in Westdeutschland auf 64 Prozent, auch hier etwa die Lage vom Juli 1960. In Ostdeutschland gab es zunächst im September 1991 fast das gleiche Übergewicht der demokratischen Position wie in Westdeutschland (78 zu 12 Prozent). Dann aber verfiel das Vertrauen in die Demokratie. 1997 stimmten nur noch 50 Prozent der Ostdeutschen für die parlamentarische Demokratie, 22 Prozent versprachen sich mehr davon, den besten Politiker mit ein paar Fachleuten an die Spitze zu stellen.
Ganz ähnlich entwickelte sich das Vertrauen in die Meinungs und Redefreiheit, wie sie Artikel 5 des Grundgesetzes garantiert: "Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten." Von 1953 an wurde gefragt: "Haben Sie das Gefühl, dass man heute in Westdeutschland seine politische Meinung frei sagen kann, oder ist es besser vorsichtig zu sein?" 1953 meinte die Bevölkerung in Westdeutschland zu 58 Prozent, 1956 bereits zu 77 Prozent, man könne frei reden. 1956 waren noch 17 Prozent überzeugt, es sei besser vorsichtig zu sein. Im September 1991 meinten nur noch 12 Prozent der Westdeutschen, es sei besser vorsichtig zu sein, 83 Prozent bestätigten, man könne frei reden. Als allerdings die Frage 1996 abermals gestellt wurde, hatte sich auch hier der Trend gedreht, nun glaubten wieder 20 Prozent, man sollte besser vorsichtig sein.
In Ostdeutschland blieb das Vertrauen in die Meinungs und Redefreiheit zwischen 1991 und 1996 weitgehend unverändert. Gut jeder Vierte war überzeugt, es sei besser vorsichtig zu sein. Das heißt: Die Atmosphäre von Freiheit breitete sich in Ostdeutschland nicht aus, das Gefühl von Unfreiheit färbte auf Westdeutschland ab. Dieses Abfärben undemokratischer Haltungen von Ost nach Westdeutschland war für die internationale Demokratieforschung eine völlig unerwartete Entwicklung.
Die Verankerung der Demokratie heißt nicht nur rationale Zustimmung zu bestimmten Verfassungsprinzipien. Noch wichtiger sind die Gefühle des Vertrauens und der Wertschätzung für die Institutionen, in denen die Demokratie konkrete Gestalt annimmt, also vor allem für den Bundestag, und das Vertrauen zu den Personen, durch deren Handeln sich die Demokratie verwirklicht, also vor allem zu den Bundestagsabgeordneten.
1953 wurde zum ersten Mal gefragt: "Glauben Sie, man muss große Fähigkeiten haben, um Bundestagsabgeordneter in Bonn zu werden?" Wieder erkennt man, dass die Frageformulierung nicht abstrakt, sondern konkret ist: Man brauche große Fähigkeiten, um eine Aufgabe zu erfüllen, drückt Respekt aus und Vertrauen in diejenigen, die diese Aufgabe wahrnehmen. Vom Beginn der fünfziger Jahre bis Anfang der siebziger Jahre stieg der Respekt der Westdeutschen vor den Bundestagsabgeordneten. Dann allerdings setzte ein rascher Verfall des Ansehens der Bundestagsabgeordneten ein.
Diese Entwicklung hatte mit einem allgemeinen Trend des Verfalls von Vertrauen zu tun, und zwar nicht nur zu Personen, Amtsinhabern allgemein, sondern auch zu den staatlichen Institutionen, und dies nicht nur in Deutschland, sondern in allen westlichen Demokratien.
Diese Entwicklung wird heute aus Befunden der empirischen Kommunikationsforschung erklärt. Nach 1972 setzte in allen westlichen Demokratien eine Entwicklung neuer journalistischer Praxis ein, die man als "Negativismus" beschreibt und die oft in den Satz gefasst wird: "Nur negative Nachrichten sind Nachrichten." Es muss hier offen bleiben, wieweit diese veränderte journalistische Praxis mit dem Medium Fernsehen und seinen Bedürfnissen, Zuschauer zu fesseln, zusammenhängt. Es spricht viel dafür, dass dieser Trend zum journalistischen Negativismus weitgehend gleichzeitig in den westlichen Demokratien aufgetreten ist.
Der HarvardProfessor für Politikwissenschaft Thomas E. Patterson hat in seinem 1993 veröffentlichten Buch "Out of Order" auf der Basis von computergestützten Inhaltssystemen der NEW YORK TIMES und des WALLSTREET JOURNAL gezeigt, wie sehr sich zwischen 1968 und 1990 das Übergewicht negativer Nachrichten und negativer Bewertungen ausgebreitet hat. Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sehr durch diese Entwicklung auch das Ansehen der Bundestagsabgeordneten beschädigt worden ist. In Ostdeutschland ist das eingetreten, noch bevor die Demokratie wirksam verankert war.
|
Die gleiche Entwicklung lässt sich seit Beginn der siebziger Jahre gegenüber den politischen Institutionen erkennen. Eine "gute Meinung" vom Bundestag bekunden 1974 von den Westdeutschen 49 Prozent, 1985 sind es noch 42 Prozent, 1995 schließlich 24 Prozent. In Ostdeutschland wurde 1995 zum ersten Mal nach der Meinung über den Bundestag gefragt. 15 Prozent sagten, sie hätten vom Bundestag eine gute Meinung, 48 Prozent "teils, teils", eine "schlechte Meinung": 33 Prozent.
Das Wichtigste für eine stabile Verankerung der Demokratie ist das Vertrauen, dass man mit der Demokratie auch in Gefahrenzeiten mit den Problemen fertig wird.
Um dieses Vertrauen nach der Wiedervereinigung zu messen und zu verfolgen, wieweit es in den neuen Bundesländern wächst, wurden Ost und Westdeutsche im September 1991 zum ersten Mal gefragt: "Wenn jemand sagt: 'Mit der Demokratie können wir die Probleme lösen, die wir in der Bundesrepublik haben.' Würden Sie dem zustimmen oder nicht?"
In Westdeutschland stimmten 65 Prozent zu bei 15 Prozent Gegenstimmen; in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre betrug die Zustimmung 56 Prozent bei jetzt 21 Prozent Gegenstimmen.
In Ostdeutschland war die Skepsis von vornherein groß. 1991 trauten nur 41 Prozent der Ostdeutschen der Demokratie zu, dass sie mit den Problemen auch in schwierigen Zeiten fertig werden könne. Die Umfragen der neunziger Jahre in Ostdeutschland illustrieren das harte Ringen um Vertrauen zur Demokratie. 1997 stimmten nur noch 30 Prozent der Ansicht zu, man könne mit der Demokratie auch Schwierigkeiten bewältigen. 37 Prozent bezweifelten das.
Im Sommer 1998, also mitten im Wahlkampf, standen die Ansichten 1 zu 1 (36 zu 35 Prozent). Eine Verbesserung der Demokratieverankerung mitten im Bundestagswahlkampf ist kein Zufall. Den größten Beitrag zur Verankerung der Demokratie in Deutschland leisten heute die Bundestagswahlen. In den Bundestagswahlkämpfen erlebt die Bevölkerung, dass es tatsächlich auf sie, die Wähler, ankommt, und dass die Politiker mit der Bevölkerung sprechen und sie zu überzeugen versuchen.
Unter dem Eindruck dieser Erfahrung fällt die Politikverdrossenheit, die sich zwischen den Wahlterminen immer aufbaut, wieder in sich zusammen, geht von 50 bis 60 Prozent auf 30 Prozent oder noch weiter zurück.
Besonders wichtig war für Ost, aber auch Westdeutsche die Erfahrung der Bundestagswahl von 1998: Die Demokratie macht den Machtwechsel ohne Gewalt möglich. Das haben viele noch nie erlebt und wahrscheinlich auch gar nicht für möglich gehalten.
Es ist bekannt, dass die neue Regierung viel Unzufriedenheit geweckt hat. Aber diese Unzufriedenheit betrifft einzelne Personen oder Maßnahmen, nicht die Demokratie als Ganzes. Die ersten Umfragen des Jahres 1999 zeigen bei nahezu jeder Messfrage, die in dem vorliegenden Aufsatz verwendet wurde, eine Zunahme des Vertrauens in die Demokratie.