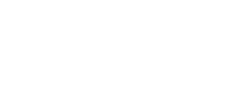"Um die Seele und Stimme des Wählers ringen"
Peter Radunski, politischer Berater und früherer CDU-Wahlkampfmanager, über altmodischen Wahlkampf in Deutschland, fehlende Strategien und das Vorbild Amerika
Herr Radunski, es sind noch wenige Monate bis zur Bundestagswahl. Was passiert eigentlich zurzeit in den Wahlkampfzentralen? Stehen schon die Teams und Kampagnen?
Die Wahlkampf-Mannschaft, die PR-Agentur und auch der Zeitplan für die Organisation stehen seit dem Herbst längst fest. Das hat auch so zu sein, sonst gäbe es ein Chaos. Die Zentrale muss die Parteibasis frühzeitig auf den Wahlkampf einstimmen. Derzeit gibt es deshalb in allen Parteien solche Mobilisierungsveranstaltungen.
Ist das schon Wahlkampf?
Ja, die Vorwahlkampfphase. Sie gliedert sich normalerweise in zwei Teile: Die Mobilisierung nach innen und der erste Kontakt mit den Wählern...
... und dann beginnt der Hauptwahlkampf?
Richtig, aber dieses Mal wird es schwierig, diese Abfolge einzuhalten. Es gibt in diesem Jahr eine Besonderheit: Der Bundestagswahlkampf wird erst kurz vor der Wahl, in den letzten drei Wochen des Septembers, stattfinden.
Wieso das?
Weil wir eine Große Koalition als Regierung haben und diese – ob sie will oder nicht – in arbeitender Verantwortung ist. Ich sage als Stichwort nur Finanzkrise. Außerdem ist dieses Wahljahr eines mit mehreren Wahlwellen: Vor der Bundestagswahl kommen noch die Europawahl Anfang Juni, Kommunalwahlen und schließlich drei Landtagswahlen im August.
In den USA ist es üblich, dass die Parteien ‚Spin
Doctors’, also meistens externe Wahlkampfberater, engagieren,
die die Strategie planen. Wie ist das in Deutschland? Wie wichtig
sind hier externe Berater?
Die externen Berater haben hierzulande keinen großen Einfluss. Die Parteien setzen auf „Stallgeruch“, weshalb sie ihre Wahlkampfmannschaft innerhalb der Partei aufbauen. Organisiert wird das unterschiedlich: mal ein bisschen abseits, die SPD nennt das ‚Nordkurve’, mal völlig integriert in die Bundesgeschäftsstelle, wie bei der CDU – da gibt es eigens eine Abteilung für strategische Planung. In der Regel wird zusätzlich eine Werbeagentur engagiert, aber PR-Strategen holt man selten von außen dazu. Insofern ist der deutsche Wahlkampf „beautiful old fashioned“ geblieben.
Die Art, wie der Präsidentschaftswahlkampf von Barack Obama in
den USA geführt wurde, hat hierzulande viele begeistert. Taugt
er als Vorbild für die Bundestagswahl?
Ganz wichtig wird die Nutzung des Internets sein – und zwar in der dialogischen Form des Web 2.0. Obama hat das so überzeugend eingesetzt, dass man es einfach machen muss. Auch der direkte Dialog mit dem Wähler wird stärker gesucht werden müssen, gerade weil die Zahl der Nichtwähler in Deutschland gewachsen ist.
Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Internetportale werden mehr als nur Informationen anbieten. Sie werden zum Mitmachen animieren. Ziel ist, Besucher einer Website oder eines Blogs nicht unverrichteter Dinge weiterklicken zu lassen, sondern sie zu etwas zu verpflichten: Mithilfe oder eine Spende etwa. Obama hat auf diesem Weg sehr erfolgreich ein Netzwerk von Unterstützern und Freiwilligen aufgebaut. Dieses „Social Networking“ wird bei uns auch stärker werden.
Was lässt sich nicht auf deutsche Verhältnisse
übertragen?
Die große Spendenfreudigkeit. Außerdem engagiert man sich hierzulande weniger schnell. Natürlich hatte die Begeisterung in den USA mit der Person Obama zu tun, doch ich beobachte seit 30 Jahren US-Wahlkämpfe und es ist immer gelungen, ein riesiges Heer von Freiwilligen zu rekrutieren. Die Amerikaner haben einfach eine größere Partizipationskultur – jedenfalls was den Wahlkampf angeht.
Matthias Machnig, der als „Spin Doctor“ 1998 für
Gerhard Schröder den Wahlkampf organisierte, beklagte
kürzlich auch das Fehlen einer strategischen
Kultur.
Ich sehe es ähnlich, und als Berater natürlich auch mit Enttäuschung, dass wir in Deutschland die Dinge zu wenig strategisch angehen. Ein Beispiel: Wer Wahlkampf führt, muss sich intensiv überlegen, welches Bild vom Wähler er hat. Wir reden viel über Koalitionen und Lagerwahlkämpfe, doch wichtiger wäre die Frage: Was will ein von der Politik distanzierter und vielleicht verärgerter Bürger? Wie muss ich ihn ansprechen? Hier muss Strategie ansetzen. Doch das passiert kaum.
Und wahrscheinlich erst, wenn die nächste Wahl
kommt?
Sie sagen etwas Entscheidendes. Denn das Gute an einer Strategie ist ja, dass sie die Politik durchzieht. Bei Willy Brandt war es das Motto „Demokratie wagen“, welches die Regierung dann versuchte, politisch umzusetzen: mit Reformen im Innern, Ostpolitik nach außen. Auch bei Adenauer und später bei Kohl gab es ganze politische Folien, von denen man sein Handeln ableiten konnte. Das ist seit der Wiedervereinigung vorbei.
Wieso?
Nach dem Ende des Kalten Krieges sind Ideologien und somit auch die Makro-Ebene für Entscheidungen verloren gegangen. Aber es ist eine Lebenslüge vieler Politiker, zu behaupten, die großen Fragen fehlten. Wenn wir heute sogar über die Verstaatlichung von Banken diskutieren, dann ist das eine wirklich politische Frage!
Was bedeutet das für den kommenden Wahlkampf?
Es ist wichtig, dass die Politik versucht, die jetzige Situation zu deuten und zu klären, wie die soziale Marktwirtschaft in der globalisierten Welt überleben kann. Die Parteien sollten sich um Deutungshoheit bemühen. Die momentane Krise versteht doch kaum jemand. Wer sie dem Wähler auch nur halbwegs erklären kann, gewinnt Vertrauen. Die Parteien sind natürlich versucht, sich gegenseitig anzugreifen. Aber es wäre entscheidender, dass die Politiker die Lage überblicken und Lösungsansätze anbieten. Wenn nicht, wäre das verheerend. Die Zahl der Nichtwähler würde weiter wachsen.
Wird es mit einem Wahlkampf à la Obama, also mit neuen
Formen, besser klappen?
Ich bin optimistisch. Die Parteien haben das Dilemma erkannt und wissen genau, dass sie um die Seele und die Stimme des Wählers anders ringen müssen als bisher.
Zur Person:
Peter Radunski, Jahrgang 1939, ehemaliger Senator und langjähriger Bundesgeschäftsführer der CDU, ist Senior Advisor und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Agentur Publicis Consultants Deutschland. Er konzipierte und leitete zahlreiche Wahlkämpfe und beriet Politiker und Parteien in Kampagnen- und Positionierungsfragen. Als Senator für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie für Wissenschaft und Kunst des Landes Berlin trug er von 1991 bis 1999 Regierungsverantwortung. Danach war er als Lehrbeauftragter unter anderem am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin und am Institut für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck tätig.