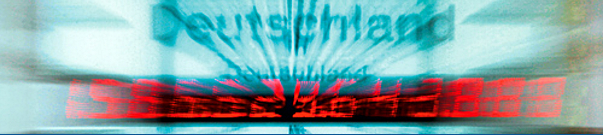Gerüstet für den Ernstfall "Normalität"?

Unterwegs in schwerem Gelände: Deutscher Konvoi der ISAF-Schutztruppe in Afghanistan.

Marschbefehl: Bundeswehrsoldaten beim Abflug ins Einsatzgebiet.

Auslandseinsätze der Bundeswehr (laufende Mandate).
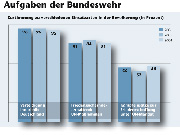
Aufgaben der Bundeswehr (Quelle: Bundeswehr).

Bundestagsabstimmung zum Libanoneinsatz.
Forum: Auslandseinsätze der Bundeswehr
17 Jahre sind vergangen seit dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Krieges, fünf Jahre seit den Terroranschlägen von New York und Washington. Für Deutschland und seine Bündnispartner hat sich seitdem in der Sicherheitspolitik eine Menge verändert — nicht zuletzt ablesbar an der wachsenden Zahl der Auslandseinsätze der Bundeswehr, die inzwischen zur politischen Normalität geworden sind. In den vergangenen 15 Jahren ist Deutschland zu einem der größten Truppensteller für internationale Friedensmissionen geworden. Während fast monatlich neue Operationen diskutiert werden — zuletzt bezüglich einer Ausweitung des Sudaneinsatzes auf die Krisenregion Darfur und Lufteinsätze im Süden Afghanistans —, stellt sich die Frage nach Beteiligungskriterien und langfristigen Konzepten.
Derzeit befinden sich rund 9.000 Soldaten im
Auslandseinsatz — von Bosnien über Afghanistan bis zum
Horn von Afrika. Mit der Überwachung der Küste des
Libanon hat die deutsche Marine im Spätsommer die heikelste
Operation in der 51-jährigen Geschichte der Bundeswehr
übernommen. Die viermonatige EUMission im Kongo unter Leitung
des deutschen Generalleutnant Karlheinz Viereck, der die Operation
vom Operation Headquarters (OHQ) in Potsdam aus führte, wurde
Ende November termingerecht beendet. Dass der Ruf nach Beteiligung
der Deutschen an internationalen Missionen demnächst leiser
wird oder gar verstummt, ist nicht abzusehen. Gerade erst wehrte
die Bundesregierung den Wunsch der NATO nach einem stärkeren
Engagement der Bundeswehr in Afghanistan — konkret eine
Ausweitung des Einsatzes auf den gefährlichen Süden
— ab. Auch die Unterstützung einer bevorstehenden
UN-Friedensmission im Sudan zieht Verteidigungsminister Franz Josef
Jung in Erwägung.
In dieser Gemengelage war für Jung im Herbst der richtige
Moment gekommen, innezuhalten und eine Standortbestimmung der
Bundeswehr vorzunehmen. Sein Vorgänger Peter Struck hatte
bereits 2003 mit der Verabschiedung verteidigungspolitischer
Richtlinien die Grundlage für die Transformation der
Bundeswehr gelegt. Das Primat der Landesverteidigung trat zugunsten
der neuen Hauptaufgabe „Krisenbewältigung“ in den
Hintergrund. Angesichts neuer asymmetrischer Bedrohungen ließ
sich der Sicherheitsbegriff geographisch nicht mehr auf Europa oder
das transatlantische Bündnisgebiet eingrenzen.
Jung legte nun im Oktober, zum ersten Mal seit zwölf Jahren,
ein neues Weißbuch vor, in dem Leitlinien für die
zukünftigen Auslandseinsätze formuliert werden. Im
Grundgesetz sind diese außerhalb Deutschlands und des
NATO-Gebiets nicht ausdrücklich vorgesehen. Eine Klarstellung
der rechtlichen Grundlage für Auslandseinsätze nahm das
Bundesverfassungsgericht am 12. Juli 1994 in Zusammenhang mit dem
Einsatz in Somalia und der Beteiligung an der
Flugverbotsüberwachung gegen das ehemalige Jugoslawien vor. Es
entschied, dass „Out-of-area-Einsätze“ der
Bundeswehr immer dann verfassungsgemäß sind, wenn sie im
Verbund von Systemen kollektiver Sicherheit stattfinden, denen die
Bundesregierung angehört und zu deren Aufgaben solche
Einsätze gehören, also beispielsweise den Vereinten
Nationen, der NATO, der EU oder der OSZE.
Vorbehalt des Parlaments
Im gleichen Urteil hat das Gericht die
Zustimmung des Bundestages zu Einsätzen außerhalb des
Geltungsbereichs des Grundgesetzes als unabdingbar festgelegt. Das
Parlamentsbeteiligungsgesetz vom März 2005 schreibt fest, dass
der Bundestag bei Auslandseinsätzen generell zustimmen muss.
Ein vereinfachtes Verfahren kann es danach bei
„Einsätzen von geringer Intensität und
Tragweite“ wie Erkundungskommandos oder bei einer
Mandatsverlängerung ohne inhaltliche Veränderung
geben.
Abgeordnete reagieren empfindlich, wenn die Regierung
Vorfestlegungen trifft oder Regierungsmitglieder vorpreschen. So
war auch die Kritik von CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder an den
Äußerungen seines Parteifreundes Jung über eine
Beteiligung an einer UN-Friedensmission im Sudan zu verstehen. Denn
faktisch soll sich nicht viel ändern: Bereits jetzt beteiligt
sich Deutschland dort mit logistischer Hilfe an den internationalen
Missionen. Deutlichen Widerspruch aus der Opposition gab es, als
Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble im Zusammenhang mit
Auslandseinsätzen in multinationalen Verbänden den
Parlamentsvorbehalt in Frage stellte. Und bei einem Einsatz von
Bundeswehr-Tornados im umkämpften Süden Afghanistans
drohten Die Linke. und Bündnis 90/Die Grünen jüngst
mit Verfassungsklage, wenn die Regierung nicht das Parlament
entscheiden lässt.
Einen regelrechten Kriterienkatalog, der Entscheidungen über
künftige Einsätze erleichtert und nachvollziehbar macht,
beinhaltet das Weißbuch nicht. Jung warb um Verständnis,
dass es eine „Zauberformel für nationale
Interessen“ nicht gibt, etwa nach der Devise
„Zustimmung nur, wenn neun von zehn Kriterien erfüllt
sind“. Der Unionspolitiker nannte aber drei Aspekte, die als
Kompass dienen könnten. So sei zu prüfen, ob der
jeweilige Einsatz im Einklang mit nationalen Interessen, nationalen
Werten und internationalen Verpflichtungen stehe.
Als „nationale Zielvorgabe“ für
Stabilisierungseinsätze ist im Weißbuch der Einsatz von
gleichzeitig bis zu 14.000 Soldaten, aufgeteilt auf bis zu
fünf verschiedene Einsatzgebiete, formuliert. Aus den
internationalen Verpflichtungen ergeben sich weitere Zielvorgaben.
So muss die Bundesregierung für die schnelle Eingreiftruppe
der NATO mit Vor- und Nachbereitung rund 15.000 Soldaten vorhalten,
im Rahmen des EU Headline Goal weitere 18.000. Zusätzlich
sollen 1.000 Einsatzkräfte für kurzfristige UN-Missionen
bereitstehen sowie 1.000 für Rettungs- und
Evakuierungsaktionen.
Modell für Exitstrategie?
Bei jedem neuen Einsatz stellt sich die
Frage nach den Grenzen der Belastbarkeit — personell und
finanziell. So hat Jung angesichts der wachsenden Aufgaben
jüngst die Bremse gezogen, indem er die Fortsetzung der
Reduzierungen in Bosnien-Herzegowina ankündigte, wo deutsche
Soldaten seit 1995 bei der Überwachung des Friedensprozesses
helfen, zunächst unter NATO-Führung, seit 2004 unter
EU-Führung.
Die EU hat einen Vier-Stufen-Plan zum Abzug von EUFOR aus
Bosnien-Herzegowina beschlossen, der bis Ende Februar konkret
ausgearbeitet werden soll. Der Bundestag hat bereits Ende November
die Mandatsobergrenze von 3.000 auf 2.400 Soldaten abgesenkt.
Tatsächlich waren jedoch nie mehr als 1.000 Soldaten in
Bosnien im Einsatz gewesen; derzeit sind es noch 850. Ein
Alleingang beim Rückzug ist nicht vorgesehen, denn auch die EU
will in einer ersten Stufe Ende Mai ihre Truppen um zwei
Bataillone, also rund 1.000 Mann, reduzieren.
Entlastung bringt momentan der fristgerechte Abzug aus dem Kongo
nach vier Monaten. 870 Bundeswehrsoldaten waren dort stationiert,
aufgeteilt auf die Stützpunkte in der Hauptstadt Kinshasa und
in Libreville im benachbarten Gabun. Die Bundeswehr hatte bei der
EUFOR-Mission zur Überwachung der ersten freien Wahlen seit
mehr als 40 Jahren die Federführung übernommen. Der
Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, Bernhard Gertz, spricht in
diesem Zusammenhang von einer „gelungenen
Exitstrategie“. Zwar gebe man „das Land auch nach
diesem Wahlgang in die Hände der gleichen Leute, die es
hemmungslos ausgeplündert haben“. Aber allein durch die
Präsenz von EUFOR habe man während der Wahlen
„möglicherweise einen Bürgerkrieg im Keim
erstickt“. Generalinspekteur Wolfgang Schneiderhan bezweifelt
allerdings, dass eine strikte Befristung ein Modell auch für
künftige Exitstrategien sein könnte. „Es gibt
keinen Modellansatz“, meint er. Jedes Szenario folge einer
eigenen Gesetzmäßigkeit. Die Bundeswehr brauche die
nötige Flexibilität, um sich darauf
einzustellen.
Engpass Logistik
Über 200.000 Soldaten waren bislang im
Auslandseinsatz. Bestimmte Fähigkeiten werden dabei besonders
strapaziert. So ist der Bereich logistische Unterstützung laut
Gertz „absolut auf Rand genäht“. Sanitäter,
Pioniere zur Errichtung von Feldlagern, Fernmelder, Feldjäger,
Heeresflieger seien genau „die Bereiche, wo die
Belastungsgrenze nicht nur erreicht, sondern eigentlich schon
überschritten ist“, sagt der Vorsitzende des
Bundeswehrverbandes. Auch der Politikwissenschaftler Christoph
Grams von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige
Politik meint, dass die Bundeswehr ein strukturelles Problem hat,
weil sie bestimmte Spezialisten in jedem Auslandseinsatz braucht.
An der Belastungsgrenze angekommen sieht er die Bundeswehr dennoch
nicht. Er weist auf die Schwierigkeit hin, dass die Bundeswehr seit
Mitte der 90er Jahre „den größten Umbau in ihrer
Geschichte“ bewältigen und gleichzeitig eine Vielzahl
von Auslandseinsätzen stemmen müsse — zu denen sie
die Transformation eigentlich erst ab 2010 befähigen
sollte.
In der öffentlichen Wahrnehmung hat sich viel bewegt. Mehr als
vier Jahrzehnte hinweg bildete der Einsatz militärischer Macht
für die alte Bundesrepublik ein Tabu. Aktuelle Umfragen zeigen
aber, dass die Auslandseinsätze der Bundeswehr
grundsätzlich gebilligt werden. Eine Emnid-Umfrage im Auftrag
des Verteidigungsministeriums ergab, dass 81 Prozent von 2.000
Befragten friedenserhaltenden Einsätzen zustimmten. Bei
Kampfeinsätzen (unter UN-Mandat) lag die Zustimmung immerhin
noch bei 56 Prozent. Der jüngste ARDDeutschlandtrend,
durchgeführt von Infratest dimap, zeigte, dass 57 Prozent der
Befragten militärische Einsätze zur Friedenssicherung
befürworten. Dennoch hielt es eine Mehrheit von 69 Prozent
für geboten, dass sich die Bundeswehr von der einen oder
anderen Mission zurückzieht.
Fotos: Picture-Alliance
Grafiken: Marc Mendelson
Text: Claudia Kemmer
Erschienen am 31. Januar 2007

Aktuelle Ausgabe
Die aktuelle Ausgabe von BLICKPUNKT BUNDESTAG können Sie hier als PDF-Datei öffnen oder herunterladen.
Mitmischen
Mitmischen.de ist das Jugendforum des Deutschen Bundestages im Internet mit Chats, Diskussionsforen, Abstimmungen, Nachrichten und Hintergrund-
berichten.
Europa
Europa ist überall — Europäische Gesetze regeln den Alltag, Euro-Münzen klimpern im Portemonnaie. Aber was bedeutet es eigentlich, zu Europa zu gehören? GLASKLAR hat sich in Europa umgesehen.