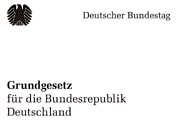"Grundrechtliche Ordnung nicht in Gefahr"
Podiumsdiskussion zum Zustand des Grundgesetzes im 60. Jahr
Nur rund 2,5 Prozent der jährlich etwa 6.000 Verfassungsbeschwerden führen zum Erfolg. Für den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, ist dies ein gutes Zeichen für die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. "Gefahren für die grundrechtliche Ordnung der Bundesrepublik sehe ich nicht", sagte Papier am Donnerstag, dem 21. Mai 2009, beim Verfassungsgespräch im Berliner Paul-Löbe-Haus aus Anlass des 60. Geburtstages des Grundgesetzes.
Die Aufzeichnung ist abrufbar (rechts).
In einer Podiumsdiskussion setzten sich Papier und dessen
Amtsvorgängerin Prof. Dr. Jutta Limbach, die Bundesminister
Dr. Wolfgang Schäuble (CDU) und Brigitte Zypries (SPD) sowie
Dr. Joachim Gauck, Vorsitzender des Vereins "Gegen Vergessen
– für Demokratie", mit dem "Versprechen von Demokratie
und Rechtsstaat" auseinander.
Bundestagspräsident Prof. Dr.
Norbert Lammert (CDU) gab im Beisein von Bundeskanzlerin Dr. Angela
Merkel (CDU) und Altbundespräsident Prof. Dr. Roman Herzog
eine persönliche Einschätzung zum Zustand des
Grundgesetzes ab. Ende 2010 werde das Grundgesetz länger
gelten als die beiden deutschen Vorgänger-Verfassungen
zusammen, die Verfassung des Kaiserreichs und die der Weimarer
Republik.
Bei ausländischen Besuchern gelte das Grundgesetz als eine der
großen Verfassungen der Welt, es genieße in Deutschland
die höchste Reputation aller Verfassungsorgane: "Die Deutschen
trauen ihren Richtern mehr als ihren Politikern."
Umfang verdoppelt
Seit 1949 sei das Grundgesetz 54 Mal geändert worden, weniger als einmal jährlich, aber doppelt so oft wie die US-Verfassung in 200 Jahren, sagte Lammert. "Für jede einzelne Änderung gab es Gründe. Aber dass dem Verfassungsgesetzgeber jede einzelne Änderung gleich gut gelungen sei, wird man nur zögernd behaupten wollen", meinte der Präsident. Inzwischen habe das Grundgesetz nahezu den doppelten Umfang der Urfassung. Ob es besser, präziser geworden sei, diese Frage werde man sich gefallen lassen müssen.
Lammert erkannte einerseits einen "beachtlichen Gestaltungsehrgeiz
des Verfassungsgesetzgebers", mit dem er "nicht restlos zufrieden"
sei. Andererseits gebe es auch die Vermutung, dass aufgrund einer
engen Auslegung der Verfassung durch Karlsruhe der erforderliche
Spielraum nur erreicht werden könne, indem der Verfassungstext
geändert wird. "Welche Folgen hat es, wenn immer häufiger
neben Grundsätzen und Grundregeln politische
Gestaltungsabsichten mit Verfassungsrang ausgestattet werden?",
fragte der Präsident.
"Spielräume eingeengt"
Er halte nichts von Verfassungslyrik, davon, viele Staatsziele in das Grundgesetz zu schreiben, sagte Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble in der Diskussion. Eine "Schuldenbremse" etwa entziehe sich ein Stück weit verfassungsrechtlicher Regelung. Für Jutta Limbach werden durch Detailregelungen in der Verfassung Spielräume eingeengt.
So hätten beispielsweise Regelungen in den Artikeln 13 zum so
genannten großen Lauschangriff und in Artikel 16a zum
Asylrecht in einfache Gesetze gehört. "Es geht nicht nur um
Sprachästhetik", betonte Limbach, die von 1994 bis 2002 an der
Spitze des Bundesverfassungsgerichts stand.
Spannungsverhältnis verschoben
Die Frage des Moderators Dr. Peter Frey, Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, ob es in der Gesetzgebung der Parlamente "handwerkliche Mängel" gebe, verneinte Papier. Ein Großteil der von Karlsruhe verworfenen Sicherheitsgesetze nach den Terrorangriffen seien Landesgesetze gewesen.
Das vom Gesetzgeber auszutarierende Spannungsverhältnis
zwischen Freiheit und Sicherheit habe sich durch neuartige
Sicherheitsgesetze zulasten der Freiheit verschoben, etwa bei der
Online-Durchsuchung oder der Vorratsdatenspeicherung. "Die
Fälle eines notwendigen Eingriffs des
Bundesverfassungsgerichts werden sich aber wieder etwas verringern"
prognostizierte Papier.
Verfassungswandel durch Rechtsprechung
Für Bundesjustizministerin Brigitte Zypries muss die Verfassung "im Grundsatz" nicht geändert werden. Allerdings weiche der Verfassungstext zunehmend vom tatsächlichen Verfassungsrecht ab. Die Verfassung müsse wieder lesbar und verstehbar werden.
Aus der Sicht von Hans-Jürgen Papier darf keine zu große
Kluft zwischen Verfassung und Verfassungswirklichkeit entstehen.
Der Verfassungswandel werde zu einem erheblichen Teil durch die
Rechtsprechung des Verfassungsgerichts ausgelöst.
Vom Untertanen zum Staatsbürger
Breiten Raum nahm in der Diskussion die Frage nach mehr direkter Demokratie ein. Für Jutta Limbach hat sich in den vergangenen 60 Jahren ein Wandel vom Untertanengeist zur Staatsbürgerkultur vollzogen. Zu fragen sei, ob plebiszitäre Elemente auf Länderebene nicht eher angebracht wären als auf Bundesebene, wo sie zur Vorsicht mahnte. Gedacht werden könnte an Volksbegehren, "die das Parlament herausfordern".
Hans-Jürgen Papier bekannte, dass er kein Freund
plebiszitärerer Elemente auf Bundesebene sei, weil die Fragen
zu komplex seien und nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden
könnten. Gedacht werden könnte an ein erweitertes
Initiativrecht für ein bestimmtes Quorum der Bevölkerung.
"Ein Gesetzesbeschluss muss aber dem Parlament vorbehalten
bleiben", sagte Papier. Ein Volksentscheid auf Bundesebene
dürfte nicht die Gesetzgebungshoheit der Länder
berühren. Allerdings begründe der Lissabon-Vertrag ein
Initiativrecht des europäischen Volkes.
Zwei Mentalitäten
Mit Blick auf "immer mehr Europa" bekundete Joachim Gauck die Sorge, dass in diesem Europa weniger Rechtsstaatlichkeit herrschen könnte. "Da muss sich was entwickeln", sagte der frühere DDR-Bürgerrechtlicher und spätere Leiter der Stasi-Unterlagen-Behörde. Ebenso stelle sich die Frage, wie viele Schulden, wie viel Ressourcenverbrauch man den nächsten Generationen aufbürden könne.
Gauck bezeichnete sich in Anlehnung an einen westdeutschen Begriff
der Vorwendezeit als "Verfassungspatriot". Das Grundgesetz sei mehr
als ein "Goldrahmen", sondern eine stabile Basis. "Die Ostdeutschen
hatten den Wertekanon, den wir im Grundrechtekatalog des
Grundgesetzes haben", so Gauck, der zwei Mentalitäten
diagnostizierte: die in 60 Jahren gut entwickelte Zivilgesellschaft
im Westen und die Folgen einer langen politischen Ohnmacht von 1933
bis 1989 im Osten.
Dort sei das Bewusstsein von der eigenen Rolle als Bürger noch
nicht so ausgeprägt. Der Frust und die Furcht vor der Freiheit
würden aber "auswachsen". Die geringe Wahlbeteiligung in
reiferen Demokratien kann nach Ansicht Wolfgang Schäubles auch
darauf zurückzuführen sein, dass psychologisch gesehen
das, was man habe, nicht so viel wert sei wie das Gefährdete
oder das, was man haben möchte.
Weitere Informationen
Fotos, Audios, Videos
Informationsmaterial
- 60 Jahre Grundgesetz
- Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland