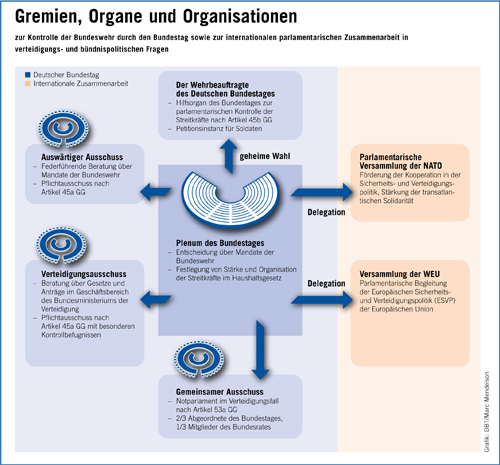Was bedeutet Parlamentsarmee?
Bundestag und Bundeswehr
Bundestag und Bundeswehr — beide haben seit der Wiedervereinigung Deutsche aus Ost und West wie selbstverständlich in ihre Reihen aufgenommen und Deutschland als Ganzes repräsentiert. Aber nicht nur das Zusammenwachsen der Nation verbindet sie. Vieles ist einzigartig in den deutschen Streitkräften. Zivilisten haben letztlich das Sagen: Mit diesem Primat der Politik ist Deutschland nach den leidvollen Erfahrungen im Nationalsozialismus ganz gut gefahren. Die Schlüsselrolle bei der Kontrolle und der Entscheidung über den Einsatz der Armee weist das Grundgesetz dem Bundestag zu — und begründet damit das Selbstverständnis der Truppe als „Parlamentsarmee”.
Rund neun Millionen Deutschen
kann niemand etwas vormachen,
wenn es um die Bundeswehr
geht. Denn sie haben die Truppe von innen
kennengelernt. Als Wehrpflichtige,
als Zeit- oder Berufssoldaten. Einer
von ihnen: Winfried Nachtwei, heute
Sicherheitspolitischer Sprecher von
Bündnis 90/Die Grünen. Er weiß
sich noch gut an seine Gefühle im
Bahnhof von Mönchengladbach zu
erinnern, „als die Zeit der Freiheit
nach dem Abi endete und die Brüllerei
begann”. Mitte der 60er sei es beim
Bund noch „krass anders” gewesen.
Oder auch wieder nicht. Denn sein
„Gegenerlebnis” hatte er nach der
Entlassung aus der Truppe, als er an
der Münsteraner Ordinarienuniversität
zu studieren begann. „Beim Bund
gab es die Wehrdisziplinarordnung,
die Wehrbeschwerdeordnung. Jeder
Soldat hatte seine Rechte. Damit war
es für den normalen Studenten an der
Universität vorbei.”
Kaum einer, der nicht irgendwann
persönliche Erfahrungen mit der
Bundeswehr macht. Ulrike Merten,
heute Vorsitzende des Verteidigungsausschusses
des Deutschen Bundestages,
zog es als kleines Kind zu einer
Bundeswehrausstellung, und sie
staunte nicht schlecht, die noch junge
Truppe mit ihrem mitten in Bielefeld
aufgebauten Reservelazarett so ausgerüstet
vorzufinden wie das örtliche
Krankenhaus. Die interessanteste Beobachtung
machte sie jedoch bei der
Betrachtung ihrer Eltern. Nach schlimmen
Erfahrungen im Weltkrieg waren
sie zunächst auf absolutem Ablehnungskurs
jeglicher „Wiederbewaffnung” in
Deutschland, versuchten ihrer Tochter
ebenfalls eine kritische Einstellung
zu vermitteln. „Das hat mir nicht
geschadet”, erinnert sie sich. Aber
Schritt für Schritt hätten auch ihre
Eltern erkannt, dass all das, was in
der Wehrmacht schiefgelaufen war, in
der Bundeswehr ganz anders angefasst
wurde. Der selbstbewusste Soldat mit
„Innerer Führung” statt blindem Gehorsam
zum „Führerbefehl”.
Staatsbürger in Uniform
Paul Schäfer, Obmann der Frak tion
Die Linke im Verteidigungs ausschuss,
hat, wiewohl vielfach ganz anderer
Mei nung, stets ein „entspanntes Verhältnis”
zu Bundeswehrsoldaten gehabt.
Sei es während des Studiums in
Marburg, als er mit Soldaten im selben
Fußballverein kickte, sei es in den
aufwühlenden Nachrüstungsdebatten,
als er mit „kritischer Distanz” mit
Soldaten auf einem Podium stand und
dabei die Argumente der Friedensbewegung
vertrat. Dagegen gehörte für
Bernd Siebert, Verteidigungspolitischer
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, die
Bundeswehr in seiner nordhessischen
Hei mat „zum Straßen bild”. Damals
habe es in der Nähe zur innerdeutschen
Grenze deutlich mehr Standorte und
Großmanöver gegeben. Schon damals
empfand er die Truppe „als Garant
für Stabilität und Sicherheit”.
Birgit Homburger, Obfrau der
FDP, bekam durch die Patenschaft
ihrer Heimatgemeinde Hilzingen mit
einer Kompanie aus Immendingen
die ersten Kontakte zur Bundeswehr.
Die Patenkompanie machte Biwaks in der Gemeinde, setzte Kinderspielplätze
instand und war nach dem Eindruck
von Homburger „einfach sehr bürgernah”.
Bei SPD-Obmann Rainer
Arnold liegen die ersten tiefer gehenden
Eindrücke von der Bundeswehr
gerade zehn Jahre zurück — als er
in den Verteidigungsausschuss kam.
Seine Wahrnehmung: „Urteile der Gesellschaft
gegenüber Soldaten müssen
korrigiert werden.” Er wolle die
Truppe nicht glorifizieren, da gebe es
wie überall in der Gesellschaft bessere
und weniger gute. Doch eines
sei bemerkenswert: „Ich treffe bei
den Soldaten mehr politisch reflektierende
Menschen als ansonsten im
Durchschnitt der Bevölkerung.”

Einsatz für Frieden und Stabilität: Bundeswehrkonvoi in Afghanistan
© Picture-Alliance/Syed Jan Sabawoon
Sie dienen nicht einem Minister oder einer Kanzlerin, sie dienen dieser Republik, also der parlamentarischen Demokratie. Der Gedanke an deutsche Soldaten hatte bei der Gründung der Bundesrepublik 1949 keine Rolle gespielt. Das Grundgesetz sah keine Streitkräfte vor. Doch die Einbindung in den Westen, die Zuspitzung des Kalten Krieges und der Eindruck des Korea - krieges ließ den Bundestag nach aufwühlenden Debatten 1952 doch einen Beitrag zur Lastenteilung im Westen beschließen. 1954 wurden die verfassungsrechtlichen Grundlagen geschaffen, die ersten Ernennungsurkunden 1955 überreicht. Doch das Parlament ist von Anfang an nicht beschränkt darauf, per Verfassung der Regierung Spielraum für die Einberufung junger Männer zum Waffendienst gegeben zu haben. Es gibt eine fünffache Klammer, die seit nunmehr über fünf Jahrzehnten immer wieder zu spüren ist und nach dem Eindruck sowohl der Truppe als auch der Politik im Großen und Ganzen gut funktioniert.
Da ist erstens die Festlegung durch den Bundestag, wann, wie und zu welchem Zweck die Truppe eingesetzt werden darf. Lange Zeit gehörte der Spannungs- und Verteidigungsfall zu den Szenarien, zu denen die Bundeswehr im Wesentlichen ins Le ben gerufen worden war. Wer unter welchen Umständen den Spannungs- und Verteidigungsfall festzustellen hatte und wie von Anfang an der Bundestag auch ins Spiel kommt, das ist verfassungsrechtlich, gesetzlich und in den Einsatzplanungen detailliert geregelt und wurde immer wieder durchgespielt. Bald nach Gründung der Bundeswehr wurde im Zusammenhang mit der Hamburger Flutkatastrophe 1962 klar, dass die Soldaten nicht nur durch Abschreckung potenzielle Angreifer von einem Krieg abhalten sollten, sondern dass sie ganz praktisch auch im Innern wirken können, wenn die Kräfte von Polizei und Hilfswerken erschöpft sind. Im Zuge der Amtshilfe können sie den zivilen Stellen mit Fähigkeiten zur Seite stehen, über die nur die Militärs verfügen.

Rechenschaft vor dem Parlament: Franz Josef Jung, Bundesminister der Verteidigung, spricht im Plenum
© DBT/Werner Schüring
Kontrolle und Beteiligung
Schon 1994 stellte das Bundesverfassungsgericht klar, dass solche Einsätze zwar möglich sind, aber jeweils vom Bundestag mandatiert, also unter Beschreibung der genauen Einsatzbedingungen und Einsatzstärken für einen gewissen Zeitraum genehmigt werden müssen. „Konstitutiv” sei dies, und das heißt: Ohne Beteiligung des Bundestages läuft nichts. Nach einem Jahrzehnt Erfahrungen mit Auslandseinsätzen legte das Parlament die genauen Abläufe in verschiedenen Abstufungen für die Intensität der Bundestagsbefassung 2005 im „Parlamentsbeteiligungsgesetz” fest. Am 7. Mai 2008 stärkte das Bundesverfassungsgericht diese parlamentarischen Rechte abermals, indem es auch scheinbare „Routineaufgaben” im Zusammenhang mit Bündnisverpflichtungen immer dann unter Zustimmungsvorbehalt stellte, wenn eine bewaffnete Auseinandersetzung „konkret” zu erwarten sei.
Zweitens hat der Gesetzgeber den Verteidigungsausschuss sogar in der Verfassung verankert und ihm das Sonderrecht zugeteilt, von sich aus auch die Aufgaben eines Untersuchungsausschusses wahrzunehmen, um Vorfälle und Entwicklungen in der Truppe wirksam aufklären zu können.
Drittens gibt es im Bundestag einen eigenen Wehrbeauftragten mit einem arbeitsfähigen Amt, dessen Aufgabe es ist, das Innere der Truppe ständig zu beleuchten. Viertens ist der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt im Verteidigungsfall die Bundeskanzlerin und in Friedenszeiten der Verteidigungsminister — die ebenfalls beide dem Bundestag verantwortlich sind. Der Regierungschef wird vom Bundestag gewählt, der Minister vor dem Bundestag vereidigt. Jederzeit kann er zu Plenar- oder Ausschusssitzungen herbeizitiert werden. In die Führung des Ministeriums eingebunden sind Abgeordnete als Parlamentarische Staatssekretäre.
Nicht zu unterschätzen ist — fünftens — auch das Budgetrecht des Parlaments. Damit gibt es vor, welchen Umfang und welche Fähigkeiten die Streitkräfte im Allgemeinen haben und welche Anschaffungen im Einzelnen getätigt werden können. Eine Fülle von Vorhaben darf erst dann ver wirklicht werden, wenn der Verteidigungsausschuss sowie der federführende Haushaltsausschuss zugestimmt haben.
Text: Gregor Mayntz
Erschienen am 18. Juni 2008

Aktuelle Ausgabe
Die aktuelle Ausgabe von BLICKPUNKT BUNDESTAG SPEZIAL können Sie hier als PDF-Datei öffnen oder herunterladen.
Mitmischen
Mitmischen.de ist das Jugendforum des Deutschen Bundestages im Internet mit Chats, Diskussionsforen, Abstimmungen, Nachrichten und Hintergrund-
berichten.
Europa
Europa ist überall — Europäische Gesetze regeln den Alltag, Euro-Münzen klimpern im Portemonnaie. Aber was bedeutet es eigentlich, zu Europa zu gehören? GLASKLAR hat sich in Europa umgesehen.