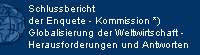11.2.2.4 Ressourcen (Kapitel 7 des
Abschlussberichts)
Die FDP begrüßt insbesondere die im
Bericht getroffene Feststellung, dass eine Auswei tung und
Intensivierung internationaler Handelsbeziehungen den Wohlstand
sowohl in den In dustrie- als auch in den
Entwicklungsländern steigert und dass insoweit veränderte
Rahmenbe din gungen des Welthandels prinzipiell keinen
Anlaß geben, die wirtschaftlichen Chancen, die mit der
Globalisierung verbunden sind, grundsätzlich zu beschneiden.
Positiv zu vermerken ist auch, dass der Bericht gängige
ökologische Ste reo typen – zumindest in der
ansonsten häufig anzutreffenden einseitigen und platten Form
– vermeidet. Dies gilt etwa im Hinblick auf die Stichworte
„Umweltdumping“, ökologisches
„race-to-the-bottom“, Standortverlagerung
„schmut ziger“ Industrien und ökologischer
Raubbau an natürlichen Ressourcen in den weniger entwickelten
Ländern.
Gleichwohl enthält der Text der
Enquete-Mehrheit an zahlreichen Stellen kritikwürdige
Passagen, die ein abweichendes Votum begründen und erfordern.
Dies betrifft zunächst die ungerechtfertigt positiven
Wertungen der deutschen Umweltpolitik der laufenden
Legislaturperiode. Unbegründet anerkennende Worte für die
nationale Umweltpolitik der Bundesregierung finden sich an mehreren
Stellen. Diesen Wertungen widerspricht die FDP. Ausdrückliche
Kritik verdienen ferner die Äußerungen zu den
Empfehlungen des WBGU-Gutachtens und die daraus abgeleiteten
Handlungsempfehlungen sowie die Ausführungen zum Wassermarkt.
Weitere Detail-Passagen sind aus (umwelt-) ordnungspolitischer
Sicht abzulehnen.
Exemplarisch für eine ungerechtfertigt
positive Wertung der deutschen Umweltpolitik der laufenden
Legislaturperiode ist die Vertagung des Bundesnaturschutzgesetzes.
Es wird ausgeführt, dass die Bundesregierung mit dessen
Novellierung einen „relativ vielversprechenden
Vorstoß“ gemacht habe; dieser sei „ein Schritt in
die richtige Richtung“, wenngleich „nicht weitgehend
genug“. Tatsächlich werden mit der
Naturschutzgesetznovelle bestehende Auflagen ausgeweitet und
verschärft; betroffene Wirtschaftsbereiche (Tourismus, Land-,
Forst- und Fischereiwirtschaft) werden zusätzlich belastet,
ohne dass dem Naturschutz hierdurch absehbar gedient würde.
Möglichkeiten zum kooperativen Naturschutz werden nicht nur
nicht erweitert, sondern zurückgenommen. Trotz zu erwartender
starker Regulierung und einer damit einhergehenden höheren
Belastung wird kein einheitlicher und hinreichender Ausgleich
für Naturschutzleistungen gewährleistet. Der Gesetzgeber
sollte den naturnahen Wirtschaftsbereichen aber zusätzlichen
Dirigismus ersparen. Tatsächliche Probleme im Naturschutz
ergeben sich weniger aus einem Mangel an Regulierung als vielmehr
daraus, dass die Naturschutzverwaltungen organisatorisch, personell
und finanziell schon derzeit kaum in der Lage sind, ihre Aufgaben
sinnvoll wahrzunehmen. Zur Behebung solcher Defizite trägt die
Novelle jedoch nichts bei, im Gegenteil: Mit der Abkehr vom
anthropozentrischen Ansatz und einer Zurückstufung des
Vertragsnaturschutzes zugunsten ordnungsrechtlicher Maßnahmen
dient der Gesetzentwurf nicht einem dem Nachhaltigkeitsgrundsatz
verpflichteten Interessenausgleich und untergräbt die
Akzeptanz für Maßnahmen des Naturschutzes. Deshalb
müssen beim Naturschutz freiwillige Maßnahmen und der
Vertragsnaturschutz in den Vordergrund gestellt werden. Die
bestehende Ausgleichsregelung und gute fachliche Praxis sollen nach
Vorgabe der land- und forstwirtschaftlichen Fachgesetze erhalten
und weiterent  wickelt werden.
Sicherzustellen ist, dass die bestehende Ausgleichsregelung von den
Ländern umgesetzt wird, Vollzugsdefitize sind zu beseitigen.
Wirksamer Naturschutz ist auf eine sinnvolle Zusammenarbeit mit den
Naturnutzern angewiesen. wickelt werden.
Sicherzustellen ist, dass die bestehende Ausgleichsregelung von den
Ländern umgesetzt wird, Vollzugsdefitize sind zu beseitigen.
Wirksamer Naturschutz ist auf eine sinnvolle Zusammenarbeit mit den
Naturnutzern angewiesen.
In der daraus abgeleiteten
Handlungsempfehlung wird die Bundesregierung aufgefordert, den
Anteil der als Biotope zu schützenden Naturflächen auf
15–20 Prozent auszuweiten. „Biotop“ ist ein
Fachbegriff, mit dem man ursprünglich kleinere Naturreste
(kleine Tümpel usw.) meinte. Ökologisch
zweckmäßiger wäre es, die aus fachlicher Sicht
erhaltenswerten Biotoptypen und die zu schützenden Tier- und
Pflanzenarten zu konkretisieren. Die Festlegung undifferenzierter
Flächenquoten ist willkürlich und wenig hilfreich: Man
vergleiche die Bedeutung einer Zehn-Prozent-Vorgabe für einen
Flächenstaat wie Bayern etwa mit den Konsequenzen für
einen Stadtstaat. Rein quantitative Vorgaben ohne hinreichend
präzise qualitative Kriterien nützen dem Naturschutz
nichts. Generell ist die Eignung von Quoten als Zielgröße
für umweltpolitische Maßnahmen zweifelhaft.
Ökologisch motivierte Quoten erweisen sich meist als wenig
hilfreich für den Umweltschutz, was zuletzt am Beispiel der
Mehrwegquote im Bereich der Abfallpolitik deutlich geworden ist.
Quoten schränken politischen Entscheidungsspielraum
unnötig ein und entfalten ein unerwünschtes Eigenleben
auch dann, wenn bezüglich des ursprünglichen
Lenkungsziels kein Handlungsbedarf mehr besteht.
Des Weiteren
findet sich die Empfehlung, zur „Entwicklung einer
nachhaltigen Biodiversitätsstrategie“ die Verbände
in Form eines „Runden Tisches“ einzubeziehen und eine
interministerielle Arbeitsgruppe (IMA)
„Biodiversitätspolitik“ zu gründen.
Außerdem soll die Bundesregierung eine neue Institution beim
BMU einrichten, die nationale und verbindliche Regeln für
einen biopolitischen „Vorteilsausgleich“ formuliert.
Diese Vorschläge sind wenig überzeugend: Zum einen hat
beispielsweise die „interministerielle Arbeitsgruppe“
zum Thema „Nachhaltigkeit“ eher ernüchternde
Resultate erbracht. Auch sind die politischen Probleme im
Zusammenhang der Biodiversität kaum auf eine mangelhafte
Anzahl oder Struktur von deutschen Behörden
zurückzuführen. Im Gegenteil liegt der Verdacht nahe,
dass zusätzliche bürokratische Strukturen geschaffen
werden sollen. Gerade was den biopolitischen Vorteilsausgleich
betrifft, haben sich private Unternehmen schon beachtlich
engagiert, ohne dass solche Initiativen in dem Abschlussbericht
angemessene Erwähnung finden. Beispielsweise hat Costa Rica
die landeseigene Natur zum nationalen Erbe erklärt. Dessen
nachhaltige Nutzung obliegt dem Instituto Nacional de Biodiversidad
(INBio). Das Institut schloß 1991 einen Vertrag mit dem
Pharmaunternehmen Merck, der Nutzungs- und Lizenzgebühren
für genetische Ressourcen vorsieht. Das Beispiel zeigt, dass
auch im Bereich der Biodiversität ökonomische Anreize,
marktliche Mechanismen und private Initiativen sachgerecht genutzt
und eingebunden werden müssen, statt diese von vornherein in
korporatischen und quasi-behördlichen Strukturen zu ersticken.
Statt dessen findet rot-grüne Quotenvorliebe
regelmäßig ihr institutionelles Pendant in
behördlicher Amtskompetenz, die mit korporatistischen
„Kaffeekränzchen“ am Runden Tisch gepaart werden
soll. Runde Tische sind gefährliche Möbel. Sie verwischen
vor allem die Verantwortlichkeit der Regierung vor Parlament und
Bürgern. Zumeist werden hier politische Geschäfte zum
Nachteil derer verabredet, für die am „runden
Tisch“ – wohlweislich – kein Stuhl vorgesehen
ist.
Die
Ausführungen zur Privatisierung und Liberalisierung des
Wassermarktes in Deutschland sind unangemessen zurückhaltend
und konservativ. Die Enquete-Kommission spricht sich gegen eine
grundlegende Neuordnung der Strukturen der deutschen
Wasserwirtschaft durch die Streichung des kartellrechtlichen
Ausnahmetatbestandes nach § 103 GWB (alte Fassung) und gegen
eine Liberalisierung des deutschen Wassermarktes aus. Dem ist
nachdrücklich zu widersprechen: Als einzigartiges Naturprodukt
ist Wasser sowohl in Deutschland als auch weltweit ein
lebensnotwendiges Gut. Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser
erfordert deshalb besondere Sorgfalt und strenge Kontrolle.
Unabhängig davon, ob die Wasserwirtschaft in der Hand
öffentlich-rechtlicher oder privater Unternehmen liegt, muss
der Staat dafür Sorge tragen, dass höchste
ökologische und gesundheitliche Standards gewahrt bleiben.
Diese sind in Deutschland seit Jahrzehnten verbindlich und sollen
es auch bleiben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Staat diese
Aufgabe selbst wahrnehmen muss. Nach Auffassung der FDP besteht
kein Widerspruch zwischen einer hohen Bedeutung der
Wasserversorgung für den Umwelt- und Gesundheitsschutz auf der
einen sowie Wettbewerb und Privatisierung der Wasserversorgung auf
der anderen Seite. Andere lebensnotwendige Güter werden
qualitativ hochwertig und zuverlässig ebenfalls durch Private
zur Verfügung gestellt. Niemand käme etwa auf die Idee,
dass das Grundnahrungsmittel Brot etwa nur durch
öffentlich-rechtliche Anbieter zur Verfügung gestellt
werden dürfte. Insoweit ist nicht einzusehen, dass die
Wasserversorgung nicht auch durch Private erbracht werden sollte.
Entscheidend ist, dass die hohe Qualität des Trinkwassers
gewährleistet bleibt. Die kostensenkenden und
innovationsfördernden Kräfte von Markt und Wettbewerb
müssen zum Vorteil aller Bürger auch für den
Wassermarkt genutzt werden. Die Wasserversorgung kann in
Deutschland privatisiert werden, ohne dass
Qualitätseinbußen zu befürchten wären. Dieses
Votum ist freilich auf Deutschland bezogen: Es kann
selbstverständlich nicht ohne weiteres auf andere Länder
übertragen werden. Der Vorschlag der Kommission, das Recht auf
Wasser als „individuelles Grundrecht“ festzuschreiben,
ist ehrenwert, dürfte aber das Problem der Wasserversorgung
gerade in den besonders betroffenen (und ärmsten) Regionen der
Welt kaum lösen, zumal gerade dort andere (und ältere)
Grundrechte, wie etwa das Grundrecht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit, kaum erkennbare Wirkung zeigen. Zum Sprachgebrauch
des Berichts an dieser Stelle ist im übrigen anzumerken,
daß es sich beim Wasser – zumindest in ökonomischer
Diktion – eben nicht um ein „öffentliches
Gut“ handelt. Wissenschaftliche Fachbegriffe sollten entweder
korrekt verwendet oder vermieden werden, da anderenfalls Miss
verständnisse unvermeidlich sind. Bedenklich ist außerdem
die Forderung, Kosten betriebswirtschaftlich zu  ermitteln, Preise die
jedoch „armutsgerecht“ zu gestalten. Auch hier ist die
(verteilungs-)politische Absicht ehrenwert. Die Wirkung staatlicher
Preisvorgaben ist aber nicht nur ordnungspolitisch heikel. In aller
Regel ist es sinnvoller, die Bildung von knappheitsgerechten
Preisen einem Markt zu überlassen und dabei sicherzustellen,
dass möglichst alle Kostenkomponenten Eingang in die Preise
finden. Sozialpolitische Umverteilung sollte dann besser über
direkte Einkommenstransfers, nicht jedoch über künstliche
Preisverzerrungen realisiert werden. Die Ausführungen zu
„Frauenspezifischen Auswirkungen der Wasserknappheit“
sind geeignet, ein ernstes Problem ins Lächerliche zu
ziehen. ermitteln, Preise die
jedoch „armutsgerecht“ zu gestalten. Auch hier ist die
(verteilungs-)politische Absicht ehrenwert. Die Wirkung staatlicher
Preisvorgaben ist aber nicht nur ordnungspolitisch heikel. In aller
Regel ist es sinnvoller, die Bildung von knappheitsgerechten
Preisen einem Markt zu überlassen und dabei sicherzustellen,
dass möglichst alle Kostenkomponenten Eingang in die Preise
finden. Sozialpolitische Umverteilung sollte dann besser über
direkte Einkommenstransfers, nicht jedoch über künstliche
Preisverzerrungen realisiert werden. Die Ausführungen zu
„Frauenspezifischen Auswirkungen der Wasserknappheit“
sind geeignet, ein ernstes Problem ins Lächerliche zu
ziehen.
Der Bericht macht sich Vorschläge des
Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale
Umweltveränderungen (WBGU) zu eigen. Dieser schlägt in
seinem Sondergutachten „Entgelte für die Nutzung
globaler Gemeinschaftsgüter“ vor, Entgelte auf die
Nutzung globaler Gemeinschaftsgüter, insbesondere den
internationalen Luftraum und die Hohe See, zu erheben. Die
zweckgebunden einzusetzenden Nutzungsentgelte sollen zum Schutz
dieser Güter beitragen und die internationale
Nachhaltigkeitspolitik stärken. Hinsichtlich der Verwaltung
der Mittel empfiehlt der WBGU, den größten Teil des
Aufkommens an bestehende internationale Institutionen zu vergeben,
etwa an die Globale Umweltfazilität (GEF) oder die neuen Fonds
zum Klimaschutz. Die FDP lehnt diese Vorschläge –
insbesondere auch den Vorschlag einer „emissionsorientierten
Flugverkehrsabgabe“ – ab. Ohne Zweifel können
umweltpolitisch motivierte Abgaben im Einzelfall ökologisch
sinnvoll und geboten sein. Auch sind für ökologisch
motivierte Abgaben Ausgestaltungen denkbar, die zu ökonomisch
vernünftigen Ergebnissen führen können. Allerdings
bergen solche Abgabenkonzepte stets die Gefahr von internationalen
Wettbewerbsverzerrungen und finanzieller Belas tungen
für die Bürger, ohne dass umweltbezogene Ziele hierdurch
tatsächlich erreicht werden. Es gilt zu vermeiden, dass
Abgaben den Umweltschutz bei den Bürgern diskreditieren, indem
der Eindruck entsteht, es gehe nicht um Umweltschutz, sondern um
das Erzielen von Einnahmen für den Staat. Hervorzuheben ist
dabei der kaum lösbare Konflikt zwischen der Lenkungsfunktion
und der Finanzierungswirkung solcher Abgaben. Eine Zweckbindung des
Aufkommens für hehre Ziele – einerlei, ob für
ökologische, soziale oder sonstige Zwecke – ist dabei
nur ein scheinbarer und trügerischer Ausweg. Zwar ist eine
Zweckbindung für den Fiskus mitunter hilfreich, um den Griff
in private Brieftaschen durch scheinbare Gegenleis tungen
plausibel zu machen. Widerstände der Steuerbürger werden
auf diese Weise vielleicht geschwächt oder überwunden.
Derartige Verschleierungsmechanismen sind jedoch mit einem
liberalen Verständnis von Steuerpolitik unvereinbar, weil
mündige Bürger einen Anspruch darauf haben zu wissen,
welche konkreten Ziele mit einer Abgabe verfolgt werden sollen. Nur
so kann jeder einzelne in der Lage sein, gute von schlechter
Politik zu unterscheiden und seine Wahlentscheidung sachlich zu
begründen. Die Zweckbindung von Steuermitteln
beeinträchtigt demgegenüber die Transparenz staatlicher
Eingriffe. Im undurchschaubaren Dickicht fiskalischer Umverteilung
wird für den Einzelnen letztlich unsichtbar, ob er zu den
Gewinnern oder zu den Verlieren staatlicher Eingriffe gehört.
Davon abgesehen schafft jede Zweckbindung sachfremde
Wirkungszusammenhänge. Ohne Sachzusammenhang werden bei einer
Zweckbindung die Spielräume zur Erfüllung einer
staatlichen Aufgabe abhängig von dem Grad, in dem die
Erfüllung einer anderen staatlichen Aufgabe gelingt.
Insbesondere die von der Bundesregierung in Deutschland
eingeführte „Ökosteuer“ hat die
Glaubwürdigkeit staatlicher Umweltpolitik in diesem Sinne
massiv beschädigt. Wie kann es glaubwürdig um den
Umweltschutz gehen, wenn doch die Einnahmen aus der Ökosteuer
an anderer Stelle schon fest eingeplant sind?
Die Überlegungen der Kommission zu der
Frage, wie eine höhere Akzeptanz für den Umweltschutz in
Entwicklungsländern geschaffen werden könnte, ignorieren
weitgehend die ökologischen und ökonomischen Chancen, die
ein moderner Klimaschutz auf der Grundlage der flexiblen
Mechanismen des Kyotoprotokolls auch für diese Länder
bieten könnte. Die FDP engagiert sich deshalb seit langem
für eine aktive Klimapolitik. Durch Emissionszertifikate und
deren weltweiten Handel wird insbesondere auch für die weniger
entwickelten Länder eine attraktive Möglichkeit
erschlossen, substanzielle Beiträge zum Klimaschutz zu leisten
und zugleich aktiv und in eigener Verantwortung am Welthandel
teilzunehmen und auf diese Weise ihre wirtschaftliche Situation zu
verbessern. Ein weltweiter Emissionshandel ist insoweit auch eine
große Chance für die entwicklungspolitische
Zusammenarbeit. Neben einer konstruktiven Begleitung
klimapolitischer Aktivitäten auf europäischer und auf
multilateraler Ebene muss Deutschland auf dem Weg bilateraler
Zusammenarbeit die Initiative zur Umsetzung von
Klimaschutzprojekten auch im Ausland ergreifen.
Entwicklungspolitische Konzepte müssen unter expliziter
Bezugnahme auf die Mechanismen des Kyotoprotokolls verstärkt
in ein zu entwickelndes klimapolitisches Gesamtkonzept Deutschlands
eingebunden werden. Derartige Einsichten wären dem globalen
Umwelt- und Klimaschutz dienlicher als die Forderung, bei
„den Verhandlungen um die zweite Verpflichtungsperiode des
Kioto-Protokolls darauf (zu dringen), dass auch diejenigen
klimawirksamen Emissionen des Flugverkehrs (wie etwa
Kondensstreifen) berücksichtigt und einbezogen werden, die
nicht zu den sechs sogenannten „Kioto-Gasen“
zählen“.
11.2.2.4.1 Für eine ökonomisch
durchdachte Umweltpolitik
Zum Zusammenhang zwischen Globalisierung und
ökologischem Gleichgewicht vertritt die FDP grundsätzlich
die folgende Position:
Befunde
1. Das Wachstum der
Weltwirtschaft bringt vielfältige ökologische Probleme
mit sich. Es ist nützlich, zwi  schen globalen und lokalen Problemen zu
unterscheiden: schen globalen und lokalen Problemen zu
unterscheiden:
– Durch die weltweite Zunahme der
wirtschaftlichen Aktivität kommt es zu ökologischen
Veränderungen auf dem „Planet Erde“, die für
die Zukunft der Mensch- heit von großer Bedeutung sein
können: Abbau der
Ozonschicht, Temperaturanstieg und Klimaveränderung,
Überfischung der Weltmeere, Abholzung der Tropenwälder,
Verminderung der biologischen Vielfalt u.a.
– In lokalen Ballungszentren des raschen
wirtschaftlichen Wachstums kommt es zu extremen ökologischen
Engpässen: Luft- und Wasserverschmutzung durch Emissionen der
Industrie und des Autoverkehrs, Trinkwasserknappheit und massive
lokale Zerstörung von Lebensräumen von Tieren und
Pflanzen, u.a.
2.
Globale ökologische Probleme sind in den neunziger Jahren
verstärkt zum Gegenstand internationaler Vereinbarungen
geworden. Soweit diese Vereinbarungen konkrete Maßnahmen
vorschreiben, folgen sie einem typischen Muster: relativ starke
ökologische Beschränkungen für Industrieländer,
dagegen kaum Beschränkungen für Entwicklungsländer.
Besondere Beachtung verdient in dieser Hinsicht das Kyoto-Protokoll
von 1997, das Verpflichtungen zur Senkung der Emission von
Treibhausgasen festlegt, um der Erwärmung der
Erdatmosphäre zu begegnen. Diese Verpflichtungen sind
international stark differenziert: Während die
EU–Staaten bei den sechs wichtigsten Treibhausgasen eine
Reduktionspflicht von in der Summe 8 v.H. gegenüber 1990
übernommen haben, wurde das Burden-sharing innerhalb der
EU-Staaten stark differenziert. Die innereuropäische
Bandbreite der Verpflichtungen reicht von Deutschland (mit einer
Reduktionspflicht von 21 Prozent) über Frankreich (keine
Reduktionspflicht) bis zu Portugal und Griechenland (27 bzw. 25
Prozent Emissionssteigerung). Frei von Beschränkungen sind die
Entwicklungsländer und die schnell wachsenden EMEs.
3. Lokale ökologische
Probleme sind in der Vergangenheit auf nationaler Ebene mit sehr
unterschiedlicher Intensität angegangen worden:
– In den westlichen
Industrieländern ist es in den letzten Jahrzehnten gelungen,
die ökologische Situation urbaner Ballungszentren und damit
die Lebensqualität für die dort lebenden Menschen
deutlich zu verbessern. Dies gelang in der Regel durch die
Kombination mehrerer Maßnahmen: Aufbau einer verbesserten
Infrastruktur, Sanierungen kontaminierter Regionen, staatliche
Regulierung von Emissionen und Immissionen etc. Auch die Abnahme
der Bevölkerungswanderung vom Land in die Städte nach dem
endgültigen Abschluss der Industrialisierung war in dieser
Hinsicht hilfreich.
– In den
Entwicklungsländern – und besonders in den über
Jahrzehnte schnell wachsenden EMEs – hat sich die
ökologische Situation urbaner Ballungszentren dagegen
verschlechtert. Die Maßnahmen, die bisher zur Lösung der
Probleme ergriffen wurden, sind nach den Maßstäben der
Industrieländer noch völlig unzureichend. Auch die
Bevölkerungswanderung vom Land in die Städte hält
an.
4. Vielfach wird die
Globalisierung für die Zunahme weltweiter Umweltprobleme
verantwortlich gemacht. Da die weltwirtschaftliche Arbeitsteilung
zu mehr Wachstum und Wohlstand führt, kann dies auch ein
höheres Maß an Umweltbelastung bedeuten, weil z.B. bei
der ausgeweiteten Produktion von Gütern und Dienstleistungen
zusätzliche Emissionen anfallen und mehr Konsumgüter auch
mehr Abfall mit sich bringen. Unabhängig von der
Globalisierung setzen vor allem in Entwicklungsländern
örtliche Produzenten vielfach Technologien ein, die wesentlich
umweltbelastender sind als die in Industrieländern angewandten
Produktionsmethoden. Gegenüber global operierenden Unternehmen
wird vor diesem Hintergrund häufig der Vorwurf erhoben, dass
sie bei ihren Investitionen in Entwicklungsländern die noch
fehlenden oder sehr geringen Umweltstandards kostensparend
ausnutzen oder sogar nur deswegen überhaupt dort tätig
werden. Für die Produktion in den Industrieländern werden
Kritikern zufolge gerne umweltintensive Vorprodukte aus
Entwicklungsländern bezogen.
5. Diesen Vorwürfen ist
entgegenzuhalten, dass bei Direktinvestitionen in
Entwicklungsländern schon aus betriebswirtschaftlichem
Kalkül in der Regel die gleichen Anlagen zum Einsatz kommen
wie in Industrieländern. Viele Anlagen sind heute schon so
konstruiert, dass nicht nur weniger Rohstoff im Produktionsprozess
benötigt wird, sondern die Rohstoffe auch effizienter
verwertet werden (integrierter Umweltschutz). Wird das gleiche
Produkt an einem ausländischen Standort hergestellt, so lohnt
es sich in aller Regel nicht, die in die Anlage eingebauten
emissionssenkenden Technologiebestandteile extra wieder zu
entfernen. Das wäre teurer als der Einsatz einer bereits
erprobten Technologie auch im Ausland. Da zudem nicht nur
Unternehmensstrategien, sondern auch Nachrichten global sind,
werden Umweltschädigungen durch multinationale Konzerne, die
z.B. beim Kauf einer örtlichen Produktionsstätte mit
veralteter Technik in einem Entwicklungsland publik werden,
inzwischen in der Regel weltweit sehr schnell bekannt. So entsteht
ein starker Druck in entwickelten Ländern auf den Investor,
keine Produktions- und Verarbeitungsmethoden in
Entwicklungsländern einzusetzen oder beizubehalten, die
besonders umweltintensiv sind.
6. Weltweit existieren sehr
unterschiedliche Umweltstandards. Dies ist nicht nur auf die
unterschiedliche Reichweite von Umweltbelastungen
zurückzuführen (lokal, regional, national oder global),
sondern auch darauf, dass Umweltschutz ein Gut ist, das erst mit
dem Erlangen eines gewissen Wohlstandsniveaus verstärkt
nachgefragt wird. Aus diesem Grund sperren sich viele
Entwicklungsländer nicht nur gegen einen angemessenen Schutz
lokaler Umweltgüter – was letztlich ihren eigenen
Interessen zuwiderläuft –  sondern zaudern auch beim Schutz internationaler
bzw. globaler Umweltgüter. Der wirtschaftspolitisch
grundsätzlich richtige Ansatz, auf dezentrale Lösung zu
setzen, bei denen der Staat lediglich den Rahmen und die Anreize
vorgibt, die Lösungen aber „von unten“gefunden
werden, wird deshalb je nach betrachteter Volkswirtschaft zu sehr
unterschiedlichen Ergebnissen führen. Aber gerade im
Umweltschutz kann auf einen solchen dezentralen Ansatz nicht
verzichtet werden. Die technischen Prozesse, die nötig sind,
um Umweltrisiken zu mindern oder zu vermeiden, basieren in der
Regel auf unternehmensinternen Kenntnissen, so dass ein staatliches
Ordnungsrecht an Grenzen stößt. sondern zaudern auch beim Schutz internationaler
bzw. globaler Umweltgüter. Der wirtschaftspolitisch
grundsätzlich richtige Ansatz, auf dezentrale Lösung zu
setzen, bei denen der Staat lediglich den Rahmen und die Anreize
vorgibt, die Lösungen aber „von unten“gefunden
werden, wird deshalb je nach betrachteter Volkswirtschaft zu sehr
unterschiedlichen Ergebnissen führen. Aber gerade im
Umweltschutz kann auf einen solchen dezentralen Ansatz nicht
verzichtet werden. Die technischen Prozesse, die nötig sind,
um Umweltrisiken zu mindern oder zu vermeiden, basieren in der
Regel auf unternehmensinternen Kenntnissen, so dass ein staatliches
Ordnungsrecht an Grenzen stößt.
Politische Konsequenzen
1.
Aus liberaler Sicht muss die Umweltpolitik so gestaltet sein, dass
sie vorgegebene ökologische Ziele mit einem Minimum an
ökonomischen Kosten erreicht. Dies impliziert, dass jede
ökologische Maßnahme stets genau dahin
überprüft wird, ob es Alternativen gibt, die weniger
wirtschaftliche Ressourcen verschlingen und weniger Optionen
für die Zukunft verstellen. Wer diese Prüfung vornimmt,
muss dazu legitimiert sein. Hier gilt es wieder, zwischen globalen
und lokalen Umweltproblemen zu unterscheiden.
2.
Bei der Lösung globaler Umweltprobleme sind internationale
Absprachen unumgänglich, auch wenn einzelne Länder eine
Vorreiterrolle übernehmen, eine Vorbildfunktion ausüben
und auch wenn isolierte Beiträge zur Lösung globaler
Probleme beitragen können. Die Bemühungen der
internationalen Staatengemeinschaft, insbesondere im Bereich der
Senkung von Schadstoffemissionen zur Klimastabilisierung weisen
dabei zwei Schwächen auf:
– Sie schließen jene Länder der
Erde fast vollständig von der Verpflichtung zur
Schadstoffreduktion aus, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in den
nächsten Jahren ein besonders starkes – und
schadstoffintensives – wirtschaftliches Wachstum erleben
werden. Dies gilt vor allem für eine Reihe von EMEs, darunter
China und Indien als die bevölkerungsreichsten Länder der
Welt. Tatsächlich wird nicht der Stand, wohl aber die
Entwicklung des weltweiten Schadstoffausstoßes maßgeblich
von dem wirtschaftlichen Wachstum allein in diesen beiden
Ländern abhängen.
– Sie ordnen die Hauptlast der
ökologischen Anpassung jenen Ländern zu, die bereits
wesentliche Schritte in Richtung der Schadstoffminderung getan
haben, in aller Regel die Industrieländer. Dies führt,
global betrachtet, zu sehr hohen Kosten der Schadstoffminderung:
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Kosten der Minderung von
Emissionen bei fast allen der bekannten Schadstoffe steil ansteigen
mit der bereits erreichten Senkung des Niveaus. Dies entspricht
auch der praktischen Lebenserfahrung mit Maßnahmen der
Schadstoffminderung: So stößt z. B. eine verstärkte
Isolierung von Wohnräumen – in Deutschland durch immer
striktere Wärmeschutzverordnungen erzwungen – dort an
harte ökonomische Grenzen, wo die Wohnqualität in den
bereits gut isolierten Räumen leidet und dadurch zunehmende
volkswirtschaftliche Folgekosten entstehen (so etwa Allergien bei
den Menschen, Feuchtigkeit in den Räumen der Häuser).
3.
Ökonomisch effizienter Umweltschutz verlangt Wege zu finden,
um in der Zukunft weltweite Schadstoff emissionen vor allem
dort zu vermindern, wo die Zunahme der Emissionen aufgrund des
wirtschaftlichen Wachstums voraussichtlich am größten
sein wird, weil dort – da es bisher kaum Bemühungen um
Verminderung gab – die Kosten pro reduzierter
Schadstoffeinheit am geringsten sind. Diese Anforderung weist
eindeutig in Richtung der Gruppe der EMEs. Diese müssen
veranlasst werden, Reformen durchzuführen und Technologien
einzusetzen, die für eine nachhaltige Minderung der
Schadstoffausstöße ihrer Volkswirtschaften sorgen. Dies
wird nur gehen, indem die Industrieländer entsprechende
politische Schritte finanziell und technisch unterstützen, da
die Bevölkerung in den EMEs selbst auf absehbare Zeit andere
Prioritäten setzt als den globalen Umweltschutz. In diesem
Zusammenhang kommt den flexiblen Kyoto-Instrumenten, insbesondere
dem „Clean Development-Mechanism“, eine herausgehobene
Bedeutung zu. Konkrete Ziele einer solchen globalen Umweltpolitik
sollten vor allem sein, dafür zu sorgen, dass die meisten
EMEs
– ihre Energieerzeugung grundlegend
verändern, und zwar weg von schadstoffintensiven fossilen
Brennstoffen hin zu weniger umweltbelastender Energiegewinnung,
– die Subventionierung des
Energieverbrauchs – weit verbreitet zur Stützung der
inländischen Industrie – reduzieren, bestenfalls
verbunden mit einer Liberalisierung der Energiemärkte und
einer Privatisierung der Versorgungsbetriebe
– auf ökologischen Raubbau mit
weltweiten Folgen verzichten (z.B. auf das Abholzen tropischen
Regenwalds).
Eine solche
Politik wird zweifellos nicht ohne fiskalische Belastungen für
die Industrieländer zu verwirklichen sein. Gleichwohl spricht
vieles dafür, dass diese volkswirtschaftlich weniger stark zu
Buche schlagen werden als die massive Fehllenkung von Ressourcen in
dem Versuch, ohnehin schon niedrige Schadstoffemissionen pro
erzeugter Energieeinheit hierzulande noch weiter mit hohem
technischen und finanziellen Aufwand zu reduzieren.
4.
Lokale Umweltprobleme sind allein Sache der betroffenen Region. Es
obliegt den Regierungen der jeweiligen Länder oder
Städte, in Absprache mit der lokalen Bevölkerung
umweltpolitische Ziele zu definieren und durch Maßnahmen
umzusetzen. Eine globale Umweltpolitik ist hier weder
erwünscht noch sinnvoll möglich. Jede internationale
Unterstützung zur Lösung lokaler Probleme ist deshalb
auch nicht wirklich Teil einer globalen Umweltpolitik, sondern
schlicht eine spezielle Form der Entwicklungshilfe. Diese mag im
Einzelfall durchaus sinnvoll sein, etwa für die wirtschaftlich
besonders rückständigen Länder, die TERs.
 Die Festlegung von Herstellungs- und
Weiterverarbeitungsverfahren bei einer Produktion fällt
zunächst in die Souveränität des Herstellers und
seines Sitzlandes, nicht in diejenige des Importlandes. Nur soweit
dies zu grenz überschreitenden
umweltbeeinträchtigenden Effekten führt, sind
zwischenstaatliche Verhandlungslösungen geboten. Dieses
Vorgehen ist zielführender als ein Versuch, bestimmte
Produktions- und Verarbeitungsmethoden, die sich das Importland
wünschen mag, generell mit Hilfe von Handelsrestriktionen
durchsetzen zu wollen. Die Festlegung von Herstellungs- und
Weiterverarbeitungsverfahren bei einer Produktion fällt
zunächst in die Souveränität des Herstellers und
seines Sitzlandes, nicht in diejenige des Importlandes. Nur soweit
dies zu grenz überschreitenden
umweltbeeinträchtigenden Effekten führt, sind
zwischenstaatliche Verhandlungslösungen geboten. Dieses
Vorgehen ist zielführender als ein Versuch, bestimmte
Produktions- und Verarbeitungsmethoden, die sich das Importland
wünschen mag, generell mit Hilfe von Handelsrestriktionen
durchsetzen zu wollen.
11.2.2.4.2 Offene Fragen
Die Punktation ist ausgesprochen ungenau. Es
ist nicht klar, was die Mehrheit der Enquete unter Umwelt und
Armutsbekämpfung versteht. Anreizstrukturen und
Finanzierungsstrategien einer technologischen Revolution zum
Ressourcenverbrauch sind Teil einer Diskussion über
Instrumente.
Konflikte beim Rohstoffabbau sind altbekannt;
Haftungsregeln im Sinne des Verursacherprinzips haben nichts mit
dem Thema der Globalisierung zu tun.


|