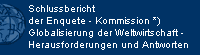10.2.1.4
„Regional Governance“ als Baustein einer Global Governance
Mit Blick auf die bislang existierenden völkerrechtlichen
Regelwerke sind v.a. regionale Integrationsprojekte (wie die EU, NAFTA, ASEAN,
Mercosur) Vorreiter für das Regieren jenseits des Nationalstaates. Hier lässt
sich nicht nur eine Orientierung der Wirtschaft, sondern – zumindest in Ansätzen
– auch der Politik in Richtung auf plurinationale Regionen beobachten. Global
Governance muss auf solchen größeren regionalen Kooperationskernen aufbauen
und sie als organisatorischen Unterbau nutzen, weil das Subsidiaritätsprinzip
auch im globalen Kontext sinnvoll bleibt und dem Aufbau teurer, aber ineffizienter
bürokratischer Wasserköpfe vorbeugen kann. Die Spanne zwischen den Bedürfnissen
der Menschen auf der lokalen Ebene und den globalen Ereignissen soll durch regionale
Komponenten überbrückt werden.
In Europa ist diese Instanz die sich erweiternde Europäische
Union, die sich seit Mitte der 90er Jahre – mittels der GASP – auch als außenpolitischer
Akteur zu konstituieren begann. Häufig wird von außen gar eine Vorbildfunktion
der EU für andere Regionen gesehen.19 Dabei steht vor allem das europäische,
auf sozialen Ausgleich gerichtete Marktmodell im Vordergrund, das in den Augen
vieler Menschen eine attraktive Alternative zum amerikanischen Modell ist. Diese
Wahrnehmung Europas in der Welt sollte von den Regierungen als Aufforderung
verstanden werden, dieses Modell zu verteidigen und die soziale Absicherung
von Menschen weltweit zu befördern (vgl. auch Kapitel 4).Auch die demokratische
Qualität der EU muss verbessert und durch Strukturreformen gefestigt werden.
Dies gilt auch im Hinblick auf die Verwirklichung von Geschlechterdemokratie
und Gleichstellung.20 Die Strukturreformen der EU sollten noch vor
der anstehenden Erweiterung abgeschlossen werden und eine Ausweitung des Mehrheitsprinzips
sowie ein höheres Maß an Legitimität der EU beinhalten.21
Das Weißbuch „Europäisches Regieren“ der EU-Kommission (2001f.)
geht vom Befund eines rückläufigen
Zutrauens der EU Bürger in die EU-Institutionen bei gleichzeitig zunehmenden
Forderungen nach politischen Lösungen von Alltagsproblemen (Arbeitslosigkeit,
Nahrungsmittelrisiken, Kriminalität, Konflikte an den Außengrenzen) aus. Zusätzliche
Herausforderung erkennen die Autoren im laufenden Erweiterungsprozess.
Das Weißbuch hebt die folgenden Grundsätze „guten
Regierens“ hervor: Offenheit, Partizipation, Verantwortlichkeit, Effektivität
sowie Kohärenz, neben Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität.22 Seine
Autoren fordern die Entwicklung von Kriterien, die auf eine stärkere und transparente
Einbeziehung der Menschen in die Politik gestaltung zielen.23 Zivilgesellschaftliche
Organisationen sollten an der Erarbeitung solcher Kriterien beteiligt werden.
Über die Organisation und Rolle des bisherigen Wirtschafts- und Sozialausschusses
soll neu nachgedacht werden, für die Beiziehung von Sachverständigen (derzeit
fast 700 beratende ad-hoc Gremien) mehr Transparenz,24 Rechenschaftspflicht
und damit auch Chancengleichheit erreicht werden. Die EU-Kommission will dafür
einen Verhaltenskodex vorlegen. Weitere Vorschläge zielen auf eine Konzentration
der Organe auf ihre Kernaufgaben: Der Rat sollte die Fachministerräte besser
koordinieren und seine politische Führungsfähigkeit verbessern. Die EU-Kommission
soll sich auf die Formulierung von Ini-
 tiativen und deren Durchführung konzentrieren. Sie ist die Hüterin der Verträge
und übernimmt die internationale Vertretung der Gemeinschaft. Das Europäische
Parlament soll die öffentliche Debatte über die Zukunft der EU und ihrer außenpolitischen
Rolle anleiten sowie die Durchführung der EU-Politiken und den Vollzug des Haushalts
stärker kontrollieren. Außerdem sollen seine Mitentscheidungsbefugnisse erweitert
werden. Leider bleibt im
Weißbuch die Rolle des Europäischen Parlaments, dessen Stärkung ein wichtiger
Schritt zu einer größeren Legitimität der Exekutive in Brüssel wäre, sonst weitgehend
ausgeblendet.
tiativen und deren Durchführung konzentrieren. Sie ist die Hüterin der Verträge
und übernimmt die internationale Vertretung der Gemeinschaft. Das Europäische
Parlament soll die öffentliche Debatte über die Zukunft der EU und ihrer außenpolitischen
Rolle anleiten sowie die Durchführung der EU-Politiken und den Vollzug des Haushalts
stärker kontrollieren. Außerdem sollen seine Mitentscheidungsbefugnisse erweitert
werden. Leider bleibt im
Weißbuch die Rolle des Europäischen Parlaments, dessen Stärkung ein wichtiger
Schritt zu einer größeren Legitimität der Exekutive in Brüssel wäre, sonst weitgehend
ausgeblendet.
Ein
105-köpfiger EU-Konvent, unter Beteiligung aller EU-Organe und der nationalen
Parlamente, soll in den kommenden zwei Jahren Schlüsselfragen zur künftigen
Entwicklung der Europäischen Union erörtern und beantworten helfen sowie einen
weit gehenden Vorschlag für einen neuen EU-Vertrag bzw. eine mögliche Verfassung
der EU erarbeiten.25 Ziel ist es, die innere und äußere Handlungsfähigkeit
einer sich erweiternden Union in einer globalisierten Welt sicherzustellen und
gleichzeitig auch die demokratische Legitimität und Transparenz der EU zu verbessern.
Die Mitglieder des Verfassungskonvents sollen hierzu bis Sommer 2003 Reformvorschläge
ausarbeiten. Auch die Institutionen der EU stehen dabei auf dem Prüfstand. So
soll etwa das Zusammenwirken und die Zusammensetzung der wichtigsten Gremien,
wie dem Rat als Organ der Regierungen, der Kommission und dem Parlament, neu
geregelt werden. Eine weitere Frage wird sein, wie die Effizienz der Beschlussfassung
in einer künftigen Union von etwa 30 Mitgliedstaaten erhöht werden kann, z.B.
ob mehr Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden können sollten.
Der Konvent will einen intensiven Dialog mit der Zivilgesellschaft suchen, die
über ein Forum eingebunden werden soll.26
Eine
erfolgreiche Reform der Governance im eigenen Haus kann auch mehr Glaubwürdigkeit
und Gehör bei multilateralen Verhandlungen verschaffen. Die innerhalb der EU
verfolgten Ziele Frieden, nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung und soziale Gerechtigkeit
sollten auch jenseits ihrer Grenzen gefördert werden. Regionale Integrationsprojekte,
die sich bislang nur als rein wirtschaftliche Freihandelszonen verstehen (z.B.
NAFTA), sollten auch auf der politischen Ebene ausgebaut werden, um Handlungsspielräume
gegenüber dem Globalisierungsdruck zu erweitern. Schließlich sollte auch die
Kooperation zwischen den Regionen ausgebaut werden. Mit dem Ziel einer verbesserten
Kooperation wurde am 23. Juni 2000 das sog. „Abkommen von Cotonou“ zwischen
der EU und den z.Zt. 77 Ländern der Staatengruppe Afrikas, der Karibik und des
Pazifiks (AKP-Staaten) unterzeichnet. Das neue Kooperationsabkommen setzt auf
die Weiterentwicklung des politischen Dialogs, die Beteiligung der
Zivilgesellschaft, Bekämpfung der Armut, regionale Freihandelsabkommen (statt
der bisherigen Handelspräferenzen und der Exporterlösstabilisierung) sowie die
Reform der finanziellen Zusammenarbeit. Ebenso wichtig ist die Absicht der EU,
die subregionale Integration zu fördern, um die Stellung dieser Gebiete auf
dem Weltmarkt langfristig zu verbessern.
Kritische
Beobachter aus dem Süden27 haben einhellig auf das heute in Folge
des Nord-Süd Machtgefälles fehlende „level playing field“ im internationalen
Handel hingewiesen. Zugleich formulieren sie das Bedürfnis nach einem
– in der Sprache der Handelspolitik – „special and differential treatment“ als
unerlässliche und in den Prinzipien von ITO28 und GATT verankerte
Voraussetzung für die nachholende Industrialisierung der EL. Die Beschränkung
auf je Land und den Einzelfall spezifizierte Ausnahmen im Rahmen der WTO habe
den Aufholprozess gerade von Ländern auf der Schwelle zur Industrialisierung
aufgehalten. Vor diesem Hintergrund haben sich Vertreter des Südens (vgl. Bello
2001) für stärker regionale Governance Strukturen anstelle der zunehmend zentralisierenden
Strukturen von Weltbank, IWF und WTO ausgesprochen.
Empfehlung 10-3 Regionalisierungsanstrengungen
der Entwicklungs länder unterstützen
Die Enquete-Kommission empfiehlt Bundestag
und Bundesregierung im Bereich der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit
mit Entwicklungsländern Strategien zu unterstützen, die auch in anderen Regionen
der Welt Formen der regionalen Kooperation entstehen lassen.
Ein erster Ansatz ist der Stabilitätspakt
Südosteuropa, der auf eine regionale Zusammenarbeit abzielt, bei der internationale
Institutionen nur noch flankierend den Prozess begleiten, die Initiativen letztendlich
aber aus den Ländern der Region selbst entstehen. Im Rahmen des Abkommens von
Cotonou sind politische und wirtschaftliche Partnerschaften zwischen der EU
und AKP-Staaten bzw. deren regionalen Zusammenschlüssen vereinbart worden. Solche
Ansätze zur Bündelung regionaler Kräfte und Interessen sollten auf die regionalen
Bedürfnisse zugeschnitten werden, um Entwicklungsländer dabei zu unterstützen,
stärker als bisher von den Vorteilen der Globalisierung zu profitieren.

19 Vgl. den Bericht der Delegationsreise
der Enquete-Kommission
nach Mexiko 2001.
20 Die EU hat im Vertrag
von Amsterdam (1997, gültig seit 1999) die
Gleichstellung als vorrangiges Ziel fest geschrieben; Art. 2 des Vertrages
lautet: „Aufgabe der Gemeinschaft ist es, durch die Errichtung
eines gemeinsamen Marktes und einer Wirtschafts- und Währungsunion
sowie durch die Durchführung der in den Art. 3 und 4 genannten
gemeinsamen Politiken und Maßnahmen in der ganzen Gemeinschaft
(...) die Gleichstellung von Männern und Frauen (...) zu
fördern”. Art. 3 Abs. 2 des Amsterdamer Vertrages besagt: „Bei
allen
in diesem Artikel genannten Tätigkeiten wirkt die Gemeinschaft
darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von
Männern und Frauen zu fördern.”
21 Vgl. dazu auch Helmut Schmidt
(2000: 248ff.), für den jedoch ein Gelingen
dieser notwendigen Reformschritte noch nicht garantiert ist.
22 „Governance steht für
die Regeln, Verfahren und Verhaltensweisen,
die die Art und Weise, wie auf europäischer Ebene Befugnisse ausgeübt
werden, kennzeichnen, und zwar in Bezug auf Offenheit, Partizipation,
Verantwortlichkeit, Effektivität und Kohärenz“ (Europäische
Kommission 2001f: 11).
23 Entsprechend wird das Weißbuch
derzeit in einem öffentlichen Diskussionsprozess
(bislang über 2 500 beteiligte Organisationen und
Personen) diskutiert (vgl. http://europa.eu.int/comm/governance/
index_en.htm 30. April 2002).
24 Wegweisend ist hier im Umweltbereich
die Aarhus-Konvention, das
UN-ECE Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die
Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang
zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (vgl. http://www.unece.
org/env/pp/documents/cep43e.pdf 10. Mai 2002).>
25 Die „Erklärung über
die Zukunft der Union“ des Europäischen Rats
vom 14./15. Dezember 2001 in Laeken erläutert Inhalt und Verfahren
des Prozesses zur Zukunft Europas. Dieser Prozess soll im Jahr
2004 in eine erneute Regierungskonferenz münden, die durch den
Konvent zur Zukunft Europas vorbereitet wird (für Dokumente und
weitere Informationen vgl. die Internetseite des Konvents http://european-
convention.eu.int/ 10. Mai 2002).
26 Siehe die Internetseite dieses
Forums zum EU-Konvent
(http://www.europa.eu.int/futurum/index_de.htm 10. Mai 2002).
27 Vgl. die Beiträge von
Bello (2001), Bullard (2001), Singh und Dhumale
(1999), siehe auch UNCTAD (2002).
28 Die „International Trade
Organisation“ war in den Nachkriegsjahren
als UN-Sonderorganisation geplant. Die Satzung der ITO, die Havanna
Charta, wurde jedoch 1947 von den USA nicht ratifiziert, da
die Ausnahmen bei den Handelsbestimmungen, wie sie v. a. von den
Entwicklungsländern gefordert wurden, auf Kritik stießen.


|