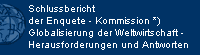11.3.3.4 Korruption und Bestechung
Wir begrüßen, dass dieses Thema als globales Problem identifiziert
und in den Endbericht mit aufgenommen wurde, allerdings greifen sowohl die Ursachenanalyse
wie auch die Empfehlungen zu kurz. Völlig ausgeklammert bleibt bei der Betrachtung
der Korruption die umfangreiche Privatisierungswelle der Vergangenheit, die
ohne ausreichende demokratische Kontrolle und Transparenz als Quelle des massiven
Anstiegs von Korruption und Bestechung gewertet werden kann. Den Nährboden für
Korruption bildet beispielsweise das „Verleasen“ von Fahrzeugpark und Schienenanlage
mit Steuergeschäften über viele Milliarden Euro, die über Offshorezentren abgewickelt
werden oder Public-Privat-Partnership-Modelle, die Garant dafür sein sollten
öffentliche Aufgaben effizienter als „träge, bürokratische“ Verwaltungen zu
erledigen, aber gleichzeitig intransparente Netzwerke herausbilden. Korruption
und Bestechung gedeiht offensichtlich auch dort, wo es im Konkurrenzkampf von
Banken und transnationalen Konzernen bei der Privatisierung um lukrative Bereiche
der öffentlichen Daseinsvorsorge geht.
 Im Endbericht wird gefordert, ein Umfeld zu schaffen, auf dem Korruption nicht
gedeiht. Doch Privatisierungen und Beteiligungen werden in der Analyse der Ursache
und bei den Empfehlungen völlig ausgeblendet. Transparenz wird eingefordert,
aber in den Empfehlungen überwiegen Maßnahmen zur Strafverschärfung bei Korruption.
Wir teilen zwar diese Empfehlungen, halten jedoch die Demokratisierung und mehr
Transparenz für wesentliche Mittel, um der Korruption und Bestechung die Grundlage
zu entziehen. In Ländern, wie z.B. Schweden, die hohe Transparenz und Informationsrechte
gewährleisten, ist der Korruption sehr viel weitergehend die Grundlage entzogen
als bei uns.
Im Endbericht wird gefordert, ein Umfeld zu schaffen, auf dem Korruption nicht
gedeiht. Doch Privatisierungen und Beteiligungen werden in der Analyse der Ursache
und bei den Empfehlungen völlig ausgeblendet. Transparenz wird eingefordert,
aber in den Empfehlungen überwiegen Maßnahmen zur Strafverschärfung bei Korruption.
Wir teilen zwar diese Empfehlungen, halten jedoch die Demokratisierung und mehr
Transparenz für wesentliche Mittel, um der Korruption und Bestechung die Grundlage
zu entziehen. In Ländern, wie z.B. Schweden, die hohe Transparenz und Informationsrechte
gewährleisten, ist der Korruption sehr viel weitergehend die Grundlage entzogen
als bei uns.
Als Vorbild gilt uns in diesem Sinne auch der „Beteiligungshaushalt“
von Porto Alegre, weil dort neben Transparenz und Information, direkte Beteiligung
ermöglicht wurde. Seit 1989 entscheiden dort Bürgerinnen und Bürger der südbrasilianischen
Landeshauptstadt mit über die Verwendung der kommunalen Haushaltsmittel. Jährlich
finden zweiundzwanzig öffentliche Bürgerversammlungen statt, an denen jeder
interessierte Einwohner der Stadt teilnehmen kann und ein Stimmrecht hat. Auf
den Versammlungen werden die Prioritäten für den Haushalt festgelegt sowie Vertreter
der Stadtviertel für den kommunalen Beirat des Beteiligungshaushalts gewählt.
Daneben wird in thematischen Foren seit 1994 über Projekte entschieden, welche
die ganze Stadt betreffen. Die Foren repräsentieren die Kernbereiche der kommunalen
Aufgaben: Transport und Verkehr, Gesundheit, Bildung, Soziales, Wirtschaftsentwicklung,
Stadtentwicklung und Steuern. Selbst die Ansiedlung von Konzernen wird in solchen
Projekten begleitet. Je zwei Vertreter/innen der Foren und der Stadtviertel
werden für ein Jahr in den Haushaltsrat gewählt. Hier wird über die Umsetzung
der Beschlüsse und Vorhaben für das folgende Haushaltsjahr die Rechenschaft
der Stadtverwaltung eingefordert sowie die Richtlinien, die Vergabe der Finanzmittel
und die Einhaltung von Verteilungskriterien für die Haushaltsplanung überwacht.
Jährlich beteiligen sich inzwischen mehr als 100000 Menschen, was rund 15 Prozent
der Wahlberechtigten in Porto Alegre entspricht.
Seit 1999 werden darüber hinaus im brasilianischen Bundesland
Rio Grande de Sul die Prioritäten des Landeshaushalts in einem ähnlichen Verfahren
festgelegt. Einem Bundesland, das größer ist als Westdeutschland. Das partizipative
Verfahren des Beteiligungshaushalts hat inzwischen Nachahmung in mehr als 200
brasilianischen Städten gefunden. Im Jahre 1999 stellten auf einer internationalen
Konferenz Politiker und Wissenschaftler aus u.a. Barcelona, Montreal, Saint
Denis, Stockholm und Toronto ihre unterschiedlichen Praxiserfahrungen mit Beteiligungshaushalten
dar. Das Spektrum reichte von stärkerer Transparenz über Planungszellen, Konsultationsprozesse,
„Runde Tische“ bis hin zur direkten Einflussnahme der Bürgerinnen und Bürger
auf die Haushaltsentscheidungen. Auch einige wenige deutsche Kommunen haben
inzwischen Schritte in diese Richtung unternommen und in einem Netzwerk „Kommunen
der Zukunft“ (auf Initiative der Bertelsmann Stiftung) die Erfahrungen Porto
Alegres der letzten zwölf Jahre aufgegriffen. Bis jetzt gilt Porto Alegres Bürgerhaushalt
als das am weitesten entwickelte Modell direkter Demokratie. Auf der VN-Konferenz
„Habitat II“ im Jahr 1996 wurde Porto Alegre deshalb zur Hauptstadt der Demokratie
erklärt, die Weltbank lobte sie als Modell für nachhaltige Stadtentwicklungspolitik.
Zahlreiche Auswertungen verweisen zudem darauf, dass die Korruption merklich
zurückgegangen sei. Auch die Bürger/innen Porto Alegres teilen diese Sicht.
In einer Umfrage erklärten 98 Prozent der Befragten, dass sie ihre Stadt für
korruptionsfrei halten. Wir meinen, dass die Empfehlungen der Enquete-Kommission
erweitert werden müssen, um einen vergleichbaren Demokratisierungsprozess zu
unterstützen.
Empfehlungen
Wir fordern
Bund, Länder und Gemeinden auf, die Erfahrungen mit Bürgerhaushalten zu evaluieren
und Schritte zur Umsetzung der Bürgerbeteiligung auf zunächst kommunaler Ebene
zu ergreifen: Dabei sollten die Kommunen von Bund und Ländern unterstützt werden.
Die Erfahrungen des Netzwerks „Kommunen der Zukunft“ sind in den Prozess einzubeziehen.
Die von
der Enquete-Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen zur Transparenz in der Auftragsvergabe
müssen auch für Privatisierungs- und Beteiligungsvorhaben gelten. Darüber hinaus
ist ein allgemeines Recht auf Akteneinsicht zu gewähren.
Unternehmen
müssen über Absichtserklärungen hinaus in die Korruptionsbekämpfung durch mehr
Transparenz einbezogen werden. Bei der öffentlichen Auftragsvergabe, Privatisierungs-
und Beteiligungsvorhaben müssen Unternehmen eventuelle Parteispenden sowie Verträge
mit Amtsträgern, die auch ehemalige Amtsträger mit ein schließen, offenlegen.
Diese Angaben sind jährlich fortzuschreiben und zu veröffentlichen.


|