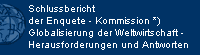4.9.1.3 Der Zusammenhang
von Globalisierung und Informalisierung
Oft
wird informelle Arbeit als vormodern und ohne Verbindung zum zeitgemäßen globalen
Geschehen gesehen. Am Beispiel des Straßen- und Grenzhandels sowie der Subcontracting-Arrangements
lässt sich jedoch beispielhaft nachvollziehen, wie sehr auch informelle Tätigkeiten
mit formeller Arbeit und globalen Produktions- und Distributionsprozessen von
Waren, Leistungen, Kapital und Arbeitskräften verwoben sind. So hat z. B. die
Liberalisierung des Handels direkten Einfluss auf Rahmenbedingungen und Sortimente
der Straßen- und Grenzhändler/-innen. Einerseits fallen angestammte Märkte weg,
anderseits tun sich neue Absatzchancen auf. Die Globalisierung wirkt u.a. in
folgenden Zusammen hängen auf eine Informalisierung von Wirtschaft und Beschäftigung:
Subcontracting-Strategien entlang globaler Wertschöpfungs- und Beschaffungsketten
Die
Globalisierung erweitert die Optionen der Unternehmen in Bezug auf weltweite
Investitionsmög lich keiten in kostengünstige Standorten. Dies gilt besonders
für arbeitsintensive Produktionsschritte, die häufig in hohem Maße nach Geschlechtern
getrennt erfolgen. So arbeiten z. B. vorrangig Frauen in der Elektronik- und
Bekleidungsindustrie. Die Auslagerungsmobilität von arbeitsintensiven Teilen
der Produktion in diesen Branchen wird durch Subcontracting-Strategien entlang
globaler Wertschöpfungs- und Beschaffungsketten verstärkt. Subcontracting bezieht
zunehmend informelle Beschäftigungsformen mit ein und erfolgt dann entweder
in regulärer Heimarbeit, in registrierten „Sweatshops“ oder in freien Exportzonen
(FEZ) (Lenz 2002, Altvater und Mahnkopf 2001)
Informalisierung innerhalb des formellen Sektors
Innerhalb
des formellen Sektors – auch in Industrieländern – zeichnen sich Informalisierungsprozesse
im Zusammenhang mit der Globalisierung ab. Dabei werden bestimmte soziale und
arbeitsrechtliche Schutzregeln, die für formelle Arbeitsverhältnisse gelten,
vermieden oder umgangen. Dies kann z. B. durch untertarifliche Arbeitsverhältnisse
oder überlange Arbeitszeiten erfolgen (Lenz 2002).
Ergänzend
zu diesen direkten Auswirkungen der Globali sierung auf Produktionsprozesse
weisen Altvater und Mahnkopf auf folgende Zusammenhänge hin (s. Abbildung 4-16).
Die Teilnahme am globalen Wettbewerb erfordert die Herstellung
von lokaler (nationaler) Wettbewerbsfähigkeit. Die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
ist in der Regel mit der Anhebung der Produktivität des
 Produktionsfaktors Arbeit verbunden. Daraus ergibt sich aber eine Tendenz der
Freisetzung von Arbeitskräften. Entweder finden die freigesetzten Arbeitskräfte
in einer dynamisch wachsenden Wirtschaft wieder einen Arbeits platz. Das setzt
eine hinreichende Qualifikation aber auch ein gewisses Maß an Mobilität und
Flexibilität voraus. Andernfalls werden sie arbeitslos. Jedoch zeigt sich gerade
in Entwicklungsländern und Schwellenländern, dass im formellen Sektor freigesetzte
Arbeitskräfte im informellen Sektor unterkommen. Dieser dient damit der sozialen
Abfederung der Anpassung an globale Herausforderungen.
Produktionsfaktors Arbeit verbunden. Daraus ergibt sich aber eine Tendenz der
Freisetzung von Arbeitskräften. Entweder finden die freigesetzten Arbeitskräfte
in einer dynamisch wachsenden Wirtschaft wieder einen Arbeits platz. Das setzt
eine hinreichende Qualifikation aber auch ein gewisses Maß an Mobilität und
Flexibilität voraus. Andernfalls werden sie arbeitslos. Jedoch zeigt sich gerade
in Entwicklungsländern und Schwellenländern, dass im formellen Sektor freigesetzte
Arbeitskräfte im informellen Sektor unterkommen. Dieser dient damit der sozialen
Abfederung der Anpassung an globale Herausforderungen.
Die Bewertung des informellen Sektors fällt somit zwiespältig aus.
Einerseits ist der informelle Sektor ein Bereich, in
den die sozialen Kosten im Zuge einer gesteigerten globalen
Konkurrenz externalisiert und in dem teilweise grundlegende
Menschenrechte wie Kernarbeitsnormen unterschritten
werden. Andererseits ist der informelle Sektor auch
eine Art „Schockabsorber“, der die Gesellschaften die
Konsequenzen der Globalisierung weniger stark spüren
läßt und den Menschen Arbeit und Einkommen
sichert (Altvater und Mahnkopf 2001). Einige Beispiele
zu dieser ambivalenten Bewertung werden in Kapitel
4.9.1.4 erläutert.


|