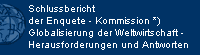4.9.1.5 Exkurs: Schattenwirtschaft als Teilbereich der
informellen Arbeit49
4.9.1.5 Exkurs: Schattenwirtschaft als Teilbereich der
informellen Arbeit49
Als Teilbereich
der informellen Arbeit umfasst Schattenwirtschaft all diejenigen Tätigkeiten,
die im Sinne der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Wertschöpfung darstellen,
aber in den bestehenden amtlichen Statistiken nur zum Teil ausgewiesen werden.
Schattenwirtschaft unterscheidet sich insofern von den Aktivitäten, die als
Summe aller Güter und Dienstleistungen im offiziellen BIP enthalten sind, als
keine Steuern und Sozialversicherungsabgaben bezahlt werden. Ein weiteres Merkmal
der Schattenwirtschaft ist die häufige Verletzung von arbeits- und sozialrechtlichen
Normen (u.a. Überstundenregelung, Arbeitsschutzgesetzgebung) (Schneider 2001,
2001a).
Bei der
Messung von Schattenwirtschaft wird zwischen direkten und indirekten Methoden
unterschieden. Direkte Methoden umfassen Umfragen und Erhebungen. In Deutschland
haben sie in den letzten Jahren deutlich an Relevanz gewonnen, da die Auskunftsverweigerungsquote
zu Schattenwirtschaft bei Haushaltsbefragungen seit 1996/97 nur noch bei ungefähr
0,8 Prozent liegt. Diese Quote lag Ende der 1970er Jahre noch bei über 30 Prozent,
so dass zu diesem Zeitpunkt das Instrument der Direktbefragung kaum aussagefähig
war. Die enorm gestiegene Bereitschaft, über Schattenwirtschaft Auskunft zu
geben, kann als allgemeiner Wertewandel interpretiert werden. Schattenwirtschaft
wird offensichtlich zunehmend als „Kavaliersdelikt“ empfunden, über das bereitwillig
Auskunft gegeben wird.50
 Nach dem Bargeldansatz (vgl. Fußnote 49) haben besonders die südeuropäischen
Länder einen relativ hohen Anteil an Schattenwirtschaft (25–30 Prozent des offiziellen
BIP). Die skandinavischen Länder und Belgien haben Anteile von ca. 17 bis 19
Prozent. Deutschland liegt mit
16 Prozent des BIP im mittleren Feld. Die Länder Schweiz, USA, Japan, Österreich
sind im unteren Drittel vertreten. Der ungewichtete OECD-Durchschnitt liegt
bei 16,7 Prozent in den Jahren 1999/2000 (Schneider 2001, s. Abbildung 4-17).
Nach dem Bargeldansatz (vgl. Fußnote 49) haben besonders die südeuropäischen
Länder einen relativ hohen Anteil an Schattenwirtschaft (25–30 Prozent des offiziellen
BIP). Die skandinavischen Länder und Belgien haben Anteile von ca. 17 bis 19
Prozent. Deutschland liegt mit
16 Prozent des BIP im mittleren Feld. Die Länder Schweiz, USA, Japan, Österreich
sind im unteren Drittel vertreten. Der ungewichtete OECD-Durchschnitt liegt
bei 16,7 Prozent in den Jahren 1999/2000 (Schneider 2001, s. Abbildung 4-17).
Im Gegensatz zu den Ländern Südeuropas, in
denen die Anteile der Schattenwirtschaft auf hohem Niveau in den 90er Jahren
relativ stabil oder leicht rückläufig waren, ist der Anteil der Schattenwirtschaft
von 1989 bis 1999 in Deutschland von 11,8 auf 16 Prozent gestiegen. Jüngste
Schätzungen zeigen, dass die Schattenwirtschaft in Deutschland von 643 Milliarden
DM (2000) auf 658 Milliarden DM (ca. 335 Milliarden Euro) im Jahr 2001 gestiegen
ist. Innerhalb Deutschlands gibt es beim Umfang der Schattenwirtschaft erhebliche
regionale Unterschiede. Mit Abstand weist Berlin West die höchste Zunahme der
Schattenwirtschaft in den Jahren 1995–1999 auf. Im Bundestrend zeichnen sich
noch Niedersachsen und Schleswig Holstein
durch hohe Raten in der Schattenwirtschaft aus (Schneider 2001).
Bezüglich der Daten über Schattenwirtschaft
in Entwicklungs- und Schwellenländern bestehen große Unsicherheiten. Studien
Schneiders (2001, 2001a) zufolge lag 1998/99 die Schattenwirtschaft in ausgewählten
Ländern des asiatischen Raums in Prozent des offiziellen BIP in Bangladesh bei
34,6 %, Indien bei 22,4 %, Malaysia bei 30,7 %, Pakistan bei 35,8 %, den Philippinen
bei 42,4 % und Thailand bei 51,6 %, so dass in vielen Ländern
Asiens, Afrikas und Südamerikas, sowie in ehemaligen Ostblockländern auch von
einer Parallelwirtschaft gesprochen werden kann. Diese Werte steigen in Afrika
bis auf 50 Prozent. Im Durchschnitt liegt der prozentuale Anteil der Schattenwirtschaft
am BIP der 33 afrikanischen Ländern bei circa 26 Prozent. Gleichwohl beträgt
der prozentuale Anteil der in Schattenwirtschaft arbeitenden Personen bezogen
auf alle Erwerbstätige circa 55 Prozent. In Lateinamerika erreicht der Anteil
der Schattenwirtschaft am BIP-Wert von durchschnittlich über 20 Prozent. Auch
hier sind jedoch die Hälfte der Erwerbstätigen in der Schattenwirtschaft tätig.
Auch in den neun ost europäischen Ländern liegt der durchschnittliche Anteil
der Schattenwirtschaft am BIP 1998 bei ca. 24 Prozent. Ähnlich wie in Lateinamerika
sind auch hier 49 Prozent der Erwerbstätigen in der Schattenwirtschaft tätig.
Im Gegensatz
zu Altvater und Mahnkopf (2001) erklärt Schneider die zunehmende Schattenwirtschaft
in OECD-Ländern mit einer steigenden staatlichen Regulierungsintensität und
mit strukturellen Veränderungen des Arbeitsmarktes und des Beschäftigungssystems
(z. B. steigende Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge, Verkürzung der
 Arbeitszeit und/oder steigende Arbeitslosigkeit). Bei einem Preisverhältnis
von Schatten- zu formeller Arbeit von circa 1:4 bis 1:5 können die Steuer- und
Sozialabgaben keineswegs in dem Maße gesenkt werden, wie es theoretisch notwendig
wäre, um den Kostenabstand zwischen formeller Arbeit und Schattenwirtschaft
deutlich zu verkürzen. Vielmehr weist er darauf hin, dass die Ausweitung der
Schattenwirtschaft durch einen nachhaltigen Wertewandel in der Bevölkerung begünstigt
werde. Schneider verneint allerdings, dass die zunehmende Schattenwirtschaft
regulären Betrieben Aufträge im großen Masse entzieht. Vielmehr seien circa
zwei Drittel der Schattenwirtschaft komplementär zur formellen Arbeit, so dass
zusätzliche Wertschöpfung entstünde. Zwei Drittel des schwarzverdienten Geldes
fließen als Konsumnachfrage in die offizielle Wirtschaft zurück. Steuer- und
Sozialversicherungsausfälle können deshalb nicht auf Basis der 335 Milliarden
Euro berechnet werden.
Arbeitszeit und/oder steigende Arbeitslosigkeit). Bei einem Preisverhältnis
von Schatten- zu formeller Arbeit von circa 1:4 bis 1:5 können die Steuer- und
Sozialabgaben keineswegs in dem Maße gesenkt werden, wie es theoretisch notwendig
wäre, um den Kostenabstand zwischen formeller Arbeit und Schattenwirtschaft
deutlich zu verkürzen. Vielmehr weist er darauf hin, dass die Ausweitung der
Schattenwirtschaft durch einen nachhaltigen Wertewandel in der Bevölkerung begünstigt
werde. Schneider verneint allerdings, dass die zunehmende Schattenwirtschaft
regulären Betrieben Aufträge im großen Masse entzieht. Vielmehr seien circa
zwei Drittel der Schattenwirtschaft komplementär zur formellen Arbeit, so dass
zusätzliche Wertschöpfung entstünde. Zwei Drittel des schwarzverdienten Geldes
fließen als Konsumnachfrage in die offizielle Wirtschaft zurück. Steuer- und
Sozialversicherungsausfälle können deshalb nicht auf Basis der 335 Milliarden
Euro berechnet werden.
Dieser
Argumentation folgend ist Schattenwirtschaft ein „hausgemachtes“ Problem. In
Deutschland sei insbesondere durch komplizierte Abschreibungsmodelle und die
Wiedervereinigung, die eher Einkommensstarke begüns tigt hat, ein „Ungerechtigkeitsgefühl“
entstanden. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass die Menschen in diesem
Gefühl indirekt durch die Globalisierung bestärkt werden, wenn mit dem Hinweis
auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit eine Verschiebung der Steuerlast
zu Gunsten der Kapitaleinkommen und zuungunsten der Arbeitnehmer bzw. Konsumenten,
begründet wird. Das „Ungerechtigkeitsgefühl“ schlägt sich in der steigenden
Bereitschaft nieder, Schattenwirtschaft auszuführen oder zu nutzen. Diese Bereitschaft
wird durch die enormen Preis unterschiede zwischen Schattenwirtschaft und Tätigkeiten,
die über den formellen Sektor abgewickelt werden, gefördert (Schneider 2001a,
2001b).

49 Das
Kapitel basiertauf einem Vortrag von Friedrich Schneider am
7.12.02 in Berlin (vgl. auch Schneider 2001, 2001a).
50 Neben
den direkten Umfragen werden zudem indirekte Messverfahren
verwendet, u. a. kann Schattenwirtschaft über den sogenannten
Bargeldansatz oder den Elektrizitätsverbrauch berechnet werden.
Bei diesem monetären Ansatz wird davon ausgegangen, dass schattenwirtschaftliche
Aktivitäten größtenteils in bar abgewickelt werden,
um gegenüber den Steuerbehörden keine Spuren (Rechnungen,
Kontenbewegungen etc.) zu hinterlassen. Man kann also von einem
Normalwert des Bargeldbedarfs ausgehen und immer dann auf schattenwirtschaftliche
Aktivitäten schließen, wenn der Bargeldbedarf
über den Normalpegel steigt. Am Bargeldansatz wird kritisiert, dass
bei dieser Methode ein Referenzwert benötigt wird, bei dem eine Referenzperiode
unterstellt werden muss, in der es keine Schattenwirtschaft
gab. Doch diese lässt sich schwer belegen. Zudem müssten
auch andere Einflüsse als die der schattenwirtschaftlichen Aktivitäten
auf die Veränderungen des Bargeldkoeffizienten ausgeschlossen
werden. Dies ist ebenfalls problematisch, da der Bargeldkoeffizient
mit dem Konjunkturverlauf schwankt und von technischen Entwicklungen
des Zahlungsverkehrs (Kreditkarte etc.) abhängig ist (Altvater
und Mahnkopf 2001).
Ein anderer Versuch der Indizierung der Schattenwirtschaft ist die
Messung des Elektrizitätsverbrauchs. Unter der Annahme, dass die
Elastizität des Elektrizitätsverbrauchs in Bezug auf das Sozialprodukt
nahe bei eins liegt, kann auf schattenwirtschaftliche Aktivitäten
geschlossen werden, wenn der Elektrizitätsverbrauch stärker steigt
als das offizielle BIP. Allerdings wird gegen die Verwendung des
physischen Indikators die gleiche Kritik wie an monetären Indikatoren
erhoben: Die Annahme eines „normalen” Verhältnisses von BIP
und Elektrizitätsverbrauch ist schwer begründbar und obendrein gibt
es technische Entwicklungen, die die Annahme einer konstanten
Elastizität fragwürdig machen. Bestimmte schattenwirtschaftliche
Tätigkeiten in wenig energieintensiven Dienstleistungen werden
möglicherweise gar nicht erfasst. Gleiches gilt für die prekären
Arbeitsverhältnisse
im formellen Sektor (Altvater und Mahnkopf
2001).


|