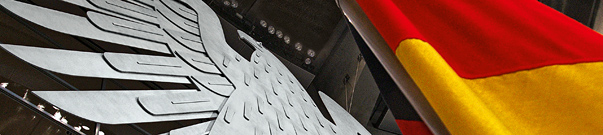Abgang mit Ansage
Friedrich Merz (CDU/CSU)
Er galt als einer der besten Redner und profiliertesten Finanzexperten im Parlament: Friedrich Merz, zwischen 2000 und 2002 Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, war ein Vorbild für all jene, denen damals vieles im Lande zu langsam voran ging. Nach 15 Jahren hat er den Deutschen Bundestag verlassen.
Zurück von einer Fahrradwoche durch Schweden, braun gebrannt und gut gelaunt, konnte sich Friedrich Merz kurz vor den Bundestagswahlen gleich wieder heftig aufregen. Die CDU/CSU-Fraktion wurde 60 Jahre alt. Doch Merz durfte nicht reden. Dabei führte er die Fraktion einst, war von 2000 bis 2002 ihr hoch angesehener Vorsitzender. Man wollte offenbar keine letzte Merz-Rede. Man? „Die Dame”, so wird Bundeskanzlerin Angela Merkel von Merz und seinen Freunden in der CDU genannt. Für ihn ist es keine Frage, wer ihm den Schlussauftritt nicht gegönnt hat. So wird Merz′ eigentliches Ausscheiden aus der Politik immer mit der nasskalten zweiten Februarwoche 2007 verbunden bleiben.
Am 5. Februar, es ist ein Montag, versendet das Bundestagsbüro Merz eine Pressemitteilung. Friedrich Merz werde zur Bundestagswahl 2009 nicht mehr antreten, steht darin. Aus beruflichen Gründen, aber „auch im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Politik der großen Koalition in Berlin und mit dem politischen Kurs der nordrhein-westfälischen Landespartei” habe er so entschieden. Vier Tage nach dieser Pressemitteilung telefonieren Friedrich Merz und Angela Merkel miteinander. Es ist ein freundliches Gespräch, weil sie sich eigentlich nichts mehr zu sagen haben.
Talentierter Aufmüpfer
Viele Rückzüge hatte Merz angekündigt in den Jahren zuvor, oft im Affekt, frisch verletzt; nicht jeden trat er wirklich an. Es hatte ihn stets getroffen, wenn es nach inhaltlicher Kritik am Kurs der CDU immer wieder nur hieß, der Merz-Schmerz bohre wieder in ihm. Er verwinde einfach nicht, dass Merkel als CDU-Vorsitzende ihn nach der verlorenen Bundestagswahl 2002 als Fraktionschef entmachtet habe. Seine Niederlage aber begann lange zuvor. „Talent” nennen ihn die vielen Nachrufer, „Könner” sagt niemand der politischen Zunft. Merz war ein aufrechter Aufmüpfer schon in der Schule, so gescheit und selbstsicher, dass ihm sogar sein Sitzenbleiben nicht den Stolz des Überfliegers stutzte. Der Vater, ein Richter, lehrte ihn Forschheit. Er sollte sagen, was er dachte. 1989 wurde Merz Abgeordneter des Europaparlaments, und weil er der Jüngste in Straßburg und Brüssel war, spielte er eine Sonderrolle. „Friedrich ließ sich nichts bieten”, erinnert sich ein alter Fahrensmann aus Tagen der Jungen Union.
Alles-oder-nichts-Mann
Schon als Jungabgeordneter legte sich Merz mit Kanzler Kohl an. Als der „Alte”, wie sie ihn nannten, Merz dann duzte, was Abgeordnete als „Abrüstungssignal” und Friedensangebot werteten, verbat sich Merz das. Für Kohl war er fortan ein „frecher Lump”, was Merz nicht juckte. Hatte er nicht recht? Merz kämpfte von Anbeginn allein, gestützt nur auf seinen Hochsauerlandkreis und das eigene Selbstbewusstsein.
„Ich habe Friedrich Merz immer als grundloyal erlebt”, lobt Wolfgang Schäuble. Er war CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, als Merz 1994 Abgeordneter wurde. Er übergab Merz die Finanz- und Steuerpolitik, machte ihn zu seinem Stellvertreter an der Fraktionsspitze.
„Er hat ein hohes Maß an Selbstbewusstsein, was auch heißt: Ein Übermaß an Demut hat er nicht”, sagt Schäuble rückblickend. „Er hatte keine Erfahrung mit Niederlagen gemacht bis 2002.” Seine Freunde hatten diese Niederlage „wie eine Lawine” kommen sehen und Merz gewarnt. Im Mai 2002, vier Monate vor der Bundestagswahl, ließ er sich auf einen Handel ein, der nicht gut gehen konnte. Er wollte Fraktionsführer bleiben.
Kanzlerkandidat Edmund Stoiber und CDU-Chefin Merkel vertrösteten ihn auf eine „gemeinsame Entscheidung” am Tag nach der Wahl. Merz vertraute. Und er ging im Gegensatz zu Angela Merkel in Stoibers Schattenkabinett. „Damit hast du dich um den Fraktionssitz gebracht”, sagte Schäuble. Merz hatte sich freiwillig zum Flügelmann gemacht und auf den neoliberalen Außenposten gestellt. Angela Merkel hingegen schwebte darüber im Ungefähren, eine Kunst, die alle mit Führungsanspruch beherrschen. Merz hatte das Verbindende aufgegeben, das ihm als Fraktionschef durchaus gelungen war. Unter seiner Führung haben wirtschafts- und der sozialpolitische Flügel der Unionsfraktion harmonisch zusammengearbeitet. Die Konservativen fühlten sich ihm ohnehin verbunden, seit er eine „deutsche Leitkultur” gefordert hatte. Aber Merz hielt seine marktliberale Positionierung für konsequent und ehrlich. Viele Freunde sagten ihm deutlich, er könne den Fraktionsjob vergessen im Falle einer Wahlniederlage. „Da war Merz wieder Schussfahrer, der Alles-oder-nichts-Mann”, sagt einer von ihnen.
Merz sei kein Stratege, kein Taktierer, niemand, der einen Plan B ausheckt – weil doch Plan A besser sei. Andere erkennen im damaligen Anspruch von Merz auf den Fraktionsvorsitz sein eigentliches politisches Manko: Ihm fehle „protokollarisches Verständnis”. Merz akzeptiere keine Hierarchie, wenn er jene über sich für schwächer hält. Merz sieht das anders. Natürlich habe die Parteivorsitzende den Zugriff auf den Chefposten der Fraktion gehabt. Er habe es nach der Wahl nur bleiben wollen, schon um an möglichen Koalitionsverhandlungen teilzunehmen. Doch Merz gibt zu: „Vielleicht bin ich mehr als andere darauf angewiesen, dass die Chemie stimmen muss in einer Führungsmannschaft.” Merz sei „zu stimmungsgeleitet”, brauche „ein Stück mehr Nehmerqualität”, sagte ausgerechnet Horst Seehofer, der im Bundestag lange Zeit neben Merz saß und von ihm nicht gemocht wurde. Die meisten in der Unionsführung sehen Merz rückblickend so. Merz fühlte sich 2002 zu verletzt, um unter Merkel weiterzuarbeiten. Alle riefen ihn aufgeregt an und zeigten Verständnis für seine Wut. Doch so sei nun einmal die Kommandostruktur in der Truppe, Merkel ist Parteichefin, auch wenn es wehtut. „Fahnenflucht darf es nicht geben”, appellierte sein CDU-Präsidiumskollege, Exgeneral Jörg Schönbohm. Merz blieb, wurde einer von neun stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden.
Sein Freund Roland Koch nennt ihn den „Antitypen eines Schwätzers”, dessen rhetorische Stärke ausschließlich fachlich begründet sei. Merz gehöre zu den brillantesten Analytikern in der Union, der sein Leben lang verwöhnt gewesen sei, stets als „der Beste im Ring” galt. Das habe es ihm so schwer gemacht. Er werde Finanz- oder Wirtschaftsminister im Kabinett Merkel, sagten im Frühjahr 2004 noch viele im Parteipräsidium, obwohl sie über das schlechte Verhältnis ihres Kollegen zur Chefin wussten. Merkel könne gar nicht auf ihn verzichten. Er sei nicht nur der Beste und Verständlichste, er sei auf diesen Feldern der Einzige von Format für die Union. Merz ist einer der besten Redner im Parlament, das sieht auch Angela Merkel so. Nur ein halbes Jahr später, im Oktober 2004, verkündet Merz, er wolle zum Jahresende als Fraktionsvorsitzender aufhören und das CDU-Präsidium verlassen. Merz′ Ankündigung ist eine politische Bombe, die zündet. „Kann ich irgendetwas tun, damit du deinen Entschluss revidierst?”, fragt ihn Merkel. „Nichts”, antwortet Merz knapp.
Die Entscheidung, nicht wieder für den Bundestag kandidieren zu wollen, fällt Merz in aller Ruhe mit seiner Familie vor dem Weihnachtsbaum daheim in Arnsberg. Er wartet mit der Mitteilung sechs Wochen bis zur ersten Sitzung seines Kreisverbands im neuen Jahr 2007. Das politische Ende des Friedrich Merz wird in der „Tagesschau” vermeldet wie der Tod eines Ufa-Stars, von dem man lange nichts mehr gehört hatte. Eine Sensation ist es nicht mehr.
Mister Marktwirtschaft
Merz nimmt noch viele Sitzungen im Bundestag wahr und hegt seinen Hochsauerland-Wahlkreis mit dem Fleiß und der Fürsorge eines Kleingärtners. Nach Ausbruch der Finanzkrise im Herbst 2008 macht er noch Schlagzeilen mit einer Provokation: Er veröffentlicht ein Buch mit dem Titel „Mehr Kapitalismus wagen”.
Merz war Mister Marktwirtschaft, der Held einer Generation Unzufriedener, der alles im Lande zu lahm und zu ängstlich voranging. Kaum eine Karriere in der deutschen Politik war steiler als die des unerschrockenen Aufsteigers. „Mir war Friedrich Merz als ein seltenes Talent aufgefallen in der Fraktion; ein großartiger Redner, blitzgescheit und messerscharf”, erinnert sich Schäuble. Merz schien alles zu haben, was nach ganz oben führt in der Politik: Intelligenz, Unermüdlichkeit, Redegabe, Mut – und auch gehörig Glück: Durch das Erdbeben der Ära Kohl, das auch Schäuble zunächst politisch begrub, wurde Merz Oppositionsführer, tagtäglicher Herausforderer von Bundeskanzler Gerhard Schröder und dessen rot-grüner Koalition. Einer eben, dem die Kanzlerschaft zugetraut wird. Doch Merz ist gescheitert als Politiker. Das gibt er achselzuckend selbst zu. „In vielem, was ich für falsch hielt, war ich nicht bereit, mich anzupassen. Das war sicher nicht einfach”, sagt Merz. „Aber ich habe es nie gelernt, unverbindlich zu formulieren. Es tut mir leid – das kann ich nicht.” Nun ist Merz längst ein Verblichener der Politik, obwohl er erst 54 Jahre alt ist. Bereut hat er es nicht: Er sei „heilfroh”, sagt Merz heute, „den Schnitt gemacht und den Schritt gewagt zu haben” in sein neues Leben außerhalb der Politik.
Text: Wulf Schmiese
Erschienen am 17. Dezember
2009
Zur Person:
Friedrich Merz, geboren 1955, zog seit 1994 stets als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Hochsauerland in den Bundestag. Er war von 2000 bis 2002 Vorsitzender und von 1998 bis 2000 sowie von 2002 bis 2004 stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Der Jurist gilt als einer der profiliertesten Wirtschafts- und Finanzexperten seiner Partei. Große Aufmerksamkeit erhielt er 2003 für seinen Vorschlag einer radikal vereinfachten Einkommenssteuer („Bierdeckelsteuer”). Seit Juni 2009 ist Merz Vorsitzender des Vereins „Atlantikbrücke”.

Aktuelle Ausgabe
Die aktuelle Ausgabe von BLICKPUNKT BUNDESTAG können Sie hier als PDF-Datei öffnen oder herunterladen.
Mitmischen
Mitmischen.de ist das Jugendforum des Deutschen Bundestages im Internet mit Chats, Diskussionsforen, Abstimmungen, Nachrichten und Hintergrund-
berichten.
Europa
Europa ist überall — Europäische Gesetze regeln den Alltag, Euro-Münzen klimpern im Portemonnaie. Aber was bedeutet es eigentlich, zu Europa zu gehören? GLASKLAR hat sich in Europa umgesehen.