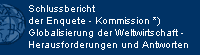2.4.1.1 Die Multilaterale
und die unilaterale Währungsunion
Bei der Bildung einer Währungsunion sind
Unterscheidungen zu treffen: Die volle und multilaterale
Integration zu Währungsblöcken beseitigt nicht nur
die Transaktionskosten beim Devisenhandel, sondern es entfallen
auch die Wechselkursrisiken und mit ihnen die kurzfristige
Arbitrage. Jeder Anreiz zur Währungsspekulation wird
beseitigt. Die unilaterale Integration hingegen bedeutet die
Bindung zumeist „kleinerer“ und schwächerer
Währungen an eine „starke“ Ankerwährung.
Die Europäische
Währungsunion
In Europa ist
1999 mit der Einführung des Euro eine multilaterale
Währungsunion entstanden, ihre weitere Ausgestaltung ist
im Flusse. Die heutige Europäische Währungsunion (EWU)
bildet damit den vorläufigen Abschluss von Versuchen,
innerhalb (zunächst West-)Europas einen einheitlichen
Währungsraum zu etablieren, der von einer politischen
Integration durch die Europäische Union (EU) flankiert
wird.
Schon 1970
begannen mit dem damals von der Europäischen Gemeinschaft (EG)
vorgelegten Plan zur Verwirklichung einer europäischen
Wirtschafts- und Währungsunion (WWU,
„Werner-Plan“) erste Anläufe für eine
multilaterale Währungsunion. Im Geiste keynesianischer
Wirtschaftssteuerung war die WWU des Werner-Plans von dem Ziel
geprägt, Ungleichheiten der wirtschaftlichen Entwicklung in
Europa durch eine integrierte und aktive europäische
Wirtschaftspolitik entgegenzuwirken und Wechselkursänderungen
auf Dauer zu überwinden. Dazu sollten u. a. Konjunktur-,
Währungs-, Haushalts- und Strukturpolitik auf
europäischer Ebene harmonisiert werden. Ohne eine solche
Integration, so wurde damals konstatiert, sei „die Gefahr der
Entstehung von Ungleichgewichten weiterhin gegeben“
(Werner-Plan, zitiert nach Pfetsch 1997: 188).
Der sehr
ambitionierte und letztlich gescheiterte Werner Plan war eine
Antwort auf die sich schon im Verlauf der 60er Jahre abzeichnende
Aushöhlung des Fixkurssystems von Bretton Woods. Nach dessen
Zusammenbruch 1973 bildeten sich – entgegen so manchen
Erwartungen – auch nach einer Suchphase auf den Märkten
keine marktstabile Kursrelationen heraus. Es kam vielmehr zu
häufig korrigierten Wechselkursverwerfungen, die mit den stark
anwachsenden Kapitalströmen in den 70er und 80er Jahren den
europäischen Binnenmarkt und die politische Integration zu
gefährden drohten.
Doch ein
europäischer Binnenmarkt erfordert beides: sowohl den freien
Kapitalverkehr zwischen den Mitgliedsländern als auch stabile
Wechselkurse. Diese waren aber nur zu erreichen, indem die
Mitgliedsstaaten ihre eigenständige nationale
Währungspolitik aufgaben, da bekanntlich nicht zugleich
Offenheit der Ökonomie (also freier Kapitalverkehr), stabile
Kurse und eigenständige Währungspolitik aufrecht erhalten
werden können. Nach verschiedenen Phasen der
währungspolitischen Kooperation (Europäische
Währungsschlange nach dem Ende des Bretton Woods-Systems 1973,
Europäisches Währungssystem (EWS) ab 1979) war deshalb
die Schaffung einer gemeinsamen Währungsinstitution
(Europäische Zentralbank – EZB) mit einer einheitlichen
Gemeinschaftswährung eine klare Antwort auf diese
Herausforderungen der Globalisierung.
So lässt
sich z. B. als Erfolg verbuchen, dass sich die Anfälligkeit
des Euro-Raums gegenüber Krisen der globa  len (Finanz-)Märkte
reduziert hat. Zwar gehen Krisen auch heute nicht spurlos an der EU
vorbei und der Euro darf nicht als Instrument missverstanden
werden, mit dem man sich in einer „Festung Europa“
gegenüber den Problemen anderer Regionen abschotten
könnte. Ohne die strukturellen Verbesserungen, die auf dem
Wege der schrittweisen Einführung der
Gemeinschaftswährung seit Mitte der 90er Jahre erreicht
wurden, wäre die europäische Wirtschaft jedoch
stärker von den Währungskrisen des vergangenen Jahrzehnts
in Mitleidenschaft gezogen worden. len (Finanz-)Märkte
reduziert hat. Zwar gehen Krisen auch heute nicht spurlos an der EU
vorbei und der Euro darf nicht als Instrument missverstanden
werden, mit dem man sich in einer „Festung Europa“
gegenüber den Problemen anderer Regionen abschotten
könnte. Ohne die strukturellen Verbesserungen, die auf dem
Wege der schrittweisen Einführung der
Gemeinschaftswährung seit Mitte der 90er Jahre erreicht
wurden, wäre die europäische Wirtschaft jedoch
stärker von den Währungskrisen des vergangenen Jahrzehnts
in Mitleidenschaft gezogen worden.
Auch in seiner Wirkung nach innen gibt es
positive Anzeichen. So wurden mit dem Übergang zum Euro
Transaktionskosten gesenkt und Wechselkursrisiken beseitigt.
Spätestens seit der Euro-Bargeldeinführung am 1. Januar
2002 steigt die Preistransparenz und damit die Vergleichbarkeit von
Angeboten in der Eurozone. Dies belebt den innergemeinschaftlichen
Handel und stärkt die internationale Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Industrie. Durch die Einführung des Euro
wurden (grenzüberschreitende) Investitionen und
Handelsbeziehungen erleichtert.
Die öffentliche Diskussion um die Rolle
des Euro im internationalen Finanzsystem wurde seit seiner
Einführung vor allem vom schwachen Wechselkurs des Euro
gegenüber dem US-Dollar geprägt. Dabei wurden andere, aus
finanzsystematischer Sicht mindestens ebenso wichtige Aspekte
vernachlässigt. Zum einen stellt der Euro als Symbol der
europäischen Währungsunion die Überwindung eines
segmentierten Währungsraums in (West-)Europa dar. Mit der
Einführung des Euro gehören nunmehr spekulative Attacken
auf einzelne Währungen, wie sie in der ersten Hälfte der
neunziger Jahre auf das Europäische Währungssystem
unternommen wurden, zur Vergangenheit. Es besteht die Hoffnung,
dass die damit erreichten Vorteile an wirtschaftlicher
Stabilität den unvermeidlichen Nachteil der damit gleichzeitig
abgeschafften Spielräume für nationale Geld- und
Fiskalpolitik in Europa überwiegen.
Die Rolle des Euro im internationalen
Finanzsystem verdient aber noch in anderer Hinsicht verstärkte
Aufmerksamkeit. Mit dem Euro wird die Hoffnung verbunden, dass er
als Konkurrent des US-Dollar die Bedeutung Europas in der
internationalen Finanzpolitik gegenüber den USA heben
könnte. Der US-Dollar ist zwar faktische Leitwährung und
sollte in dieser Funktion als stabiler Bezugspunkt für andere
Währungen dienen. Doch ist der US-Dollar aufgrund der
unilateralen Geld-, Finanz- und Währungspolitik der USA und
der hohen Volatilität von Kapitalströmen keineswegs gegen
Kursschwankungen, auch nicht gegenüber einer Abwertung
gesichert. Der (US-)Dollar ist paradoxerweise eher zu einer Quelle
von Instabilität geworden, wie auch im „Global Financial
Stability Report“ des IWF (2002) angedeutet wird. Ein
wichtiges Problem des heutigen Weltfinanzmarkts ist daher nicht nur
die Schwäche seines ordnungspolitischen Rahmens, sondern auch
die unilaterale Dominanz des US-Dollar.
Mit dem Euro
steht eine neue internationale Reservewährung zur
Verfügung, die Zentral- und Geschäftsbanken sowie
Unternehmen eine Alternative zum US-Dollar bietet, die vorher nur
zum Teil durch die Deutsche Mark, den Französischen Franc und
den Niederländischen Gulden30 geboten werden konnte. Mit dem Euro hat
sich nun eine Möglichkeit aufgetan, dass es neben dem
US-Dollar eine weitere zentrale internationale Handelswährung
gibt, in der internationale Kontrakte denominiert und Anleihen
begeben werden. Er ist daher für Kapitalanleger eine
realistische Alternative zum US-Dollar.
 Eine deutlichere Wirkung nach
außen setzt allerdings voraus, dass Europa mit einer Stimme
spricht. Viele erhoffen sich von der einheitlichen
europäischen Währung eine Stärkung der politischen
Integrationsdynamik nach innen und des Gewichts nach außen,
sowohl in weltpolitischen Arenen als auch auf globalen
Märkten. Zu dieser Entwicklung kann der Euro sicherlich einen
Beitrag leisten. Ein politisch und sozial besser integriertes
Europa hätte zweifellos höhere Chancen, auf
internationaler Ebene Entscheidungen mitzugestalten. Eine deutlichere Wirkung nach
außen setzt allerdings voraus, dass Europa mit einer Stimme
spricht. Viele erhoffen sich von der einheitlichen
europäischen Währung eine Stärkung der politischen
Integrationsdynamik nach innen und des Gewichts nach außen,
sowohl in weltpolitischen Arenen als auch auf globalen
Märkten. Zu dieser Entwicklung kann der Euro sicherlich einen
Beitrag leisten. Ein politisch und sozial besser integriertes
Europa hätte zweifellos höhere Chancen, auf
internationaler Ebene Entscheidungen mitzugestalten.
Die mit der Einführung des Euro
verbundenen fiskalischen Richtwerte für die Fiskalpolitik
(„Konvergenzkriterien von Maastricht“) haben bisher
aber auch den Eindruck erweckt, dass der Euro einer aktiven
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik eher entgegensteht. In
Teilen der Öffentlichkeit wird der Euro daher eher als Zwang
zur Haushaltssanierung und weiteren Privatisierung bisher
öffentlicher Aufgaben (Soziale Sicherung, öffentliche
Daseinsfürsorge etc.) wahrgenommen. Neben seinen Verdiensten
bei der Überwindung von Wechselkursschwankungen bekommt der
Euro durch die Konvergenzkriterien auch den Ruf eines sozial und
regional polarisierenden Faktors.
Die Wahrnehmung des Euro als Synonym für
den Sparzwang in öffentlichen Haushalten kann nur dadurch
korrigiert werden, dass die europäische Tradition des auf
sozialen Ausgleich und Inklusion gerichteten Wohlfahrtsstaats als
zentrales Element der europäischen Integration betont wird.
Dies wird aber nur gelingen,
indem neben der wirtschaftlichen Integration die Entwicklung
einer handlungsfähigen und sozial orientierten politischen
Union in Eu ropa stärker vorangetrieben
wird, die auch aktive Wachstums- und Beschäftigungspolitik zur
Leitlinie erhebt. In Fragen der Beschäftigungspolitik gibt es
europäische Ansätze, die aufgegriffen und
weiterentwickelt werden sollen. So wurde im Amsterdamer Vertrag ein
Beschäftigungskapitel aufgenommen, auf dessen Grundlage in der
Folge drei Säulen der europäischen
Beschäftigungspolitik entwickelt wurden:
– „Luxemburger
Prozess“ (Benchmarking im Bereich der
Arbeitsmarktpolitik),
– „Cardiff
Prozess“ (Beseitigung von Hemmnissen auf den Arbeits-,
Kapital- und Gütermärkten),
– „Kölner
Prozess“ (makroökonomischer Dialog).
Gerade der makroökonomische Dialog des
„Kölner Prozesses“ könnte die Chance bieten,
eine Verknüpfung von Wirtschafts- und
Beschäftigungspolitik voranzutreiben. Allerdings wird eine
aktive Arbeitsmarktpolitik, deren Relevanz angesichts der hohen
strukturellen Arbeitslosigkeit unbestritten ist, nur möglich
sein, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) auch den Auftrag
erhält, mit den ihr möglichen währungs- und
geldpolitischen Instrumenten Wachstums- und
Beschäftigungspolitik stärker als heute zu
unterstützen. Statt dessen hat die EZB in den ersten drei
Jahren ihres Bestehens eine außerordentlich restriktive
Geldpolitik betrieben. Dies hat das Wirtschaftswachstum im Euroraum
gebremst und zum Anhalten der hohen Arbeitslosigkeit beigetragen.
Die Politik und Konstruktion der EZB sind daher unter verschiedenen
Gesichtspunkten zu kritisieren und bedürfen der Korrektur:
Erstens
ist die durch die Europäische Zentralbank gesetzte Obergrenze
von zwei Prozent für die hinnehmbare Inflation so niedrig wie
bei keiner anderen großen Zentralbank der Welt. Sie bewirkt,
dass die EZB zu früh restriktive Maßnahmen ergreift und
damit konjunkturelle Erholungsphasen verzögert oder verhindert
und das Wachstum insgesamt bremst. Problematisch ist auch, dass die
EZB nicht verpflichtet ist, das niedrige Inflationsziel einer
unabhängigen wissenschaftlichen Überprüfung
auszusetzen oder in öffentlicher Diskussion zu verteidigen und
gegebenenfalls zu revidieren.
Zweitens ist die
ausdrückliche Weigerung der EZB nicht akzeptabel, sich mit den
anderen wirtschaftspolitischen Akteuren hinsichtlich eines für
 Wachstum und
Beschäftigung optimalen Policy-Mix unter Berücksichtigung
der währungs- und geldpolitischen Leitlinien abzustimmen. Dies
widerspricht sogar ihrer im EU-Vertrag festgelegten Verpflichtung,
die allgemeine Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft zu
unterstützen, „soweit dies ohne Beeinträchtigung
des Zieles der Preisstabilität möglich ist“ (Art.
105, Ab s. 1, EUV). Wachstum und
Beschäftigung optimalen Policy-Mix unter Berücksichtigung
der währungs- und geldpolitischen Leitlinien abzustimmen. Dies
widerspricht sogar ihrer im EU-Vertrag festgelegten Verpflichtung,
die allgemeine Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft zu
unterstützen, „soweit dies ohne Beeinträchtigung
des Zieles der Preisstabilität möglich ist“ (Art.
105, Ab s. 1, EUV).
Drittens ist es
im Prinzip problematisch, der Zentralbank jegliche Verantwortung
für Beschäftigung und Wachstum abzunehmen und sie
ausschließlich auf das Ziel der Preisstabilität zu
verpflichten. Denn die verschiedenen wirtschaftspolitischen Ziele
stehen in einem engen Zusammenhang (dies wird beispielsweise im
deutschen „Stabilitäts- und Wachstumsgesetz“ von
1966 ausdrücklich anerkannt) und können nicht
unabhängig voneinander verfolgt und erst recht nicht erreicht
werden. Da von keiner Seite – auch von der EZB nicht –
bestritten wird, dass Geldpolitik erhebliche Wirkungen auf die
Beschäftigung, die Einkommen und den Wohlstand hat, muss
dieser Einfluss auch bei den Diskussionen und Entscheidungen der
für die Geldpolitik verantwortlichen Organe
berücksichtigt werden. Die Zentralbank sollte, wie es auch bei
der amerikanischen und englischen Zentralbank der Fall ist, eine
wesentliche Mitverantwortung für die wirtschaftliche und
soziale Gesamtentwicklung in der EU übernehmen und dazu in die
wirtschaftspolitische Koordination eingebunden werden.
Viertens spielt die
Fähigkeit von Zentralbanken, kurzfristig in Schieflage
geratenen Banken Liquidität zur Verfügung zu stellen, um
eine Sys temkrise abzuwenden (sog. Lender of Last Resort),
eine sehr wichtige Rolle für die Funktionsfähigkeit eines
Finanzsystems. Das Fehlen einer Bestimmung über die Aufgabe
der EZB als „Lender of Last Resort“ im Falle einer
Finanzkrise mit akuten Liquiditätsproblemen stellt daher eine
Lücke im Regelwerk der Europäischen Währungsunion
dar, die sich im Notfall als verhängnisvolles Hindernis bei
der Überwindung einer solchen Krise erweisen könnte.
Dieser Mangel wird derzeit noch dadurch überdeckt, dass die
nationalen Zentralbanken zwar viele Funktionen an die EZB
abgetreten haben, jedoch im extremen Fall einer finanziellen
Notlage die Funktion des Lenders of Last Resort wahrnehmen
können. Wenn freilich ein integrierter europäischer
Kapitalmarkt hergestellt sein wird, wäre die Rolle der EZB in
dieser Hinsicht zu stärken.
Dieses Defizit wird u. a. auch vom IWF moniert (Prati, Schinasi
2000). Die verheerenden Folgen der Weltwirtschaftskrise 1929 sind
das historische Beispiel dafür, wie sehr das Fehlen eines
„Lender of Last Resort“ von einer Finanzkrise in eine
soziale und politische Kata strophe führen
kann.
So wie das „Weißbuch“ der
Kommission der EU zu „Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit,
Beschäftigung“ von 1993 dezidiert den in Maastricht
beschlossenen rein monetären Konvergenzkriterien soziale,
ökologische und beschäftigungspolitische Ziele an die
Seite gestellt hat, wäre aus Gründen der
Glaubwürdigkeit des europäischen Integrationsprojekts
daran unbedingt festzuhalten, dass der Euro dem Ziel eines sozialen
Europas verpflichtet ist. Dass ein sozialstaatliches Bekenntnis
zudem nicht nur eine ethische Kategorie, sondern ein durchaus dem
europäischen Modell zugehöriger Wirtschaftsfaktor ist,
darf dabei nicht übersehen werden. Das mit betrieblicher
Mitbestimmung, Tarifautonomie und „sozialem Frieden“
umschriebene Modell gesellschaftlicher Teilhabe spiegelt sich
gerade in den nach wie vor international wettbewerbsfähigen
Lohnstückkosten in Europa wieder. Ohne diese Teilhabe drohen
zukünftige Produktivitätsfortschritte und die
Innovationsfähigkeit erheblich zu leiden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, das
sich die EWU und Europa insgesamt in der Zielvorstellung vom
angelsächsisch-atlantischen Kapitalismusmodell unterscheiden.
Um den politischen Konsens und die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit zu erhalten und zu verbessern, sollte die
EU gerade im Hinblick auf die Finanzmärkte zu einem
kooperativen, demokratischen und sozialen Akteur bei der aktiven
Gestaltung der Globalisierung werden.
Die unilaterale Währungsunion
durch „Dollarisierung“
In Lateinamerika haben einige Länder
entweder die nationale Währung zu Gunsten der Einführung
des US-Dollar aufgegeben (Panama, Ecuador, Guatemala, El Salvador)
oder die nationale Währung fest (über ein „Currency
Board“) an den US-Dollar gebunden (Argentinien bis Ende
2001). Dieser Prozess der unilateralen Integration in den
US-amerikanischen-Währungsraum wird als volle bzw. (im Fall
des Currency Board) unvollständige
„Dollarisierung“ bezeichnet. Länder, die diesen
Schritt unternehmen, geben dadurch ihre geld- und
währungspolitische Souveränität weitgehend (bei
fixer Dollarbindung) bis vollständig (wenn der US-Dollar als
nationale Währung übernommen wird) auf. Der Schritt
zurück ist schwierig, zumal dann, wenn die Dollarisierung
vorgenommen wurde, um gegenüber externen Kreditgebern um
Vertrauen in die Wertstabilität der Schulden des jeweiligen
Landes zu werben.
Eine Abkehr von der Bindung an den US-Dollar
würde mit Sicherheit eine Abwertung der bislang fixierten
Währung auslösen und daher eine Steigerung externer
Schulden bewirken. Etwas anderes als die gesetzliche Bindung ist
die faktische Rolle des US-Dollar in vielen Ländern: In
nahezu allen lateinamerikanischen Ländern (selbst auf Kuba)
gilt der US-Dollar als die Währung, in der größere
Kontrakte abgewickelt werden (z. B. Immobiliengeschäfte) oder
die zur Vermögenshaltung Verwendung findet.  Das war mit der D-Mark bzw.
ist mit dem Euro in einigen süd ost- und
osteuropäischen Ländern nicht anders. Das war mit der D-Mark bzw.
ist mit dem Euro in einigen süd ost- und
osteuropäischen Ländern nicht anders.
Bei der unilateralen Währungsintegration
gibt es eine Fülle von Problemen für alle Beteiligten,
wobei die der USA bzw. der EU (im Falle einer
„Euroisierung“) noch die geringsten wären. So
lange nur vergleichsweise kleine Länder ihre Währung
„dollarisieren“bzw. „euroisieren“, ist der
Effekt auf die Geldmenge und den Wechselkurs der
Starkwährungsländer zu vernachlässigen. Die
dollarisierten bzw. „euroisierten“ Länder hingegen
verlieren ihre geld- und währungspolitische
Souveränität vollkommen – mit gravierenden
Konsequenzen für andere Bereiche der Wirtschaftspolitik (von
der Fiskalpolitik bis zur Arbeitsmarktpolitik). Auch stellen sich
Fragen nach der Aufteilung von
Seignorage-Gewinnen im größeren Währungsraum,
sowie die ganz grundsätzliche Frage nach der
Rücksichtnahme der Zentralbankpolitik (der FED, der EZB) auf
die ökonomische Lage in den dollarisierten (bzw. euroisierten)
Ländern.
Die Erfahrungen sind noch zu kurz, als dass
stringente Antworten gegeben werden könnten. Historische
Untersuchungen zeigen jedoch, dass die unilaterale Übernahme
einer starken Währung dann positive Wirkungen hat, wenn auf
diese Weise der Handel zwischen natürlichen Handels
partnern intensiviert wird. Doch sind Ecuador oder Argentinien und
die USA „natürliche Handelspartner“?
 Es wäre auf jeden Fall
von Nutzen, die Lehren der deutsch-deutschen Währungsunion von
1990 in die internationale Debatte um die Dollarisierung
einzubringen. Die hohen Produktivitätsunterschiede in einem
Wäh rungsraum können nur durch entsprechende
Lohn dif ferenziale wett gemacht werden – oder
die Wettbewerbsfähigkeit geht verloren. Zum Ausgleich der
Einkommensunterschiede werden hohe Transferleistungen in das
weniger produktive Land notwendig. Eine enge Bindung an eine starke
Währung kann zwar für Anleger attraktiv sein, kann aber
für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes fatale Folgen
zeigen (wenn es nicht, wie im deutschen Fall, zu anhaltend hohen
Transferzahlungen kommt). Es wäre auf jeden Fall
von Nutzen, die Lehren der deutsch-deutschen Währungsunion von
1990 in die internationale Debatte um die Dollarisierung
einzubringen. Die hohen Produktivitätsunterschiede in einem
Wäh rungsraum können nur durch entsprechende
Lohn dif ferenziale wett gemacht werden – oder
die Wettbewerbsfähigkeit geht verloren. Zum Ausgleich der
Einkommensunterschiede werden hohe Transferleistungen in das
weniger produktive Land notwendig. Eine enge Bindung an eine starke
Währung kann zwar für Anleger attraktiv sein, kann aber
für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes fatale Folgen
zeigen (wenn es nicht, wie im deutschen Fall, zu anhaltend hohen
Transferzahlungen kommt).
Daher ist die
Enquete-Kommission der Auffassung, dass die Dollarisierung viele
Gefahren für die jeweiligen Länder mit sich bringt, vor
allem einen Verlust der wirtschafts- und geldpolitischen
Souveränität, ohne sicher sein zu können, dass die
geldpolitischen Instanzen des jeweiligen Hart- und
Leitwährungslandes auf die Belange eines
„dollarisierten“ Landes Rücksicht nehmen.
Besonders nachteilig ist der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit,
wenn durch einen hohen Dollarkurs Exporte erschwert und Importe
erleichtert werden. Dies hat über kurz oder lang eine
defizitäre Leistungsbilanz zur Folge, die nur durch
Kapitalimport, also externe Verschuldung finanziert werden
kann.
Die in
Argentinien 2001 und 2002 gemachten Erfahrungen bestätigen die
grundsätzlichen Bedenken gegen eine Dollarisierung. Die harte
Dollarbindung des Peso (über ein „Currency Board“,
das die Peso-Geldmenge an die Dollar-Deviseneinnahmen bindet) hat
zu einer den ökonomischen Verhältnissen Argentiniens
nicht entsprechenden Aufwertung geführt und dazu beigetragen,
dass die Handelsbilanz hoch defizitär (insbesondere im Handel
mit dem wichtigsten Partner des Mercosur, mit Brasilien) geworden
ist. Kapitalimporte konnten das Leistungsbilanzdefizit trotz hoher
Renditen argentinischer Papiere nicht kompensieren.
Als dann
offizielle Kredite der Bretton Woods-Institutionen verweigert
wurden, schrumpfte (wegen des Currency Board) die umlaufende
Geldmenge in einem Ausmaß, dass die Bevölkerung oftmals
gezwungen war, (Internet-basierte) geldlose Tauschringe zu
entwickeln und dass Ersatzwährungen geschaffen wurden.
Schließlich musste am Jahresende 2001 die Dollarbindung mit
Hilfe des Currency Board aufgegeben werden. Die
Währungsabwertung konnte zunächst in Grenzen gehalten
werden, doch hat sich aus der Währungskrise eine Finanzkrise,
eine Bankenkrise, eine Wirtschaftskrise und schließlich eine
schwere politische Krise entwickelt. Die Parallelwährungen
erschweren eine Kontrolle der Geldmenge seitens der geldpolitischen
Instanzen, so dass Argentinien nicht in der Lage ist, die
Konditionalität für internationale Kredite zu
erfüllen.
Anders als die
Dollarisierung sind pluri- oder multilaterale regionale
Währungssysteme zu bewerten. Innerhalb eines regionalen
Währungssystems – wie es in der Gestalt des EWS von 1979
bis 1999 bestand – verpflichten sich die beteiligten
Zentralbanken, die Schwankungen ihrer Währungen in bestimmten
Bandbreiten (im Falle des EWS zunächst +/– 2,25 Prozent;
später bis zu +/– 15 Prozent) zu halten und zu diesem
Zwecke notfalls auf den Devisenmärkten zu intervenieren. Der
Versuch, noch vor Ausbruch der Asienkrise 1997 einen
„Asiatischen Währungsfonds“ zu etablieren, der zu
einem regionalen Währungssystem hätte weiter entwickelt
werden können, ist allerdings gescheitert. Ein regionales
Währungssystem wird nur so lange stabil bleiben, wie die
beteiligten Regierungen und Zentralbanken zu einem Mindestmaß
an Koordination der Geld-, Währungs- und Finanzpolitik bereit
und in der Lage sind.

30 Dies sind die drei Euro-Währungen, in denen
Währungsreserven gehalten wurden (IWF 2001: 103).


|