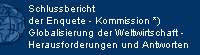10.2.2.2 Völkerrechtliche
Grundlagen einer
Global Governance
Die Verrechtlichung der
internationalen Beziehungen hat sich seit 1945 beschleunigt und
muss auch künftig gefördert werden; die Gestaltung dieses
Prozesses hat auf der Grundlage des Völkerrechts zu geschehen.
Diese Beurteilung ist nicht selbstverständlich, denn in der
Praxis sind auch Unkenntnis und Nichtbeachtung des
Völkerrechts sowie Verstöße dagegen zu beklagen
(Paech 2001, Dicke 2001). Einerseits wird der weitaus
größte Teil der rapide anwachsenden Zahl von
Regelungsvorgaben, die internationale Organisationen ausarbeiten,
von den Staaten akzeptiert. Die rechtliche Umsetzung und materielle
Durchsetzung lässt gleichwohl oft zu wünschen übrig.
Zudem gibt es wichtige internationale Abkommen, deren Ratifikation
von wichtigen Staaten verweigert wird (vgl. etwa die
Akzeptanzprobleme mit Blick auf den Internationalen
Strafgerichtshofs), oder es werden völkerrechtlich
ratifizierte Abkommen gekündigt oder gebrochen.
Uneinigkeit besteht betreffend der
Form der anzustrebenden Verrechtlichung, wobei die
wesentlichen Positionen einander nicht unüberbrückbar
widerstreiten. Der Dissens bezieht sich auf die Frage, ob
schwerpunktmäßig die Fortbildung des konsensorientierten
zwischenstaatlichen Vertragsrechts oder die Entwicklung des
Völkerrechts zu einem konstitutionalisierten
„Weltinnenrecht“ angestrebt werden sollte. Letzteres
würde eine objektive Rechtsordnung bedeuten, deren Geltung
nicht mehr von der jeweiligen Zustimmung der Staaten abhängt,
sondern vielmehr legislativen Charakter annimmt (Delbrück
1998b; vgl. auch Hauchler 1999). Von den Kritikern wird eingewandt,
 dass in einem solchen
Modell die Eigenart und die Vorzüge des klassischen
Völkerrechts verloren gehen könnten. Vorerst seien daher
regional und sektoral begrenzte Schritte vorzuziehen. Einigkeit
besteht dahingehend, dass sektorale Rechtsregime zum Schutz der
Menschenrechte und öffentlichen Güter als vertragliche
Errichtungen partieller Rechtsordnungen zukunftsweisende Elemente
einer
Global Governance-Struktur sind (vgl. auch Stiftung Entwicklung
und Frieden 2001b).42 dass in einem solchen
Modell die Eigenart und die Vorzüge des klassischen
Völkerrechts verloren gehen könnten. Vorerst seien daher
regional und sektoral begrenzte Schritte vorzuziehen. Einigkeit
besteht dahingehend, dass sektorale Rechtsregime zum Schutz der
Menschenrechte und öffentlichen Güter als vertragliche
Errichtungen partieller Rechtsordnungen zukunftsweisende Elemente
einer
Global Governance-Struktur sind (vgl. auch Stiftung Entwicklung
und Frieden 2001b).42
Der Internationale Strafgerichtshof (ICC) ist
ein Beispiel für ein sektorales Rechtsregime, dessen
Einrichtung auch von Autoren, die eine weitgehende Hierarchisierung
des Völkerrechts ablehnen, begrüßt wird: Der ICC
bedeutet einen substanziellen Schritt in Richtung auf die
Verrechtlichung und Zivilisierung der internationalen Beziehungen;
er wird zudem mit gutem Grund nicht regional
beschränkt, sondern als universell konzipiert, denn die
unabhängige richterliche Kontrolle und Sanktion ist eines der
zentralen Elemente nicht nur des angloamerikanischen
Verständnis der „rule of law“ oder des
kontinental europäischen Konzepts der
Rechtsstaatlichkeit, sondern aller Rechtskulturen.
Von völkerrechtlicher Relevanz für
die Ausgestaltung von Global Governance ist auch das internationale
Über-einkommen zur Beseitigung aller Formen von
Frauendiskriminierung (Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women, CEDAW) von 1979. Es ist das
weitestgehende internationale Rechtsdokument zur Verwirklichung der
Menschenrechte von Frauen und zur Herstellung der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern. CEDAW stellt eine
verbindliche Rechtsgrundlage für alle internationalen
Verhandlungen und Verträge dar. Alle Vertragsstaaten sind
verpflichtet, das Prinzip der Gleichstellung von Frauen und
Männern in allen Bereichen des politischen, wirtschaftlichen
und gesellschaft lichen Lebens fest zuschreiben und die
Umsetzung zu gewährleisten. Im Oktober 1999 beschloss die
Generalversammlung der Vereinten Nationen, CEDAW ein
Fakultativprotokoll zur Seite zu stellen. Das Protokoll ist Ende
Dezember 2000 in Kraft getreten und er öffnet den Weg
der Individualbeschwerde. Einzelne Frauen und Frauengruppen haben
so die Möglichkeit den CEDAW-Ausschuss anzurufen und
Untersuchungen gegen ihre Regierungen wegen anhaltender Verletzung
des Abkommens in Gang zu setzen. Der Ansatz der
Frauen-Menschenrechte hat wesentlich dazu beigetragen, der Norm der
Interdependenz und Unteilbarkeit von politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Menschenrechten internationale Anerkennung zu
verschaffen (vgl. Hamm 1999: 441).
Absolute vs. geteilte
Souveränität
In enger Verbindung mit dem zuvor genannten
Punkt steht der Unwille von Nationalstaaten, Souveränität
abzugeben. Manche Beobachter halten ein sanktionsbewehrtes Recht
mit völkerrechtlicher Geltung gegenüber allen Staaten,
und dessen Durchsetzung gegenüber nationalen Instanzen
für eine grundlegende Voraussetzung einer globalen politischen
Ordnung: Ein nur loses Netz von über 200 Nationalstaaten
könne dagegen keine Handlungsfähigkeit gewinnen, sei kein
geordnetes System globaler Steuerung. Ein erfolgreiches Regieren
auf der globalen Ebene im Sinne einer
Global Governance benötige zumindest ein teilweise
globales Gewaltmonopol.43
Ob jedoch global eine Bereitschaft vorhanden ist, Global Governance
als ein System von Normen und Regeln zu institutionalisieren, das
die prinzipiell vorrangige Souve-ränität von Staaten
ablöst, ist zur Zeit fraglich. Aus Sicht des heutigen
Völkerrechts – ausgehend vom Westfälischen Frieden
– ist die nationale Souveränität Ausgangspunkt und
Grundlage jeglichen Vertragsrechts, Gewohnheitsrechts oder
Allgemeiner Rechtsprinzipien auf der internationalen Ebene. Darauf
beziehen sich nicht nur die USA; vor dem Hintergrund der
Dekolonialisierung halten auch die Staaten der Dritten Welt an
ihrer nationalen Souveränität fest. Auch bei
internationalen Institutionen handelt es sich bislang v.a. um
Kooperation und Koordination von Staaten, internationale
Organisationen haben selbst nur selten Gesetzgebungsgewalt.
So wundert es nicht, dass dieses Thema
Dissens pro- voziert: Die einen betrachten die staatliche
Souveränität als zunehmend obsolet werdendes Element des
Völkerrechts, das zumal häufig als Mittel staatlicher
Macht- und Blockadepolitik missbraucht wird und auch den Schutz
individueller Selbstbestimmung vereitelt. Andere dagegen verstehen
staatliche Souveränität als zumindest in absehbarer
Zukunft unverzichtbaren Bestandteil einer
Global Governance, der vor allem dem Schutz schwacher vor
mächtigen Staaten dient und insofern ein wesentliches Moment
von Demokratie in den internationalen Beziehungen verbürgt.
Aus dieser Sicht ist die Ambivalenz des Völkerrechts kein
vermeidbarer Mangel, sondern sachlich begründet und in jedem
konkreten Fall auszutarieren. Staaten, die außer ihrer
Souveränität wenig in die Waagschale zu werfen haben,
seien (partielle) Souveränitätsverzichte nicht ohne
entsprechende und nachhaltige Kompensation abzuverlangen.
Gleichwohl erkennt auch diese Position an, dass sich das
Verständnis und die Inanspruchnahme von Souveränität
in der Staatenpraxis in einem andauernden und tiefgreifenden Wandel
befindet. Real ist dies bereits in der Europäischen Union zu
beobachten und auch außerhalb Europas sind Formen
„geteilter Souveränität“ in Zukunft denkbar.
Einige gehen sogar so weit, nationale Souveränität heute
zu definieren als „to be in a good standing with the
international community“ (Chayes und Chayes 1998).
Zudem erscheint es sinnvoll, zwischen
interner und externer Souveränität zu unterscheiden
(Reinicke und Witte  1999, Messner 1998b). Hat in früherer Zeit die
Einschränkung der staatlichen Handlungsfreiheit in erster
Linie die externe Souveränität (also das Verhältnis
zu anderen Staaten) betroffen, so besteht die neue Qualität
der Globalisierung darin, dass sich nicht nur die Interdependenzen
und wechselseitigen Verwundbarkeiten zwischen den Staaten
verdichten, sondern auch die interne Sou-veränität der
Regierungen (de facto) in einer zunehmenden Zahl von Politikfeldern
in Frage gestellt wird. Die interne Souveränität bezieht
sich auf das Verhältnis des Staates zu den privaten Akteuren
einer Gesellschaft (Wirtschaft oder Zivilgesellschaft) und die
Überordnung des Staates gegenüber allen anderen Akteuren
innerhalb eines Staatsgebietes. Anknüpfend an Max Weber
impliziert die interne Souveränität des Nationalstaates
dessen Fähigkeit als Souverän, nach innen auf seinem
Territorium alle politischen, sozialen und ökonomischen
Probleme regeln zu können. Genau diese Spielräume der
Regierungen, Politiken zur souveränen Gestaltung der
Gesellschaft und zur Lösung von Problemen innerhalb der
Staatsgrenzen formulieren und umsetzen zu können,
schränkt die Globalisierung ein. Daher kann das
„Pooling“ von externen Souveränitäten eben
auch im Interesse des Nationalstaates sein, wenn auf diese Weise
Probleme, die auch das eigene nationale Territorium betreffen,
besser gelöst werden können und damit auch die interne
Souveränität gestärkt wird. 1999, Messner 1998b). Hat in früherer Zeit die
Einschränkung der staatlichen Handlungsfreiheit in erster
Linie die externe Souveränität (also das Verhältnis
zu anderen Staaten) betroffen, so besteht die neue Qualität
der Globalisierung darin, dass sich nicht nur die Interdependenzen
und wechselseitigen Verwundbarkeiten zwischen den Staaten
verdichten, sondern auch die interne Sou-veränität der
Regierungen (de facto) in einer zunehmenden Zahl von Politikfeldern
in Frage gestellt wird. Die interne Souveränität bezieht
sich auf das Verhältnis des Staates zu den privaten Akteuren
einer Gesellschaft (Wirtschaft oder Zivilgesellschaft) und die
Überordnung des Staates gegenüber allen anderen Akteuren
innerhalb eines Staatsgebietes. Anknüpfend an Max Weber
impliziert die interne Souveränität des Nationalstaates
dessen Fähigkeit als Souverän, nach innen auf seinem
Territorium alle politischen, sozialen und ökonomischen
Probleme regeln zu können. Genau diese Spielräume der
Regierungen, Politiken zur souveränen Gestaltung der
Gesellschaft und zur Lösung von Problemen innerhalb der
Staatsgrenzen formulieren und umsetzen zu können,
schränkt die Globalisierung ein. Daher kann das
„Pooling“ von externen Souveränitäten eben
auch im Interesse des Nationalstaates sein, wenn auf diese Weise
Probleme, die auch das eigene nationale Territorium betreffen,
besser gelöst werden können und damit auch die interne
Souveränität gestärkt wird.
Empfehlung 10-11 Stärkung des
Völkerrechts44
Bundestag und Bundesregierung werden
aufgefordert, überall dort, wo es bereits rechtsverbindliche
völkerrechtliche Normen gibt, mit den zur Verfügung
stehenden politischen und rechtlichen Mitteln auf ihre Um- und
Durchsetzung auf nationaler, europäischer und internationaler
Ebene hinzuwirken. Dies ist die Voraussetzung dafür, durch
rechtsverbindliche und durchsetzbare Normen langfristige und
stabile Garantien für soziale, ökologische und
menschenrechtliche Mindeststandards zu schaffen.
Außerdem sollte sich die
Bundesregierung für die Einführung eines
Fakultativprotokolls zum Internationalen Pakt für
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt)
einsetzen, durch das die Untersuchung und quasi-richterliche
Entscheidung von Individualbeschwerden durch einen
Sachverständigenausschuss ermöglicht werden
soll.

42 Vgl. die in den anderen Kapiteln dieses Berichtes
diskutierten internationalen Verträge (wie z. B. das
Übereinkommen über biologische Vielfalt in 7.3.2 dieses
Berichts).
43 Vgl. Hauchler (1999), der eine Aufteilung des
nationalstaatlichen Gewaltmonopols in funktionelle Teilmonopole auf
die subsidiär gestaffelten Ebenen der nationalen und
internationalen Politik vorschlägt.
44 Vgl. hierzu auch das abweichende Minderheitenvotum
der CDU/CSU-Fraktion in 11.


|