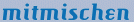Große Debatten im Deutschen Bundestag

Rund 31.000 Reden wurden im vergangenen Jahrzehnt im Plenum des
Deutschen Bundestages gehalten. Einige Debatten waren besonders
kontrovers - wie jene über den Bundeswehreinsatz im Kosovo
oder die Vertrauensabstimmung über die rot-grüne
Bundesregierung 2005. Ein kleiner Streifzug durch die bedeutendsten
Entscheidungen und Dispute der jüngsten Zeit.
1. Juli 2005: Debatte vor der Vertrauensabstimmung
Am Abend des 22. Mai 2005 trat der damalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering in der Berliner Parteizentrale vor die Kameras und verkündete, er und Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hätten beschlossen, im Herbst Neuwahlen durchzuführen, um die Blockade in Bundestag und Bundesrat zu beenden. Die Nachricht löste ein politisches Beben aus.
Überraschung auf allen Seiten
Nicht nur überraschte sie die Opposition, vor allem die
CDU, die gerade ihren Sieg bei der Landtagswahl in
Nordrhein-Westfalen feierte. Auch die Koalitionsparteien, SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, traf die Ankündigung
unvorbereitet. Zwiespältig fielen daher auch die Reaktionen
aus: Während SPD-Führungsmitglieder die Ad-hoc-Entscheidung des Bundeskanzlers als
"richtig" bezeichneten, sahen viele SPD-Mitglieder sie als
"politischen Selbstmord" an. Die Frage, ob Schröder in diesem
Fall überhaupt zum Mittel der Vertrauensfrage greifen
dürfe, um sein Ziel Neuwahlen zu erreichen, führte
schließlich zu einer erregten Diskussion - nicht nur in der
Öffentlichkeit, sondern auch in den Koalitionsparteien selbst.
Eine solche "unechte" Vertrauensfrage, die gezielt eine Niederlage
herbeiführe, sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar,
argumentierten die Abgeordneten Werner Schulz
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Jelena
Hoffmann (SPD). Eine von beiden angestrengte Klage wies
das Bundesverfassungsgericht am 25. August 2005 jedoch als
unbegründet zurück.
Plangemäßer Vertrauensverlust im Plenum
Doch schon am 1. Juli 2005, als Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) um 12:11 Uhr das Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt gab, war klar, dass Schröder sein erstes Ziel erreicht hatte: Die Vertrauensabstimmung im Bundestag war wie beabsichtigt verloren. "Gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes stelle ich den Antrag, mir das Vertrauen auszusprechen", hieß es in der Drucksache 15/5825. 148 Abgeordnete enthielten sich der Stimme, 296 stimmten mit "Nein", 151 aber mit "Ja".
Die rund zweistündige Debatte, die der Abstimmung
vorausging, war ein heftiger Schlagabtausch zwischen Koalition und
Opposition, in der die Redner eine sehr unterschiedliche Bilanz der
vorzeitig endenden Legislatur zogen.
Für klare Verhältnisse: Reformkurs fortsetzen
Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte als
erster Redner noch einmal die Hintergründe für seinen
Plan, Neuwahlen anzustreben, erläutert: Nach den verlorenen
Landtagswahlen sei es für die SPD nötig geworden,
für die Fortsetzung der Reformpolitik eine Legitimation durch
die Bürger zu bekommen. "Es geht um die Frage, ob die Reform
der Agenda 2010 fortgesetzt werden soll", so Schröder. Sie
habe zu vielen Konflikten geführt, unter denen besonders die
SPD gelitten habe. "Geben wir den Menschen die Freiheit, selbst zu
entscheiden, welchen Staat sie wollen", sagte der Kanzler. "Wir
brauchen jetzt klare Verhältnisse".
Merkel: Für eine neue Mehrheit im Bundestag
Die Oppositionsführerin Angela Merkel warf
dem Kanzler dagegen vor, "noch nie habe eine Regierung durch
"ständiges Ausbessern so das Vertrauen der Bürger
verspielt". Das Land brauche eine neue Mehrheit im Bundestag, damit
die Union mit einer Mehrheit im Bundesrat durchregieren könne,
zog die CDU-Vorsitzende ihr Fazit.
Glos: Koalition vor einem Scherbenhaufen
Michael Glos, Sprecher der CSU-Landesgruppe,
sagte, die Koalition stehe "vor einem gewaltigen Scherbenhaufen
ihrer eigenen Politik". Der FDP-Vorsitzende Guido
Westerwelle bekräftigte zudem, Schröder sei
nicht an der Opposition gescheitert, sondern am mangelnden Mut. Die
"guten Jahre von Rot-Grün" hätten der Republik die
höchste Arbeitslosigkeit seit ihrer Gründung
gebracht.
Regierung hat Verantwortung wahrgenommen
Bundesaußenminister Joschka Fischer
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), gab zu, er hätte sich
gewünscht, das Mandat bis zum Ende auszuführen. Er
verteidigte die Koalition aber gegen Angriffe: "Sie wollten eine
Generation von 1968 nicht durch Deutsche gewählt haben", hielt
er der Opposition vor. Trotzdem habe die Regierung ihre
Verantwortung wahrgenommen, auch in Fragen von Krieg und
Frieden.
Tiefpunkt der demokratischen Kultur
Zum Schluss der Debatte sagte der Abgeordnete Werner
Schulz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) in einer
persönlichen Erklärung, er werde sich an der Abstimmung
nicht beteiligen, da es sich um eine "fingierte Vertrauensfrage"
handele. Der Bundeskanzler habe das Grundgesetz gebeugt: "Das ist
nicht nur ein Tiefpunkt der demokratischen Kultur, das ist ein
würdeloser Abgang!", empörte sich der frühere
DDR-Bürgerrechtler.
Vertrauensfrage in der bundesdeutschen Geschichte
In der fast 60-jährigen Geschichte der Bundesrepublik wurde
insgesamt fünf Mal die Vertrauensfrage gestellt, zweimal blieb
der bestätigte Kanzler im Amt, drei Mal führte sie zur
Auflösung des Parlaments und Neuwahlen: Dies geschah 1972
unter Willy Brandt (SPD), 1982 unter
Helmut Kohl (CDU) und 2005 unter Gerhard
Schröder. Schröder war es auch, der gleich zwei Mal zu
diesem Instrument griff. Vor 2005 verknüpfte er schon 2001 die
Vertrauensfrage mit der Entscheidung über Beteiligung der
Bundeswehr am Afghanistan-Einsatz.
Schleichweg zu vorgezogenen Neuwahlen
Schon Helmut Kohl ließ sich 1982 das Misstrauen aussprechen, um vorgezogene Neuwahlen zu erreichen. Eine Selbstauflösung des Bundestages oder ein Beschluss für eine vorgezogene Neuwahl ist im Grundgesetz nämlich nicht vorgesehen. Artikel 68 schreibt nur vor, dass der Bundespräsident den Bundestag innerhalb von 21 Tagen auflösen kann, wenn der Kanzler im Parlament bei einer Vertrauensfrage keine Mehrheit hat. Indem Schröder 2005 absichtlich an der Vertrauensfrage scheiterte, nutzte er einen verfassungsrechtlichen Schleichweg, der umstritten ist. Das Bundesverfassungsgericht urteilte zwar am 16. Februar 1983, der Bundespräsident könne das Parlament trotz dieses nicht ganz sauberen Verfahrens auflösen. Doch dieser Weg zu Neuwahlen solle nicht die Regel werden, so die Verfassungshüter.